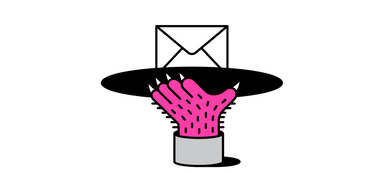
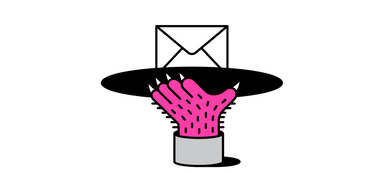
Was Sie zum Ende der Credit Suisse und zur neuen Mega-UBS wissen sollten
Ein Sonderbriefing zur grossen Übernahme. Plus: das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (228).
Von Philipp Albrecht, Dennis Bühler, Angela Gross, Lukas Häuptli und Priscilla Imboden, 23.03.2023
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Die UBS kauft die Credit Suisse – auf Geheiss des Bundesrats. Was noch vor Wochen unvorstellbar schien, ist Tatsache geworden.
Deshalb lesen Sie heute kein gewöhnliches «Briefing aus Bern», sondern eine Sonderausgabe. Letztmals griffen wir nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine auf dieses Instrument zurück. Nun erneut. Denn auch das Ende der Grossbank Credit Suisse (CS) und das Entstehen einer Monster-UBS sind von höchster (wirtschaftspolitischer) Bedeutung. Was vor vier Tagen an einer denkwürdigen Medienkonferenz verkündet wurde, ist schon jetzt historisch.
Was geschehen ist
Am Mittwoch, 15. März, gibt die Saudi National Bank bekannt, kein weiteres Geld in die Credit Suisse zu investieren. Sie ist die grösste Einzelaktionärin der Bank und hält zu diesem Zeitpunkt einen Aktienanteil von knapp 10 Prozent. Darauf stürzt der Kurs der CS-Aktie zwischenzeitlich auf 1.70 Franken. Im Verlauf des Mittwochs verdichten sich die Gerüchte, dass die CS unter ernsthaften Liquiditätsproblemen leidet. Und am Abend wird bekannt, dass sie von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) einen Kredit von bis zu 50 Milliarden Franken erhält. Am Donnerstagnachmittag kommen SNB-Präsident Thomas Jordan, Finanzministerin Karin Keller-Sutter sowie Marlene Amstad, Präsidentin der Finanzmarktaufsicht (Finma), zusammen. Um 16 Uhr nehmen sie Kontakt mit der UBS auf, wie die «Financial Times» berichtet. Die UBS soll, so der Plan, die CS übernehmen. Ein paar Stunden später tagt der Gesamtbundesrat.
Am Samstag und Sonntag macht das Gerücht die Runde, die UBS kaufe die Credit Suisse. Kolportierter Kaufpreis: 1 Milliarde Franken. Am Sonntagabend steht dann fest: Die UBS übernimmt die CS für 3 Milliarden Franken. Den Deal möglich machten vor allem Bundesrat, SNB und Finma. Er sieht so aus: UBS und CS erhalten von der SNB Kredite in Höhe von bis zu 200 Milliarden Franken; diese sind durch den Bund gesichert. Daneben gewährt der Bund der UBS eine sogenannte Ausfallgarantie von 9 Milliarden Franken. Bei seinen Entscheiden stützt sich der Bundesrat hauptsächlich auf das in der Verfassung verankerte Notrecht. Dieses ermöglicht es ihm, Massnahmen zu treffen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen». Trotz der 209-Milliarden-Hilfe sagt Karin Keller-Sutter am Sonntagabend an der Medienorientierung: «Das ist kein Bail-out» – es handle sich nicht um eine staatliche Rettung.
Wie es dazu kommen konnte
Der Sinkflug der CS hatte sich schon länger abgezeichnet. Da waren einerseits die Skandale: Geldwäscherei, ein Datenleck mit vertraulichen Informationen und der Skandal um das Kreditinstitut Greensill, um nur einige zu nennen. Andererseits waren da das Chaos um die interne Reorganisation und ein miserables Geschäftsjahr 2022, das die CS mit einem Minus von über 7 Milliarden Franken abschloss. Aktionäre und Kundinnen verloren zunehmend das Vertrauen in die Bank: 2022 flossen Milliarden an Kundengeldern ab. Am 10. März löste schliesslich der Kollaps der amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) eine Schockwelle in den Finanzmärkten aus. Aus Angst, der Konkurs der SVB könnte sich auf das globale Finanzsystem auswirken, zogen Kundinnen ihre Gelder ab und Anleger verkauften im grossen Stil Aktien, worauf die Kurse in ganz Europa mit Verlusten reagierten.
Der Sinkflug der CS-Aktie wurde zusätzlich beschleunigt, als die Saudi National Bank bekannt gab, kein weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen. Dass der Grund dafür nicht zwingend die Schieflage der CS sein muss, sondern ein regulatorischer sein könnte, spielte zu diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Das Signal schien klar: Die CS ist nicht mehr vertrauenswürdig. Schliesslich fiel die Aktie auf ein Rekordtief – und die SNB eilte zur Hilfe.
Was die Übernahme für die CS, ihre Angestellten, Kunden und Aktionärinnen bedeutet
Die konkreten Auswirkungen sind noch nicht restlos geklärt. CS-Kundinnen werden in ein paar Wochen oder Monaten – wann die Übernahme vollzogen wird, steht noch nicht fest – faktisch UBS-Kundinnen sein. Möglicherweise erhalten sie dann einen neuen Bankberater. Darüber hinaus dürfte sich kurz- und mittelfristig wenig ändern. Der Zahlungsverkehr etwa läuft ohne Unterbruch weiter. Für viele der knapp 17’000 Angestellten der CS in der Schweiz – und einige der rund 21’000 Schweizer UBS-Mitarbeiter – dürfte die Übernahme hingegen einschneidende Auswirkungen haben. Da es viele Doppelspurigkeiten geben dürfte, droht eine Massenentlassung im Umfang von 10’000 Personen oder mehr. Betroffen sein dürften vor allem Leute im Personalwesen, in der Kommunikation, im Backoffice und in den Filialen. Eine Auswertung von CH Media zeigt, dass 66 von 98 Filialen der CS weniger als 300 Meter von einer UBS-Filiale entfernt sind. Dies nicht nur am Zürcher Paradeplatz, sondern auch in Olten, Vevey, Winterthur, Aarau und Baden. Hier drohen auch Schliessungen.
Nicht wenig Geld verlieren die Aktionärinnen sowie eine Kategorie von Gläubigern: Die Finma hat sogenannte Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) im Wert von 16,2 Milliarden Franken abgeschrieben. Das sind Anleihen, die nach der Finanzkrise 2008 geschaffen wurden und die sich im Falle einer Insolvenz der Bank hätten in Eigenkapital verwandeln sollen. Wer hingegen CS-Aktien besitzt, erhält dafür UBS-Aktien im Wert von weniger als der Hälfte des letzten CS-Aktienkurses vor der Zwangsübernahme. Das trifft die Saudi National Bank am stärksten. Sie verliert 1,12 Milliarden Franken. Weitere grössere Aktionäre, die Abstriche machen müssen, sind der katarische Staatsfonds sowie der Vermögensverwalter Blackrock. Daneben zählt die CS rund 100’000 Privataktionärinnen und 2500 institutionelle Anleger wie Pensionskassen. Klagen sind möglich, ihre Erfolgsaussichten allerdings ungewiss.
Wie die CS weiter Boni verteilen wollte – und der Bundesrat das nun untersagt
Seit 2013 machte die CS Verluste von kumuliert 3,2 Milliarden Franken – und doch erhielten ihre Topmanager im selben Zeitraum Boni im Wert von 32 Milliarden. Noch am Montag wollte die Bank an diesem Geschäftsgebaren festhalten: Sie versprach ihren Mitarbeiterinnen, noch nicht ausbezahlte variable Vergütungen wie geplant morgen Freitag, 24. März, zu überweisen und abgemachte Lohnerhöhungen zu gewähren. Auch viele Schweizer Parlamentarier fragten sich: Meint die CS-Spitze das wirklich ernst? Will sie für das Jahr 2022 trotz milliardenschwerer Staatshilfe rund eine Milliarde Franken ausschütten? Bundesrätin Karin Keller-Sutter äusserte sich am Sonntag missverständlich. Am Dienstagabend stellte der Bundesrat dann aber klar, dass er die Boni-Auszahlung an CS-Kader sistiere. Das betrifft bereits zugesicherte, aber aufgeschobene Vergütungen für die Geschäftsjahre bis und mit 2022, zum Beispiel in Form von Aktienansprüchen. Grundlage dafür ist Artikel 10a des Bankengesetzes, wonach Boni ganz oder teilweise verboten werden können, wenn einer systemrelevanten Bank direkt oder indirekt staatliche Beihilfe aus Bundesmitteln gewährt wird. Während der Übergangsphase ist der CS zudem die Auszahlung von Dividenden untersagt.
Was es für die UBS bedeutet
Die UBS wird mit der Übernahme der CS zur Nummer 21 unter den bilanzstärksten Banken der Welt. Zuvor lag sie auf Rang 34. Neu verwaltet sie nach eigenen Angaben Vermögen in der Höhe von 5 Billionen Dollar. Der Kurs der UBS-Aktie ist in den letzten drei Tagen gestiegen; am Montagmorgen lag er bei 15.64 Franken; am Mittwochabend bei 18.70 Franken. Wegen der Übernahme der CS gerät die UBS allerdings vermehrt in die Kritik – aufgrund ihrer schieren Grösse. So sagt der emeritierte Finanzmarktprofessor Urs Birchler der Republik: «Staatspolitisch ist die UBS ein Problem. Auch weil sie einen gewissen Einfluss haben wird.»
Wie die Reaktionen im Inland ausfielen
Die Schweizer Parteien zeigen sich grösstenteils unzufrieden mit dem Deal. Und sie sind – wie Urs Birchler – besorgt, dass die vergrösserte UBS erst recht zu einem unkalkulierbaren Klumpenrisiko für die Volkswirtschaft werde. Auch in der Problemanalyse sind sich die Parteien erstaunlich einig: Alle kritisierten das CS-Management scharf. «Die Gier einzelner Banker war grösser als ihre Verantwortung», sagte FDP-Nationalrat Beat Walti an einer Medienkonferenz. SP-Fraktionschef Roger Nordmann sagte, das Verhalten der CS-Führung grenze an organisierte Kriminalität. Und Mitte-Nationalrat Nicolò Paganini twitterte noch während der bundesrätlichen Medienorientierung: «Jetzt platzt auch mir Wirtschaftsfreundlichem der Kragen: Jahrelang überzogene Boni kassieren, Risiken nicht im Griff haben, über zu strenge Regulierung der Banken lamentieren … und nun muss an den ‹Too big to fail›-Regeln vorbei der Bund wieder retten.»
Weil sämtliche Parteien mit Ausnahme der SVP eine ausserordentliche Parlamentssession verlangen, werden National- und Ständerat in der Osterwoche darüber diskutieren, welche politischen Lehren aus dem Untergang der CS zu ziehen sind. Noch offen ist, ob eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) gebildet wird; während sich die SP, die Grünen und die Grünliberalen dafür starkmachen, zögern Mitte und FDP. Die SVP lehnt eine PUK ab, spart aber ebenfalls nicht mit Kritik: Sie wirft dem Bundesrat vor, die «Too big to fail»-Regeln wegen ausländischen Drucks nicht angewandt zu haben, und fordert eine Mindestquote von Schweizerinnen in den Verwaltungsräten börsenkotierter Unternehmen; nur so sei eine gewisse Verpflichtung dem Land gegenüber sichergestellt. Die politische Linke setzt die Prioritäten anders: SP und Grüne verlangen die Einführung eines Trennbankensystems – das risikoreiche Investmentbanking soll die Kreditbanken und die Vermögensverwaltung nicht länger ins Verderben stürzen können.
Was es für die Schweiz bedeutet
Dass eine über 150 Jahre alte Grossbank über Jahre hinweg zuverlässig Skandale produziert und am Ende durch eine vom Staat angeordnete Übernahme vor dem Konkurs gerettet werden muss, ist für die Schweiz kein Ruhmesblatt. Der Ruf des Finanzplatzes ist nachhaltig geschädigt. Die Rettung selber ist auch problematisch, da die Schweiz aus Sicht von Juristen – darunter Rechtsprofessor Peter V. Kunz – leichtfertig Notrecht angewandt hat. Kunz rechnet mit Klagen von geschädigten Aktionärinnen. Gleichzeitig müssen nun insbesondere mittelgrosse Unternehmen, die international tätig sind, mit schlechteren Bedingungen bei Krediten rechnen. Wenn nur noch eine global aktive Schweizer Grossbank im Rennen ist, fehlt der Wettbewerb. Diese Tatsache führt ausserdem zu möglichen Schwierigkeiten bei der Gesetzgebung. «Wenn die Politik von nun an Gesetze zu Banken behandelt, dann wird das immer ein Gesetz gegen ein bestimmtes Institut sein: gegen die UBS», sagt Urs Birchler. «Eine Gesetzgebung, die nicht eine gewisse Grundneutralität hat, ist schwierig.»
Was sonst noch wichtig war
SRG-Wahlbarometer: Die Welt spielt verrückt, die Schweizer Politik aber bleibt ein Hort der Stabilität – so könnte man das gestern veröffentlichte Ergebnis einer gewichteten und repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der SRG zusammenfassen. Mit Ausnahme der Grünen kommt es rund sieben Monate vor den eidgenössischen Wahlen bei keiner Partei zu einer prozentualen Veränderung ausserhalb des statistischen Fehlerbereichs von plus/minus 1,2 Prozentpunkten. Die Befragung wurde Ende Februar und Anfang März durchgeführt, also einige Wochen vor dem Untergang der Credit Suisse.
Die Grünen verlieren
Ergebnis Wähleranteile laut repräsentativer Umfrage
Quelle: SRF. Die Veränderung zur Wahl 2019 ist jeweils in Prozentpunkten in Klammern angegeben.
Plagiats- und Titelschwindelvorwürfe: Der designierte neue Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands, Henrique Schneider, soll seit mindestens zehn Jahren in seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen abgeschrieben und zwei Professuren vorgetäuscht haben. Das berichtete die «NZZ am Sonntag» in ihrer letzten Ausgabe, basierend unter anderem auf einem Gutachten des österreichischen Plagiatsforschers Stefan Weber. Schneider, der Hans-Ulrich Bigler ab dem 1. Juli ersetzen soll, bestreitet die Vorwürfe. Der SGV lässt sie nun durch einen externen Gutachter untersuchen. Dessen Verdikt soll vor dem Amtsantritt vorliegen.
BVG-Revision: Das Parlament hat diverse Änderungen beim Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge verabschiedet. Auslöser für die Revision ist, dass die Pensionskassen wegen der Überalterung der Gesellschaft seit einigen Jahren mehr Geld für die Finanzierung der laufenden Renten aufwenden müssen, als zuvor von Arbeitgeberinnen und -nehmerinnen angespart worden ist. Weil das Parlament eine Rentenkürzung beschlossen hat, werden die Gewerkschaften, die SP und vermutlich auch die Grünen Unterschriften für eine Referendumsabstimmung sammeln. Dass ein solches zustande kommt, gilt als sicher. Und es werden ihm auch gute Chancen an der Urne eingeräumt.
Parlamentssession: Im Rahmen der am vergangenen Freitag zu Ende gegangenen Frühjahrssession von National- und Ständerat wurden 15 weitere Vorlagen unter Dach und Fach gebracht. Dabei ging es unter anderem um Raserdelikte, die Gletscherinitiative und eine Änderung im Zivilprozessrecht, mit der die Veröffentlichung missliebiger Medienartikel einfacher verhindert werden kann.
Tonnagesteuer: Im Dezember hat der Nationalrat beschlossen, Schifffahrtsgesellschaften mit Sitz in der Schweiz künftig nicht mehr nach ihren realen Gewinnen, sondern – wenn sie das wünschen – nur noch nach ihren Transportkapazitäten für Güter (oder auch Personen) zu besteuern. Am vergangenen Samstag haben die Grünen entschieden, das Referendum zu ergreifen, falls auch der Ständerat für diese sogenannte Tonnagesteuer stimmt. Ein Referendum könnte durchaus von Erfolg gekrönt sein.
Illustration: Till Lauer