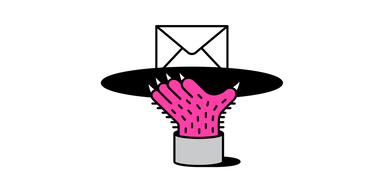
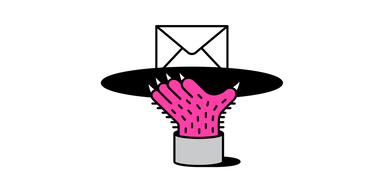
Wie sich der Bundesrat dem Sanktionsdruck beugte, was er der EU vorschlägt – und wie ein neuer Graben die Fraktionen spaltet
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (181).
Von Philipp Albrecht, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine und Priscilla Imboden, 03.03.2022
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Am Montag voriger Woche verlief die Schweizer Politik noch in geordneten Bahnen. Soeben von einer Corona-Erkrankung mit mildem Verlauf genesen, hielt Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis bei einem Abendessen mit Bundeshausjournalistinnen eine launige Rede. 2300 Kilometer entfernt informierte der russische Präsident Wladimir Putin zur selben Zeit darüber, dass er die «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass als unabhängige Staaten anerkenne.
Trotz dieses eklatanten Bruchs des Völkerrechts: Damit, dass Putins Erklärung der Auftakt zu einem Krieg und zu weltweiten Verwerfungen war, rechnete zu jenem Zeitpunkt kaum jemand. Auch nicht der Bundesrat, der von der Entwicklung offenkundig völlig überrascht wurde.
An ihrer Sitzung vom Mittwoch, 23. Februar, sprach die Landesregierung zwar darüber, wie sich die Schweiz zur russischen Aggression positionieren soll. Eine Entscheidung aber fällte sie nicht. Auch deshalb, weil der für Sanktionen zuständige Wirtschaftsminister Guy Parmelin gar keinen formellen Antrag gestellt hatte, wie die Tamedia-Mantelredaktion in einer ausführlichen Rekonstruktion der Ereignisse berichtet. Recherchen der Republik bestätigen dieses Bild.
Nach der Invasion der russischen Armee bestellte Cassis seine Kollegen am Donnerstagmorgen zu einer ausserordentlichen Bundesratssitzung. Doch wieder wurden keine Beschlüsse gefällt. Die Medienkonferenz, die Cassis unmittelbar nach dem Verlesen seiner Erklärung verlässt, gerät zum Debakel. Trotz mehrerer Nachfragen der anwesenden Journalistinnen weiss am Ende niemand, ob die Schweiz die von der EU erlassenen Sanktionen de facto vollständig übernimmt. Denn offiziell ergreift sie lediglich «Massnahmen, um die Umgehung der EU-Sanktionen via Schweiz zu vermeiden».
Dieselbe Formulierung wurde schon 2014 verwendet, als Russland die Krim annektierte. Doch die Tragweite des aktuellen russischen Feldzugs ist eine völlig andere: Innert Kürze wurden weltweit nie gesehene Sanktionen gegen Russland erlassen. Entsprechend gross war das Unverständnis für die lasche Reaktion der Schweiz.
Der Druck auf den Bundesrat steigt international und national: Die stellvertretende Aussenministerin der USA interveniert, und in Bern kommt es zur grössten Friedensdemonstration seit dem Irakkrieg 2003.
Am Montag dieser Woche vollzog die Regierung den Kurswechsel: Die Schweiz übernimmt die EU-Sanktionen vollständig. Unter anderem sperrt sie die Konten von fast 400 russischen Staatsbürgerinnen, erlässt Einreisesperren gegen 5 Oligarchen und sperrt den Luftraum für russische Flugzeuge. «Dies ist ein einmaliger Schritt der Schweiz, den wir uns unter Aspekten der Neutralität nicht leicht machen durften», sagt Cassis. «Doch einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral. Als Depositarstaat der Genfer Konventionen sind wir humanitären Geboten verpflichtet und dürfen nicht zusehen, wie diese mit Füssen getreten werden.»
Nicht betroffen ist von den Sanktionen allerdings der Rohstoffhandel – was bemerkenswert ist angesichts der Tatsache, dass 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels über die Schweiz laufen.
Damit zu anderen Themen, die in den letzten sieben Tagen innenpolitisch zu reden gegeben haben.
Bilaterale Beziehungen mit der EU: Der Bundesrat macht Vorschläge
Worum es geht: Der Bundesrat hat skizziert, wie er die bilateralen Beziehungen mit der EU weiterführen will. Sein Ansatz: Es solle ein neues Vertragspaket geben, eine Art Bilaterale III – auch wenn er es noch nicht so nennt – das nicht nur bestehende Marktzugangsabkommen umfasst, sondern auch neue im Bereich Strom und Lebensmittelgesundheit sowie Kooperationsabkommen im Bereich Forschung, Bildung und Gesundheit. Die Idee dahinter: Wenn die Verhandlungsmasse grösser ist, so gibt es mehr Spielraum für ein Geben und Nehmen. Die Elefanten im Raum bleiben aber weiterhin die sogenannten institutionellen Fragen: Die EU fordert seit Jahren, dass die Schweiz die Binnenmarktregeln laufend übernimmt und dass es ein Gericht oder ein Schiedsgericht gibt, das entscheidet, wenn man sich uneinig ist über die Umsetzung der bilateralen Verträge. Das gescheiterte Rahmenabkommen hätte diese Fragen regeln sollen. Bundespräsident Ignazio Cassis hielt fest: «Ein Rahmenabkommen 2.0 ist kein Thema.» Stattdessen will der Bundesrat diese Fragen individuell in den einzelnen Abkommen lösen. Zusätzlich prüft er, den Beitrag an die EU-Kohäsion, die Ostmilliarde, regelmässig zu entrichten, um der EU entgegenzukommen.
Warum Sie das wissen müssen: Mit dem Aus für das Rahmenabkommen vor neun Monaten ist der bilaterale Weg zwischen der Schweiz und der EU in einer Sackgasse angekommen. Die EU weigert sich, die bisherigen Marktzugangsabkommen zu aktualisieren, was bedeutet, dass Exportfirmen zunehmend Probleme bekommen, weil ihre Produkte in der EU nicht mehr zugelassen werden. Ausserdem schliesst die EU die Schweizer Forscherinnen und Universitäten vom Programm Horizon Europe aus, das für den Forschungsplatz wichtig ist.
Wie es weitergeht: Staatssekretärin Livia Leu soll nun mit dem neuen Vorschlag in der Tasche in Brüssel Sondierungsgespräche führen und abklären, ob die EU bereit ist, auf dieser Basis Verhandlungen aufzunehmen. Das ist unklar, wie der EU-Botschafter in der Schweiz andeutet. Parallel dazu führt Alt-Staatssekretär Mario Gattiker Gespräche mit den Kantonen und den Sozialpartnern, um den innenpolitischen Spielraum auszuloten. Die Parteien reagierten unterschiedlich auf den Vorschlag. Die FDP bezeichnete den bilateralen Weg als «einzige Lösung», die SP erachtet ihn als «eher unrealistisch», da sie nicht glaubt, dass Brüssel darauf einsteigen wird. Die SVP kündigt Widerstand an dagegen, dass sich die Schweiz «EU-Recht und EU-Richtern unterwirft».
Gentechnik: Nationalrat ist gegen eine Aufweichung des Moratoriums
Worum es geht: Der Nationalrat lehnte es gestern Mittwoch ab, für das Gentechnik-Moratorium eine Ausnahme zu definieren. Zur Diskussion stand, künftig Genom-Editierungsmethoden zuzulassen – eine neue Gentechnik, mit der sich das Genom, also das Erbgut, gezielt editieren lässt. Stattdessen will der Nationalrat das Moratorium wie gehabt bis Ende 2025 verlängern. Als Kompromiss schlägt er aber vor, dass der Bundesrat dem Parlament bis Mitte 2024 einen Entwurf vorlegt, der zeigt, wie genau man die neuen Züchtungsmethoden zulassen könnte – solange diese einen Mehrwert für Landwirtschaft, Umwelt oder Konsumentinnen schaffen.
Warum Sie das wissen müssen: Im Jahr 2005 sagte die Schweizer Stimmbevölkerung Ja zu einer Volksinitiative, die ein fünfjähriges Gentech-Moratorium für die Landwirtschaft verlangte. Damit wurde unter anderem verboten, gentechnisch veränderte Organismen in die Schweiz einzuführen oder zu anderen als Forschungszwecken anzubauen. Das Moratorium wurde seither dreimal verlängert und soll nun ein weiteres Mal bis Ende 2025 verlängert werden. Doch im letzten Dezember stellte sich der Ständerat erstmals gegen ein striktes Moratorium: Er schlug vor, gentechnisch veränderte Organismen in Zukunft zuzulassen, solange ihnen kein transgenes Erbmaterial eingefügt wurde. Befürworter argumentieren, dass mit der neuen Gentechnik Pflanzen schnell und relativ einfach an den Klimawandel angepasst und gegen Krankheiten resistent gemacht werden können. So sei es auch möglich, mit Gentechnik den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren.
Wie es weitergeht: Nun ist nochmals der Ständerat an der Reihe, der entscheiden muss, ob er dem Kompromissvorschlag des Nationalrats folgen will.
Halbierungsinitiative: SVP und Co. wollen der SRG die Gebühren kürzen
Worum es geht: Die SVP, der Gewerbeverband und die Jungfreisinnigen haben am Dienstag den Text für die schon seit längerem erwartete Volksinitiative «200 Franken sind genug» bei der Bundeskanzlei eingereicht. Sie wollen, dass die Radio- und Fernsehgebühren von 335 auf 200 Franken sinken und Unternehmen von der Gebührenpflicht befreit werden.
Warum Sie das wissen müssen: Zwei Wochen nach der Ablehnung des Medienförderungsgesetzes gehen die Wogen in der Medienpolitik erneut hoch. Ein Ja zur Initiative träfe die gesamte SRG, wobei nach dem Willen der Initianten «vor allem das deutschsprachige SRF massiv zurückgestutzt werden» soll, wie SVP-Präsident Marco Chiesa sagte. Im Jahr 2020 erhielt die SRG rund 1,3 Milliarden Franken aus dem Gebührentopf, nun sollen es gemäss den Initiantinnen noch gut 600 Millionen Franken pro Jahr sein. «Dies bedingt zweifellos eine deutliche Entschlackung des Programms», heisst es im Argumentarium des Komitees. Die privaten Sender sollen weiterhin den heutigen Gebührenbeitrag erhalten. Die SRG kündigte an, den «erneuten massiven Angriff gegen den medialen Service public» zu bekämpfen. Bereits vor zwei Wochen hatte sich zudem eine «Allianz Pro Medienvielfalt» gebildet, die ihren Erfolg bei der No-Billag-Initiative wiederholen will: Die ebenfalls von libertären Kräften lancierte, aber noch deutlich radikalere Anti-SRG-Initiative wurde im März 2018 mit mehr als 71 Prozent Nein-Stimmen wuchtig abgelehnt.
Wie es weitergeht: Die Initianten haben nun 18 Monate Zeit, um 100’000 Unterschriften zu sammeln – die «Halbierungsinitiative» dürfte im Wahljahr 2023 somit in aller Munde sein. Als primäres Wahlvehikel tauge sie aber nicht, sagte SVP-Chef Chiesa gegenüber der Republik. «Andere Themen werden für uns im kommenden Jahr wichtiger sein.» Kommt die Initiative zustande, nimmt erst der Bundesrat dazu Stellung, bevor sie vom Parlament behandelt und schliesslich der Stimmbevölkerung vorgelegt wird.
Post: Werden Briefe nur noch dreimal pro Woche verteilt?
Worum es geht: Die Post soll in Zukunft nur noch dreimal pro Woche Briefe verteilen, und das nur noch per B-Post, gleichzeitig das Tempo bei der Paketauslieferung erhöhen und sich von einem grossen Poststellennetz verabschieden. Das sind die drei wichtigsten Vorschläge einer Expertenkommission, die für den Bundesrat die Zukunft des Staatsunternehmens ab dem Jahr 2030 skizziert hat. In ihrem Bericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, kommt die Kommission unter der Leitung von Alt-Ständerätin Christine Egerszegi (FDP) ausserdem zum Schluss, dass die Verteilung von Zeitungen und Zeitschriften künftig aus dem Grundversorgungsauftrag verschwinden soll.
Warum Sie das wissen müssen: Die Post hat ihre besten Tage längst hinter sich. Hin- und hergerissen zwischen Grundversorgung und freiem Markt, schlingert sie in eine aussichtslose Zukunft. Selbst der Bundesrat, der dem 7-Milliarden-Konzern mit seinen 54’000 Angestellten die strategischen Ziele vorgibt, ist mit seinem Latein am Ende. Aus diesem Grund hat er Experten um Hilfe gebeten. Die Situation ist deshalb so dramatisch, weil die beiden wichtigsten Einnahmequellen seit Jahren schrumpfen: die Briefpost und das Finanzgeschäft der Bankentochter Postfinance. Letztere leidet unter den Minuszinsen und dem nur für sie geltenden Kredit- und Hypothekarverbot. Gleichzeitig muss sie in der Schweiz den Zahlungsverkehr als Grundversorgung anbieten. Die Kommission schlägt nun vor, diesen Auftrag auszuschreiben.
Wie es weitergeht: Das Parlament ist über den künftigen Weg der Post völlig uneinig. Diverse Vorstösse zur Modernisierung stehen an, allen voran die wenig Erfolg versprechende Privatisierung der Postfinance. Auch die neuen Vorschläge kommen bei vielen Parlamentarierinnen schlecht an. Gegenwehr gibts auch vom Verlegerverband und von der Post selber, die einzig in der Tatsache, dass über die Zukunft der Post nachgedacht wird, etwas Positives sieht.
Foie-gras-Graben der Woche
Bei den meisten Abstimmungen im Nationalrat entscheiden die Fraktionen mehr oder weniger geschlossen. Ganz anders aber war es am Montag bei einer Motion des Zürcher SVP-Landwirts Martin Haab, die ein «Importverbot für tierquälerisch erzeugte Stopfleber» forderte: In der SVP sprachen sich 33 Nationalräte für das Verbot aus und 17 dagegen, bei der SP war das Verhältnis 28:7 und bei der Mitte 17:10. Entscheidend war für einmal nicht die Zugehörigkeit zur Partei – sondern jene zur Landesregion. Schliesslich essen an Weihnachten nicht wenige Romands Foie gras zur Vorspeise. Die Republik hat ausgewertet, wie die welschen Parlamentarierinnen stimmten. Und siehe da: Während der gesamte Nationalrat die Motion mit 119:61 Stimmen annahm, fand sie bei den Vertretern der Romandie keine Mehrheit – 27 Welsche sagten Nein, 23 Ja. Der Foie-gras-Graben durchzog jede Partei. Mit einer Ausnahme: Die 13 bei der Abstimmung anwesenden Grünliberalen sprachen sich geschlossen für die Motion aus, inklusive der 3 zur Fraktion gehörenden Welschen. Weil sie sich einem Diktat der Deutschschweizer Kolleginnen zu beugen hatten oder weil ihnen die Stopfleber an Heiligabend jeweils im Hals stecken bleibt?
Illustration: Till Lauer