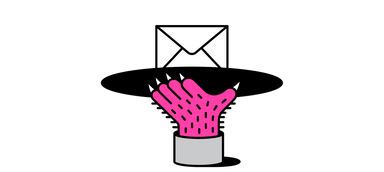
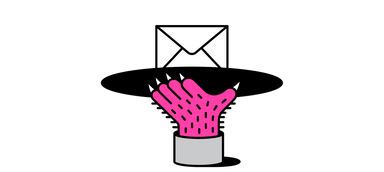
Bürgerliche wollen näher zur Nato, Bundesrat für «Nein heisst Nein» – und der Bund bezahlt Sprachkurse für Ukrainer
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (187).
Von Dennis Bühler, Priscilla Imboden und Cinzia Venafro, 14.04.2022
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Konflikte heutzutage auch via Internet ausgefochten werden. Schon mehrfach gab es russische Cyberangriffe, etwa mit dem Ziel, die Stromversorgung lahmzulegen. Die Schweiz will sich deshalb besser verteidigen können gegen Angriffe aus dem Cyberspace und dem elektromagnetischen Raum. Der Bundesrat hat dazu einen Grundlagenbericht verabschiedet, der aufzeigt, wie die Schweizer Armee ihre Cyberabwehr verstärken soll. Die Truppen sollen mit modernen Informations- und Kommunikationssystemen ausgerüstet werden und im Sicherheitsverbund Schweiz mit zivilen Behörden kooperieren. Die Modernisierung wird in den nächsten Jahren bis zu 2,4 Milliarden Franken kosten.
Ganz generell befeuert der Krieg in der Ukraine sicherheitspolitische Debatten in der Schweiz. Bürgerliche wollen aufrüsten und haben dazu in den Parlamentskommissionen bereits Vorstösse eingereicht. Dabei stellen sich alte Fragen mit neuer Brisanz.
FDP-Präsident Thierry Burkart publizierte einen Leitartikel in der NZZ, in dem er eine stärkere Zusammenarbeit mit der Nato propagiert: «Die Schweiz als Kleinstaat ist in einem modernen Konflikt aus technologischen und finanziellen Gründen in der Regel nicht mehr in der Lage, sich autonom zu verteidigen.» Das Land sei im Falle eines Angriffs auf die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften angewiesen. Was das konkret bedeuten könnte, führt er am Beispiel von Schweden und Finnland aus, die an militärischen Übungen mit der Nato teilnehmen, aber nicht Bündnismitglied sind. Burkart geht aber nicht so weit, dass er den Nato-Beitritt fordert, das sei aus neutralitätsrechtlichen Gründen keine Option.
Ähnlich äusserte sich Mitte-Präsident Gerhard Pfister in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung». Er fragt sich: «Was ist der Beitrag der neutralen Schweiz bei einem Verteidigungsfall in Europa?» Pfister plädierte dafür, dass die Schweiz die F-35-Kampfjets, die sie kaufen will, für die Luftpolizei in Europa einsetzt. Es sei eine Illusion, zu glauben, die Schweiz könne sich erst verteidigen, wenn feindliche Truppen die Schweizer Grenze überschreiten, so Pfister: «Deshalb macht es Sinn, wenn wir über koordinierte Verbundsaufgaben jetzt nachdenken.»
Auf der linken Seite fordert die SP eine stärkere Zusammenarbeit mit der europäischen Verteidigungsorganisation Pesco. Auf der rechten Seite stürzt die Sicherheitsdebatte die SVP in ein Dilemma: In der Volkspartei gibt es Sympathien für die Zusammenarbeit mit der Nato, gleichzeitig möchte sie mit einer Initiative die Neutralität festigen.
Und damit zum Briefing aus Bern.
Sprachunterricht: 3000 Franken pro Flüchtling aus der Ukraine
Worum es geht: Ukrainischen Flüchtlingen soll der Zugang zum Sprachunterricht erleichtert werden. Der Bundesrat hat beschlossen, die Kantone mit 3000 Franken pro Person zu unterstützen, damit diese Angebote für Sprachkurse umsetzen können. Da der Schutzstatus S «grundsätzlich rückkehrorientiert» ist, sieht das Ausländer- und Integrationsgesetz eigentlich keine Ausrichtung einer Integrationspauschale an die Kantone vor.
Warum Sie das wissen müssen: Längst ist eine Debatte darüber entbrannt, wer in welchem Mass für die Lebenshaltungskosten der bereits mehr als 30’000 in die Schweiz geflüchteten Ukrainerinnen aufkommen soll. Ein Vergleich der «SonntagsZeitung» hat gezeigt: Die finanzielle Hilfe für diese Leute liegt in weiten Teilen der Schweiz unter dem Existenzminimum. Sie erhalten zwar ohne langwieriges Asylverfahren den Schutzstatus S, die Kantone können aber weitgehend selber bestimmen, wie viel Geld sie ihnen zum Leben geben. Im Kanton Aargau etwa erhält eine ukrainische Mutter mit zwei Kindern 865 Franken monatlich für den sogenannten Grundbedarf.
Wie es weitergeht: Die Gesetze unterscheiden zwischen regulärer Sozialhilfe für Schweizer Bürger und anerkannte Flüchtlinge und der Asylsozialhilfe mit deutlich tieferen Ansätzen. Ukrainerinnen mit Schutzstatus S fallen in die zweite Kategorie. Diese unterschiedliche Einstufung wird von linker Seite nicht erst seit dem Ausbruch des Kriegs kritisiert. Nun aber hegt sogar SVP-Asylhardliner Andreas Glarner Bedenken, dass die Unterstützung für die Ukrainer nicht zum Leben reiche. Doch während linke und grüne Politikerinnen für alle vorläufig Aufgenommenen mehr Unterstützung fordern, will der SVP-Vertreter höchstens eine Erhöhung für Ukrainer. Die GLP wiederum verlangt, dass man den Schutzstatus S «grundsätzlich überarbeitet», so Parteipräsident Jürg Grossen. «Wir dürfen nicht bei den verletzlichsten Menschen knausrig sein und sie noch zusätzlich herunterdrücken.»
Sexualstrafrecht: Bundesrat will «Nein heisst Nein»
Worum es geht: Bevor sich das Parlament ab Juni mit der Revision des Sexualstrafrechts befassen wird, hat der Bundesrat abschliessend Stellung dazu bezogen. Er unterstützt den Grossteil der von der ständerätlichen Kommission für Rechtsfragen eingebrachten Vorschläge: Konkret will er Täter, die gegen den Willen des Opfers handeln, in Zukunft auch dann wegen Vergewaltigung bestrafen, wenn keine Nötigung durch Gewalt oder Drohung vorliegt. Zudem will er trotz so zahlreicher wie lautstarker Kritik in der Vernehmlassung an der Ablehnungslösung («Nein heisst Nein») festhalten, also nichts wissen vom Zustimmungsprinzip («Nur Ja heisst Ja»). Gegen diesen Entscheid wurde gestern erneut protestiert: So überschrieben etwa die SP-Frauen ihre Medienmitteilung mit dem Titel «Bundesrat ohne Haltung».
Warum Sie das wissen müssen: Seit Jahren wird intensiv über eine Reform des Sexualstrafrechts diskutiert, immer wieder auch in der Republik. Diese Woche erhöhte Amnesty International den Druck: Am Dienstag präsentierte die NGO eine vom GFS-Institut erstellte Studie, laut der 45 Prozent der rund tausend befragten Personen die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung wollen, während 27 Prozent die «Nein heisst Nein»-Regel präferieren (und 13 Prozent überhaupt keine Änderung wollen). Frauen, Junge und queere Menschen hätten sich bei der Umfrage am deutlichsten für das Zustimmungsprinzip ausgesprochen, teilte Amnesty mit. Weitere Resultate der Studie: Die Hälfte der befragten Männer interpretiert es als Einwilligung zum Geschlechtsverkehr, wenn das Gegenüber zuvor anderen sexuellen Handlungen zugestimmt habe. Und mehr als ein Drittel der Männer betrachtet es als Einwilligung, «wenn die Person aufreizend gekleidet ist und mit mir geflirtet hat».
Wie es weitergeht: In der Sommersession beschäftigt sich der Ständerat mit der Vorlage. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Nationalrat darüber befinden. Ist die Reform vom Parlament unter Dach und Fach gebracht, kann dagegen das Referendum ergriffen werden.
Lehren aus der Covid-Krise: Ständeräte wollen eine Verfassungsgerichtsbarkeit
Worum es geht: Die Staatspolitische Kommission des Ständerats hat sich überraschend für zwei Motionen ausgesprochen, die die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit fordern. Der Entscheid fiel denkbar knapp: mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Mathias Zopfi. Der Grünen-Ständerat aus dem Kanton Glarus ist Urheber einer der beiden Motionen, die andere stammt vom Bündner Mitte-Ständerat Stefan Engler.
Warum Sie das wissen müssen: Im Unterschied zu vielen anderen Staaten müssen Gerichte in der Schweiz Bundesgesetze anwenden, auch wenn sie der übergeordneten Bundesverfassung widersprechen. Das verlangt Artikel 190 der Verfassung. Etwa einmal pro Jahrzehnt unternehmen Parlamentarier Versuche, daran etwas zu ändern – die letzten scheiterten 1999 und 2012. Die Befürworterinnen argumentieren jeweils, die heutige Rechtslage sei für die Bürger unbefriedigend. Dies, weil vom Bundesgericht nur jene Grundrechte gegenüber der Legislative (also dem Parlament respektive der Stimmbevölkerung) durchgesetzt werden könnten, die auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert werden. Nicht aber zahlreiche andere Grundrechte, die nur in der Bundesverfassung verbrieft sind – darunter Eigentumsrechte, die Wirtschaftsfreiheit oder die Rechtsgleichheit. Die Covid-Krise habe gezeigt, dass das Gleichgewicht zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu überprüfen sei, hält die Kommission fest. Schon im Frühling 2020 war die Forderung aufgekommen, Notverordnungen des Bundesrates müssten auf ihre Verhältnismässigkeit überprüft werden. Die Gegnerinnen einer Änderung warnen vor einer Gewichtsverschiebung von der Legislative zur Justiz.
Wie es weitergeht: Als Nächstes muss der Ständerat über den Vorschlag entscheiden – auch dort dürfte es knapp werden. Sagt er Ja, kommt das Geschäft in den Nationalrat. Stimmen beide Räte zu, muss der Bundesrat einen Vorschlag für eine Verfassungsänderung ausarbeiten.
Schwestern der Woche
Ihre Wahl kommt einer politischen Sensation gleich: Die 29-jährige Politnovizin Valérie Dittli schaffte am Wochenende völlig überraschend den Sprung in die Waadtländer Kantonsregierung. Die Mitte-Politikerin sorgte damit für eine erneute Niederlage der Sozialdemokraten – die bisherige SP-Bildungsdirektorin Cesla Amarelle wurde aus dem siebenköpfigen Regierungsrat abgewählt. Dank Dittli holten die Bürgerlichen in der Waadt nach zehnjähriger linksgrüner Dominanz die Mehrheit zurück. Das Besondere: Die Deutschschweizerin Valérie Dittli lebt erst seit ein paar Jahren in der Waadt und hatte dort noch kein politisches Amt inne. Aufgewachsen ist sie mit ihrer Schwester Laura auf dem Biohof ihrer Eltern in Oberägeri im Kanton Zug. Beide Schwestern beherrschen das Traktorfahren aus dem Effeff, haben Jus studiert – und mischen jetzt den Politbetrieb auf. Denn auch Laura Dittli politisiert für die Mitte, ist Zuger Kantonsrätin und kandidiert im Herbst in ihrem Heimatkanton ebenfalls als Regierungsrätin. Politisiert habe sie aber nicht Mitte-Präsident Gerhard Pfister, der ebenfalls aus Oberägeri stammt, sagen die Schwestern übereinstimmend. Sondern die Diskussionen um den Milchpreis am Familientisch.
Illustration: Till Lauer