
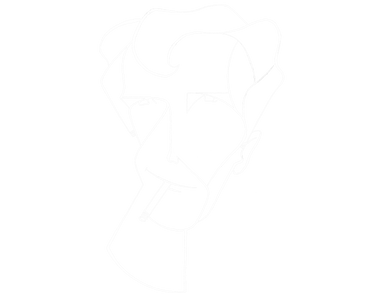
Der, der du niemals sein wirst
Zeiten des Wartens, Zeiten des Kämpfens
ADHS-Kolumne, Folge 11 – Wie schafft man es, mit dem Kopf in den Wolken seine Wünsche auf dem Boden zu verwirklichen?
Von Constantin Seibt, 23.07.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Der einzige Mentor, den ich je hatte, war der WOZ-Redaktor Oskar Scheiben. Er war ein schmaler Mann mit exzentrischen Bewegungen und eleganten Hemden. Er hatte eine Schwäche für Talente und für Jungs – so hatte ich einen Platz in seinem Büro, lange bevor ich offiziell angestellt wurde.
Oskar versorgte mich mit Aufträgen und – wichtiger – mit einem Gegenüber, das ich mochte. Es war eine Freude, am sehr frühen Morgen um halb elf ins Büro zu kommen und ihn zu erfreuen, indem ich sagte: «Klasse Hemd!»
Oskar Scheiben war Bauernbub, Postbeamter, 68er, Historiker, Lehrbeauftragter an der Universität und Punktheoretiker gewesen, bevor er im Journalismus anfing. Er war so ungelenk im Privaten wie neugierig im Intellektuellen. Er war der brillanteste Analytiker, den ich je kennenlernte. Er versetzte mich in Staunen (und ein wenig auch in Furcht), indem er völlig verschiedene Ereignisse vorhersagte: internationale Konflikte, Eishockeyresultate, Schweizer Abstimmungsresultate, das Wetter, Kassenerfolge von Filmen und Büchern, Redaktionsintrigen und den eigenen Tod.
Es war das erste Mal, dass ich trauerte. Ich konnte es schwer fassen, dass die Trams weiterfuhren, verlor mehrmals mein Portemonnaie, und beim Begräbnis in dem Bergdorf, wo er geboren worden war, verliebten der andere Bürokollege und ich uns für zwei, drei Stunden heftig in seine Nichte.
Am Tag danach nahm ich den Plastiksaurier aus seinem Büroregal zur Erinnerung – ein Tyrannosaurus Rex, der bei uns im Schlafzimmer als Fensterstopper arbeitet. Manchmal spielt mein kleiner Sohn damit. Er heisst – nicht ganz ohne Grund – so wie der frühere Besitzer: Oskar.
Ich denke oft an ihn. Auch wegen eines Zitats, das Oskar in guter Laune oft benutzte. Es war ein Satz von Lenin: «Es gibt Zeiten des Wartens und Zeiten des Kämpfens.»
Es erwies sich als echte Hinterlassenschaft. Denn bis heute blieb es das knappste Rezept für mein Leben.
Und es passte auch zu einem ganz anderen Vorbild, von dem ich viel lernte: Christoph Blocher.
Das Gesetz der Präsenz
Zugegeben, Lenins Satz ist für jemanden mit ADHS auf den ersten Blick keine grosse Neuigkeit.
Deshalb, weil dein Alltag dauernd so funktioniert wie ein Auto mit lottrigem Brems- und Gaspedal: mal Lähmung, mal Tempo. Mal Rückschlag, mal Euphorie. Kurz: mit Stop and Go. Und bei komplexen Arbeiten bleibt dir sowieso keine andere Chance, als darauf zu hoffen, dass der Hyperfokus zündet. Ohne ihn hängen deine Gedanken schlaff und unrasiert herum wie Alkoholiker nach dem Aufstehen – mit ihm besitzen sie die klare, kühne Logik grosser Trinkerinnen.
Fast alles, was taugte, habe ich in diesem schlafwachen Zustand zustande gebracht, oft erstaunlich schnell. Nur leider nie ohne Stunden, Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre des Scheiterns davor.
Am wenigsten schlimm lief es immer, wenn ich viel schrieb. Oder auch tat. Der eine Artikel gab Schwung für den nächsten.
Doch auch dann kamen gelegentlich Zeiten, in denen fast nichts passierte. Und ich schlaff und unrasiert im Büro sass, ein Journalist ohne Klarheit, ein Mann ohne Ehre, ein Stück Körper ohne Zukunft.
Das Vernünftigste, was ich dann für mein Blatt tun konnte, war, nichts zu schreiben, wenn ich nichts zu sagen hatte. Es macht keinen Sinn, Texte zu liefern, nur damit man Texte geliefert hat.
Lange hielt ich mich für völlig unprofessionell. Bis mir aufging, dass meine Produktionsweise zwar für alle eine Strafe war. Aber in der Wirkung effizient. Jedenfalls, was das Produkt angeht. Die Erkenntnis verdanke ich Dr. Blocher und einem Drogensüchtigen.
Der Süchtige meldete sich Anfang der Neunzigerjahre in der WOZ und behauptete, er sei Blochers Dealer – dieser brauche beträchtliche Mengen Kokain. Er stiess nicht auf taube Ohren. Ein Team der härtesten Rechercheure machten sich hinter die Story. Einer von ihnen überprüfte über Monate Blochers An- und Abwesenheiten. Und kam darauf, dass Blocher regelmässig für Tage oder Wochen spurlos abtauchte. Niemand konnte sagen, wo er war. Waren es die Erschöpfungstiefs eines Abhängigen?
Die Recherche endete mit einer Erkenntnis: Der Informant hatte uns belogen. Entweder war er ein Hochstapler. Oder das Kokain hatte ihn paranoid gemacht.
Aber mir fiel dadurch auf, dass Blocher, bevor er Bundesrat wurde, weiter oft für Wochen spurlos aus der Öffentlichkeit verschwand. Niemand konnte genau sagen, wohin: in die Konzernzentrale, nach China, in eine Depression? Doch das spielte keine Rolle, weil niemand seine Abwesenheit bemerkte. Denn nach jeder Pause kam er mit einer politischen Bombe aus der Deckung: mit irgendeiner Forderung, Drohung, Klarstellung, manchmal auch nur mit einer Grobheit. Und prompt war im Bundeshaus wie den Redaktionen der Teufel los: ein Wirbel aus Schlagzeilen, Polemiken, Analysen. Und endlosen Blocher-Interviews, alle nach dem gleichen Muster: empörte Fragen, reuelose Antworten.
Das Interessante war, dass Blocher es mit den gezielten Bomben schaffte, den Eindruck von Daueraktivität zu erreichen. Kein Nationalrat schwänzte im Parlament so oft wie er, kein anderer war so präsent.
Er liess keinen Weg frei, ihn zu ignorieren. Sodass ich mich entschloss, dass ich, wenn ich Dr. Blocher schon als Dauergast in meinem Leben hatte, auch etwas von ihm lernen konnte.
Als Journalist lernte ich das: Wer Treffer landen will, muss seine Kämpfe wählen. Und im Zweifel ist weniger mehr. Denn nur deine Coups bleiben im Gedächtnis. Und nichts wird so einfach übersehen wie das, was immer da ist.
Die Hauptbeschäftigung des Raubtiers
Doch was mich an Lenins Satz «Zeiten zu warten, Zeiten zu kämpfen» weit mehr faszinierte: Es ist ein Rezept für Verträumte.
Denkt man genauer über das Zitat nach, fällt einem auf: Das eine bedingt das andere. Warten ohne Kämpfen ist so sinnlos wie Kämpfen ohne Warten.
Auf den ersten Blick ist Sehnsucht eine sehr passive Strategie. Man drückt sich wie früher ein Waisenkind die Nase an der Scheibe der Bäckerei platt – in meinem Fall oft sieben Jahre. Und wartet, dass sich eine Tür öffnet.
Doch sobald die Tür aufgeht, wäre es eine schwere Sünde, drinnen einfach zivilisiert ein Stück Kuchen zu essen. Das einzige vernünftige Ziel ist, die ganze Bäckerei zu übernehmen.
Denn immerhin hat man sieben Jahre den Betrieb beobachtet: Man kennt die Arbeit der Bäcker, die Frauen an der Theke, die Laufkundschaft und die Stammgäste, den Geruch und den Preis des Brots, den Stand in der Ladenkasse und jede verdammte Erdbeere auf jeder verdammten Torte.
Denn nichts verleiht schärfere Augen als der Hunger. Steht man lang genug, egal wo, vor dem Fenster, sieht man die Schwächen, die Stärken und vor allem die Lücken in jedem Betrieb. Und entwickelt beim Herumträumen einen Plan, wie es ganz anders laufen könnte.
Man hält Menschen, die träumen, oft für harmlos. Ich halte das für einen Fehler. Ich nehme verträumte Leute ernster als nüchterne. Teils aus Neugier. Aber auch, weil mir mein Instinkt zu Vorsicht rät. Mit gutem Grund: In der Tierwelt ist Schlafen und Dösen die Hauptbeschäftigung grösserer Raubtiere.
Denn wer tagsüber träumt, gibt der Realität und ihren Gesetzen weniger Macht über sich. Und driftet mit jeder weiteren Wolke auf eine Entscheidung zu. Je breiter die Kluft zwischen Alltag und Vorstellung wird, desto wahrscheinlicher wird, dass etwas Plötzliches passiert: Die träumende Person kracht durch alle Böden. Oder gibt auf. Oder sie setzt ihren Traum in die Realität um.
Der amerikanische Schriftsteller Richard Brautigan schrieb einmal: «Wir sind das, was wir uns vorstellen. Deshalb sollten wir sehr vorsichtig mit dem sein, was wir uns vorstellen.»
Er hat leider recht. Niemand träumt ohne Konsequenzen.
Denn Sehnsucht ist kein stabiler Zustand, sondern eine lange Suche. Sie kann Jahre, sogar Jahrzehnte dauern. Aber sie sucht unermüdlich weiter: nach einem Riss im System. Nach einem Anlass. Nach der Gelegenheit, endlich Wirklichkeit zu werden. Und manchmal braucht sie, wenn sie stark genug geworden ist, nicht einmal das.
Dann verlässt jemand aus heiterem Himmel den Ehepartner, wechselt den Beruf, die Meinung, das Land oder das Lager, gründet eine Firma oder schliesst sie, begeht ein Attentat, geht ins Kloster, riskiert sein Vermögen, zeugt ein Kind, kurz: macht etwas Neues.
Oder völlig Neues.
Die Erfindung der SVP
Wenn ich darüber nachdenke, wie man seriös träumt, ist das brauchbarste Vorbild, das ich kenne, die Zürcher SVP.
Okay: Ich bin – wie fast alle, die nicht SVP wählen – der Meinung, dass man auf ihren Aufstieg auch hätte verzichten können: Es hätte dem Land viel Lärm, Zeit und Nerven erspart.
Und zugegeben: Heute steht nur noch eine gut gepolsterte Ruine. Verglichen mit der früheren Explosivität gleicht die aktuelle SVP einem abgebrannten Knallfrosch.
Aber darum geht es hier nicht. Sondern darum, dass die raketenschnelle Verwandlung der SVP von einer gemütlichen Bauernpartei zur grössten, unangenehmsten und prägendsten Kraft des Landes einem Wunder gleicht. Aber kein Wunder ist. Sondern eine der grössten Managementleistungen der Schweizer Geschichte.
Als Christoph Blocher 1977 die einstige «Zürcher Bauernpartei» übernahm, dümpelte die SVP in Zürich wie national bei rund 10 Prozent. Sie war die Partei rotwangiger Männer und Frauen: die Heimat der Gewerbler, der Bauern und der Berner.
Im nationalen Parlament und den grossen Kantonen regierte seit 129 Jahren die FDP. Ohne Freisinn liefen in der Schweiz nicht einmal die Ratten in den Lagerschuppen. Wer Geld, Position, zumindest Ehrgeiz hatte, war hier an der perfekten Adresse.
Die SVP hingegen war seit ihrer Gründung der harmlose, ländliche Juniorpartner. Sie zog die Leute an, die es in der Politik auch gemütlich haben wollten.
Und eigentlich waren alle damit zufrieden. Nur Christoph Blocher nicht. Kein Wunder, wurde er nur sehr knapp als Zürcher Parteichef gewählt.
Blocher versammelte alle SVP-Mitglieder, die wie er dachten. Es waren kaum mehr als ein Dutzend. Er teilte ihnen mit, dass ab sofort ein neuer Wind wehte. Und man an die Säcke müsse.
Das war kein leeres Versprechen. Die Kadersitzungen fanden nun oft um 6 Uhr morgens statt. Sie waren unbezahlt – die Entschädigungen für Kader waren das Erste, was der neue Kantonschef strich. Und Lob für gute Arbeit gab es auch nicht. Denn man tat damit nichts als seine Pflicht.
In den Sitzungen wurde vor allem gekürzt – und gespart. Bis man das Parteiprogramm auf ein Skelett herabgekürzt hatte, in dem jeder Punkt in drei Sätzen so sagbar war, dass auch der Dümmste von allen es verstand.
In der Freizeit wurde verlangt, dass man den Kanton zuplakatierte. Am Wochenende Veranstaltungen besuchte. Dass man immer neue, möglichst gleiche Artikel in der Parteizeitung schrieb, die neu wöchentlich erschien.
Zwar besetzten Blochers Offiziere im Kanton Zürich nach und nach alle wichtigen Parteiposten. Aber das wars auch schon mit Veränderung. Über zehn Jahre waren Blochers Kaderleute fast die Einzigen, die den neuen, harten Wind spürten.
Denn das Projekt war umwerfend erfolglos. Die Sowjetunion brach zusammen. Der Freisinn demolierte sich beim Kopp-Skandal. Und die Zürcher SVP dümpelte weiterhin nur bei knapp über 10 Prozent.
Dann kam die EWR-Abstimmung. Alle Wirtschaftsbosse, alle Zeitungen, alle Parteien waren dafür – auch die Mehrheit der SVP. Als das Referendum kam, entschied sich Blocher nach kurzem Zögern, für das Nein anzutreten.
Der Freisinn, die Wirtschaft, die nationale Spitze der SVP waren entsetzt. Aber sie hatten Blochers kleiner, in 15 kargen Jahren in der Wüste trainierten Truppe wenig entgegenzusetzen. Die Flugblätter, die Reden, die Parolen, die Buurezmorge, der ganze Ton war aus einem Guss.
Blocher und seine Handvoll Männer siegten in der Jahrhundertabstimmung mit 50,3 Prozent – auch dank den Linksgrünen, die «ein starkes linksgrünes Nein» propagierten. Was aber niemanden je interessierte.
Über Nacht war damit aus der dümpelnden Zürcher SVP die gefürchtete, verehrte und gehasste Partei der Mehrheit geworden – die einzigen legitimen Vertreter des Schweizer Volks.
Der Rest erledigte sich fast von selbst: Mit dem Messerstecher-Plakat schuf die Zürcher SVP einen eigenen, unverwechselbaren, brutalen Stil. Und führte eine in den 15 einsamen Jahren zurechtgeschliffene, neue Sprache in die Schweizer Politik ein: «Linke und Nette», «Weichsinnige», «Schmarotzer», «Scheininvalide», «Sozialschlaffer», «Gutmenschen», «Heimatmüde».
In mehreren Wellen wurde die SVP Schweiz übernommen. Die staatstragenden Berner, bisher das Zentrum der Partei, wurden mit einem Trommelfeuer aus Spott eingedeckt, von umknickenden Sektionen eingekreist und schliesslich unterworfen. Der neue nationale Parteichef, der Zürcher Ueli Maurer, gründete Hunderte neue Sektionen. Dann expandierte man in die Romandie.
Nach einem überwältigenden Wahlsieg der SVP mit über 26 Prozent fiel 2003 nach hartem Druck die Zauberformel. Die CVP-Politikerin Ruth Metzler wurde als erste Bundesrätin seit über 100 Jahren abgewählt. Ihr Ersatz hiess: Christoph Blocher, SVP.
Was Verträumte von der SVP lernen können
Nur damit es keine Missverständnisse gibt: Ich will Ihnen hier keinesfalls empfehlen, wie Herr Blocher eine protestantische Politsekte zu gründen. Am wenigsten mir selbst. Die Gründung der Republik zwecks Rettung der Demokratie war schlimm genug.
Was ich an Blochers Strategie zur Neuerfindung der SVP sehr einleuchtend finde, ist Folgendes:
Er fing sofort an, zu tun, was er tun wollte. Obwohl die Chancen, die Zahl der Mitstreiter und die allgemeine Begeisterung absurd klein waren. Er wartete nicht auf günstigen Wind. Und brauchte ihn auch nicht. Weil er von Anfang an im Winzigen machte, was er als Fernziel im Grossen wollte. Anführer der Rettung der Schweiz zu sein.
Dass seine SVP nicht einfach kopierte, sondern neu erfand: einen Stil, eine Sprache, eine Organisation, eine Zeitung, eine neue Art Parteiprogramm. (So lesbar wie ein Kinderbuch, so konzentriert wie ein Suppenwürfel, so giftig wie die Galle eines Fugu-Fischs.) Als Aussenseiter hat man keine Chance, wenn man den etablierten Stil nur variiert, selbst wenn man ihn verbessert. Man muss eine völlig neue Kategorie von Produkt entwickeln – mindestens etwas Unverwechselbares, um eine Chance zu haben.
Die Entwicklung einer eigenen Sprache – die gleichzeitig sofort verständlich und sofort wiedererkennbar ist – das haben nicht viele Unternehmen geschafft. Oder Parteien. Oder Schriftsteller.
Den Mut, gehasst und verachtet zu werden. Wer geliebt, gewählt oder verehrt werden will, muss ihn haben.
Die Entdeckung, dass Negativpropaganda, sobald man polarisiert, in der Politik Propaganda ist. Weil sich die eigenen Leute freuen, wenn die Gegenseite schockiert wird. (Ok, eigentlich uncool.)
Meiner Meinung nach hat Blochers Zürcher SVP auch einen ganz neuen Kundenservice für ihre Politikkundschaft entwickelt. Die bisherigen Parteien boten im Wesentlichen als Nebenprodukt zur Politik: Karriere und Geselligkeit. Blocher bot neu auch für Kaderleute den Marsch durch die Wüste an. Für das Laufpublikum lieferte die SVP als Neuerung die ersten Plakate, die als Gesprächsstoff tauglich waren. Und eine sensationelle Härte, pervers umrahmt mit Heimeligkeit – für Kunden, die auf ihren Zynismus stolz sind, weil sie ihn mit Illusionslosigkeit verwechseln. (Seit dem Internet weiss man: Es sind deprimierend viele.) Für Leute, die nicht viel von Politik wissen oder halten: endlich ein lesbares Programm. Für alle verunsicherten Herren: Mit der Wahl der neuen SVP löst man automatisch das Ticket für einen identitätssteigernden Wir-gegen-sie-Krieg. Für die traditionell die SVP ausmachenden Harmlosen: Man hielt die Bisherigen vor allem am Anfang durch eine Gemütlichkeits-Kaskade von Buurezmorge, Handörgelikonzerten und Parteigrillfesten.
Blochers Dutzend nutzte die lange Erfolglosigkeit als Entwicklungszeit für ihr Produkt: Die neue SVP war so aus einem Guss, dass sie oberflächlich betrachtet aussah, als wäre sie mit der Kettensäge gezimmert worden. Von nah hingegen sieht man die Durchdachtheit der Details.
Wie gut Blocher und seine Kadertruppe in den 15 erfolglosen Jahren gearbeitet hatten, merkte man weniger durch den als nach dem Erfolg: Das Modell einer beinahe leninistischen Kaderpartei, der Drei-Satz-Parolen zu jedem Thema, der Stil der Plakate liess sich unfassbar problemlos sowohl in neuen SVP-Sektionen als auch in solchen mit Tradition installieren. Eine Zeit lang sagten sämtliche SVP-Politiker – jung, alt, naiv, erfahren – bei praktisch allen Themen das Gleiche im gleichen Wortlaut – wie eine Roboterarmee.
Erfolg kann jeder Wahnsinnige haben, aber ihn kaltblütig zu nutzen, schaffen fast nur die, die sich lange darauf vorbereitet haben. Ganz offensichtlich nahmen 15 Jahre Erfolglosigkeit der Versagertruppe nicht die Überzeugung, dass er eines Tages kommen würde.
Disclaimer I für Empörte: Nein, ich bin nicht für den smarten Aufbau rechtsnationaler Bewegungen. Ich finde es auch nicht sympathisch, schon gar nicht für eine offiziell freiheitsliebende Partei, aus Schweizer Bürgern ein Heer aus SVP-Robotern zu züchten. Ich schätze weder die Politik noch den Stil der SVP.
Disclaimer II für immer noch Empörte: Aber ich schätze gutes Handwerk. Was mir an der Strategie der Zücher SVP zusammengefasst auch für ganz andere Köpfe, Träume und Pläne brauchbar scheint:
Sie fingen sofort an. Obwohl alles dagegensprach.
Sie verfolgten ein grosses Ziel: ein Land zu verändern.
Sie machten sich daran, die eigene Branche neu zu erfinden.
Sie hatten nicht nur eine kühne Strategie (totale Konfrontation war nicht das, was in der kooperativen Schweiz Erfolg versprach). Und sie scheuten sich auch nicht vor der Kletzelarbeit, diese Strategie bis in feinste Details hinunterzubrechen.
Sie sahen sich ihre Leute noch einmal sehr genau an. Und lieferten ihnen nicht das, was sie wünschten, sondern das, was sie tatsächlich wollten: den einen Buurezmorge, den anderen Kriegsteilnahme.
Als sich mit dem EWR eine Tür auftat, setzten Blocher & Co. nach kurzem Zögern alles auf eine Karte.
Sie hatten einen Plan für den Erfolgsfall. (Was wichtiger ist als ein Worst-Case-Szenario.)
Disclaimer III für noch nicht Verwirrte: Blocher und seine Vasallen irren sich übrigens, wenn sie sich als knallharte, realistische Typen sehen. Und falls Sie ihnen glauben, irren Sie mit. Der Grund ist die Illusion, dass Kitsch immer rosa und Härte das Ding für Realisten ist. Es gibt einen Kitsch der Härte, der alles so stereotyp malt wie der verlogenste Weichzeichner, nur dass eben alles in Schwarz gemalt wird statt in Pastell. (Es gibt auch den Kitsch des Pessimismus, des Gefühls, der Nüchternheit – tausend Varianten.) Sieht man genau hin, waren Blocher und seine Leute in den ersten Jahren eine Pfadfindertruppe von Träumern. Zwar mit finsteren Träumen. Aber eindeutig Leute, denen Frau Martullo Blocher gesagt hätte: «You dreamer, du!» (Falls sie damals nicht acht Jahre alt gewesen wäre.)
Disclaimer IV für immer noch nicht Verwirrte: In der nächsten Folge folgt der inoffizielle Teil V zum völlig aus dem Ruder gelaufenen Kurzessay über die Strategie der Sehnsucht. Aller Voraussicht nach wird es noch schlimmer. Sie erhalten den Beweis, dass Blocher als junger Student ganz offensichlich ebenfalls mit der Nase an einer Bäckereischeibe klebte: und zwar 1968. Und sich schwor, auch einmal so cool zu sein wie die verfluchten Kommunisten. Ausserdem erfahren Sie nach einem überraschenden Schnitt alles über die Nacht meines Lebens. Und nach einer Rückblende um 2500 Jahre folgt natürlich Plato.
Ich bin mir sicher, Sie freuen sich darauf so wie ich.
Illustration: Alex Solman