
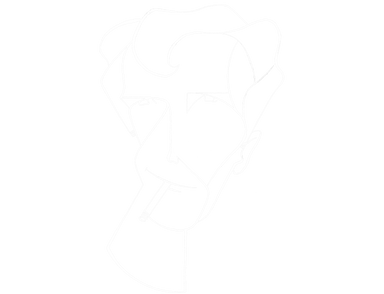
Der, der du niemals sein wirst
Hyyyyyyyyperfokus!
Die ADHS-Kolumne, Folge 2 – wie überlebt man in einer Welt, in der man weniger Klarheit im Kopf hat als die Konkurrenz? Am besten in einer Art Trance. Aber Vorsicht, das birgt Gefahren.
Von Constantin Seibt, 20.02.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
«Mr. Sulu, volle Kraft voraus!»
James T. Kirk, Captain USS Enterprise
Drei Tage vor der mündlichen Matur ging ich den Gang hinunter, als drei mit mir verfeindete Lehrer entgegenkamen. Kaum sahen sie mich, begannen ihre Gesichter zu leuchten. Und danach die Zähne in ihren Gesichtern.
«Na, Seibt», sagte der schnurrbärtige Chemielehrer. «Es scheint, als hätten wir nächstes Jahr noch einmal das Vergnügen, Sie zu sehen.»
Mir wurde auf einen Schlag schlecht.
Ein halbes Jahr zuvor hatten uns mehrere Lehrer den gleichen Vortrag gehalten – was für eine ernste Sache die Maturprüfungen wären. Und dass wir ab sofort richtig an die Säcke müssten. Schon deshalb, weil die Schule eine Rangliste machte. Und keine Klasse sich die Schande leisten konnte, mit dem schlechtesten Notenschnitt abzutreten.
Es war keine schwere Sache, zu merken, dass das vor allem das Problem meiner Lehrer war. Und dass diese deshalb jeden Anreiz hatten, uns ab sofort die bestmöglichen Noten zu geben.
Darauf stellte ich das Lernen komplett ein.
Sobald ich damit aufhörte, passierte Seltsames: Die Schule verblasste wie eine vergilbte Fotografie. Der ewig schwankende Aktienkurs der Noten, der mich seit der Primarschule in Atem gehalten hatte, hörte auf zu zählen. Auch meine Mitschüler wurden mir auf freundliche Weise egal. Meine Lehrer schrumpften dramatisch: Sie verloren die Qualität von Giganten oder Monstern, der Kampf gegen sie versandete. Ich fühlte keine Notwendigkeit mehr, ihnen etwas beizubringen. Etwas Neues lag in der Luft, und die Welt meiner Kindheit ging unter.
Doch plötzlich war sie wieder da.
Warum hatte ich nicht wenigstens ein wenig gelernt? Warum einfach gar nichts mehr?
In einem Blitz aus Eis fiel mir der Italienisch-Aufsatz an der schriftlichen Matur ein. Sein Thema war «La lingua tedesca» (die deutsche Sprache).
Ich hatte den perfekten Einfall für die lahme Thematik gehabt: Ich schrieb den gesamten Text mit italienischen Vokabeln, aber in deutscher Grammatik. Während ich schrieb, war ich zunehmend fasziniert: Italienisch in deutschen Schachtelsätzen hatte wirklich einen reizvollen Klang. So als würde Kant unter der Dusche singen.
Jetzt wurde mir klar, dass dies eine selbstmörderische Idee gewesen war. Und um der Blödheit die Krone aufzusetzen, hatte ich meinen Einfall gar nicht einmal hingeschrieben – weil ich der Überzeugung war, dass man eine Pointe ruiniert, wenn man sie erklärt.
Ich war ein Idiot, Idiot, Idiot – wenn ich an der mündlichen Matur die Sache nicht rumreissen könnte, würde ich ein weiteres Jahr hier im Grab verbringen.
Mein Problem war: Ich hatte nur noch exakt 72 Stunden. Was konnte ich in der Zeit tun?
Die erste Entscheidung war einfach: Es würde sich lohnen, einen Tag in Mathematik zu investieren. Denn durch einen gnädigen Zufall konnte ich nach ein paar Stunden Vorbereitung in den Mathematikprüfungen plötzlich die Lösungen sehen. Was irritierend war, weil ich Mathematik gar nicht verstand. Ich sah es in einer Art Trance. Wach, aber unvorbereitet hatte ich keinen Schimmer. Es lohnte sich also, die Bücher anzusehen.
Aber sonst? Für die weiteren fünf Fächer hatte ich keine Chance, in zwei Tagen den Stoff von fünf Jahren nachzuholen.
Ich beschloss, es gar nicht zu versuchen. Stattdessen durchwühlte ich den Kleiderschrank meines Vaters und las drei Bücher über Herrenbekleidung. Am Tag der mündlichen Matur erschien ich in Anzug und Krawatte, komplett mit Seitenscheitel, veilchenblauem Einstecktuch und Manschettenknöpfen.
Ich war davor – schüchtern, aber trotzdem – ein Punk. Und sah nun aus, als hätte ich meine Kleider zufällig aus dem Wäschesack gezogen. Durch den Anzug war also bei allen fünf Prüfungen die erste Frage klar: «Wie siehst du denn aus?»
Die Antwort darauf hatte ich vor dem Spiegel geprobt. Sie dauerte ziemlich genau 7 Minuten 30 Sekunden.
Ich begann mit der Bemerkung über die Wichtigkeit der Matur als Schwelle zum ernsten Leben, betonte die Notwendigkeit, der Würde des Anlasses gemäss gekleidet zu sein, beschrieb das Dilemma, welcher Anzug am besten zu welcher Krawatte passte, gab einen Abriss von meiner Familie anlässlich der Manschettenknöpfe (weil ein Erbstück) und referierte die Geschichte der Herrenbekleidung von Beau Brummell bis zum Mann mit dem Hathaway-Hemd.
Meine Kalkulation ging weitgehend auf. Erstens hatte ich mit dem
Siebeneinhalb-Minuten-Monolog bereits die Hälfte der eng getakteten fünfzehn Minuten Prüfungszeit gefüllt – ohne ein Wort zum Thema oder in Fremdsprache äussern zu müssen. Zweitens waren die zwei, drei aggressiveren Lehrer danach viel zu abgelenkt, um hart nachzuhaken. Drittens hatte meine Rede tatsächlich Substanz – und meine Vermutung war richtig, dass selbst ein Winterthurer Lehrer lieber etwas interessantes Neues hören würde als den Stoff, den er schon bis zur Bewusstlosigkeit kannte.
Das einzige Problem, das ich nicht vorhergesehen hatte, war die Expertin. Sie war eine in schwarze Seide gekleidete ältere Dame. Beim ersten Mal hörte sie hingerissen zu, beim zweiten Mal irritiert und ab dem dritten Mal offen empört. Sodass ich bei der vierten und fünften Prüfung aus Nervosität anfing, schneller zu sprechen. Und mich verhaspelte.
Aber der Keks war gegessen. Ich bestand die Matur mit zwei Punkten über dem Minimum, als wahrscheinlich einziger Schüler in der Geschichte der Kantonsschule Winterthur durch seine ausgezeichneten Kenntnisse in Sachen Herrenbekleidung.
Und ich finde, ich bestand zu Recht. Ich war offensichtlich reif für das Berufsleben. (Im Prinzip tue ich bis heute nichts anderes.)
Doch das wirklich Schöne waren die drei Tage davor. Zwar überspülte mich nach der Begegnung mit den grinsenden Lehrern eine heisse Welle aus Schock und Scham. Aber bereits am Ende des Korridors, als ich um die Ecke bog, verschwand alle Panik. Wie durch ein Wunder beruhigten sich Herz und Kopf – und ich begann, strategisch zu denken. Es fühlte sich an, als würde man an einem staubigen Sommertag in den Schatten eines Cafés treten mit der Absicht, an der Bar ein Glas Eiswasser zu trinken.
In den drei Tagen vor der mündlichen Matur fühlte ich nichts in mir als Klarheit: Ich wusste, ich steckte tief im Sumpf, aber das war egal. Ich las mit der Ruhe eines verbrecherischen Buddhas die Bücher zu Mathematik und Herrenmode. Ich spürte weder Hunger noch Reue noch Zweifel, nur Entschlossenheit.
Exakt das ist die einzige Waffe, die man mit ADHS zur Verfügung hat: den Hyperfokus. Den Moment, wo man sich aus Begeisterung oder Panik voll auf eine Sache konzentriert: ohne Ablenkung, ohne Skrupel, ohne Rücksicht auf Verluste.
Mega, Giga, Hyper!
Manchmal ist die Forschung verblüffend frei von Neugier. ADHS ist die meistverbreitete chronische neurologische Störung bei Jugendlichen. Und die am besten erforschte – es gibt Tausende von Untersuchungen.
Allerdings handeln fast alle Studien nur von Defiziten. Vielleicht, weil die Auswahl so zahlreich ist. Vielleicht, weil sich Pharmafirmen – verständlicherweise – mehr für Patienten interessieren als für Phänomene. Vielleicht wegen des D im ADHS.
Jedenfalls gibt es kaum Studien zum spektakulärsten Asset der Störung: zum Hyperfokus. Was so ist, als würde man hundert Biografien über Clark Kent schreiben, ohne Superman zu erwähnen. Die Forschungsliteratur ist sich nicht einmal einig, ob ein Hyperfokus überhaupt existiert. Und wenn ja, ob er eine Gabe oder eine weitere Geissel ist.
Existiert er, funktioniert die Biologie dahinter vermutlich so:
Theorie 1: Bei Begeisterung oder Panik flutet Dopamin die exekutiven Funktionen im Gehirn. Und plötzlich läuft die Schaltzentrale ohne jede Sabotage – wenn auch mit 180.
Theorie 2: Der Hyperfokus nutzt einen Nachteil als Vorteil: Bei Personen mit ADHS laufen alle Übergänge verdammt zäh – etwa das Umschalten von Tätigkeit A zu Tätigkeit B. Besonders wenn B nichts weit Erfreulicheres verspricht als A. Das heisst: Findet man eine Tätigkeit X, die interessanter ist als alle anderen, bleibt es einfach bei X.
Existiert der Hyperfokus nicht, fühlt sich immerhin seine Illusion so an, als würde er existieren. Es ist, als würde man aufwachen. Der allgegenwärtige Nebel verzieht sich, man sieht die Welt mit der Schärfe eines Chirurgen unter der Operationslampe. Und tut, was zu tun ist.
Dabei spielt Zeit keine Rolle. Man arbeitet, ohne es gross zu merken, einen Tag und eine Nacht ohne Essen oder Schlaf durch. Bei wirklich abenteuerlichen, wirklich grossen Plänen vergisst man, dass man vergesslich ist. Und hält teils über Monate seinen Kurs.
Der Hyperfokus ist ein grossartiger Trip – aber nicht ganz ungefährlich. Das Problem ist, dass er sich nicht durch Willen ein- oder ausschalten lässt. Er springt nur bei unmittelbarem Interesse oder unmittelbarer Angst an. Auslöser sind leider nie rein vernünftige Interessen oder Ängste. Sondern: Neuheiten, Sex, Sehnsucht, Drogen, Drohungen, eigene und fremde Notlagen sowie fesselnde Probleme.
Kein Wunder, gibt es Unfälle. Etwa, wenn sich der Hyperfokus auf ein Internetspiel oder ein dickes Buch richtet – wenn du dann nur die Nacht durchmachst, hast du Glück gehabt. Katastrophaler ist die Kollision mit sonstigen Plänen. Wie etwa kann man begründen, dass man bei einem Date zwei Stunden zu spät kommt, weil man auf dem Computer Patience gespielt hat?
Die Sache mit der Matur zeigt die Gefahren: Sobald ich nicht mehr an die Währung der Noten glaubte, zerfielen zwölf Jahre Lerndisziplin wie ein Vampir an der Sonne. Wohingegen die Selbstmordidee, die Italienisch-Matur in deutscher Grammatik zu schreiben, mich so hinriss, dass mir erst zwei Wochen später klar wurde, dass sie eine Selbstmordidee war.
Wirklich übel wird die Sache, wenn der Hyperfokus sich auf finstere Ziele richtet. Etwa auf den Beweis der eigenen Minderwertigkeit, den Beweis der Minderwertigkeit anderer Leute, den Beweis, dass man von irgendwem betrogen wird. Dann gnade allen Gott.
Das härteste Problem beim Hyperfokus ist, dass nicht die Unfälle den giftigsten Ärger machen, sondern die gelungenen Streiche. Es sind Ihre Erfolge, die Sie in das schäbigste Licht rücken. Denn jede gelungene Arbeit weckt den Jagdinstinkt Ihrer Umgebung – von Pädagogen, Chefinnen, Kollegen. Denn alles, was Ihnen gelingt, beweist, dass Sie es ja können, wenn Sie nur wollen. Und dass Sie, wenn Sie weit einfachere Aufgaben verschlampen, das nicht aus Unfähigkeit tun. Sondern aus Faulheit, aus Arroganz oder aus Herzlosigkeit.
In der Tat bleibt die Differenz einem selbst lebenslänglich ein Rätsel. Wie kann man begründen, dass man es zwar schafft, eine Serie von Artikeln über das internationale Steuerrecht zu schreiben – aber die eigene Steuererklärung schon wieder nicht auszufüllen? Auch wenn man geschworen hat, es zu tun? Weil es Ihre Familie letztes Jahr 10’000 Franken gekostet hat?
Einverstanden. Denken wir lieber nicht mehr darüber nach.
Die Gnade – und ihre Voraussetzung: die Sünde
Georges Simenon verfasste 1200 Groschenromane, um sein Handwerk zu lernen. Danach knapp 300 richtige Romane. Er schrieb sämtliche Bücher in wenigen Tagen – die Groschenromane in 25 Stunden, die echten Romane in 11 Tagen. Er schrieb fast ohne Korrektur, in einer Art hellwacher Trance. Ein Zustand, den er später einmal den «Stand der Gnade» nannte.
Will man mit ADHS etwas erreichen, lohnt es sich, zu wissen, wie man am effizientesten in den Stand der Gnade kommt. Simenon benötigte dafür eine Schreibmaschine mit fabrikneuem Farbband, eine kleine Armee von Tabakpfeifen, absolute Ruhe und pro Roman ein Hemd.
Er war offensichtlich ein guter Mensch.
Ich nicht. Denn mein sicherster Weg, in den Zustand der Gnade zu kommen, ist das Erschiessungskommando.
Schon in der Schule war ich in der Prüfung besser als beim Abfragen. Und beim Tennis im Match ein völlig anderer Spieler als beim Training.
Kein Wunder, wurde ich der Schrecken zahlloser Abschlussredaktionen. Schon, weil ich mit tierhaftem Instinkt zwischen offizieller und tatsächlicher Deadline unterscheiden konnte – der Unterschied war, dass der offizielle Termin mit Nervosität und Misstrauen angekündigt wurde, der inoffizielle dagegen mit schriller Panik, mit einem Unterton von ernsthaftem Hass.
Ersteres liess mich kalt, Letzteres liess mich arbeiten.
Über Jahre schrieb ich die meisten langen Texte knapp an einer Tätlichkeit vorbei. Ich versuchte zwar so gut wie immer, mindestens 24 Stunden vorher anzufangen. Aber meistens schrieb ich dann nur Gestammel. Stattdessen versank ich immer tiefer in neuen Akten und Notizen – eine Invasion von Stimmen, Stimmungen und Fakten, die in meinem Kopf Spiralen drehten, während ich zwei Dutzend Mal einen neuen ersten Absatz schrieb.
Irgendwann gegen Morgen kam der Anruf: «WIR BRAUCHEN DEINE SEITE! JETZT! WO IST SIE?» Und ich sagte: «Ich bin fast fertig. Gib mir noch 30 Minuten.» Worauf das Gegenüber gequält durch die Erfüllung aller Befürchtungen in den Hörer schrie: «KEINE MINUTE LÄNGER!»
Ich legte dann auf und dachte, dass ich es diesmal wirklich nicht schaffen würde. Oft standen auf dem Bildschirm gerade vier Zeilen Text. Von einer kompletten Zeitungsseite. Mir fiel ein, was der Rest der Redaktion tun würde, wenn diese Woche eine gesamte Seite weiss bleiben würde. Und dann …
… dann plötzlich sass jemand mit viel kälterem Blut in meinem Stuhl. Der Zensor in meinem Kopf, der jeden Satz für dumm, überflüssig oder unehrlich erklärt hatte, verzog sich ohne Protest – es ging nun nicht mehr um Perfektion, sondern ums Überleben. Es gab keine andere Rettung, als Satz für Satz vorwärtszuschreiben. Der Text fühlte sich nach einer Weile an wie ein Stück Klaviermusik. Ich hörte, was wohin gehört. Fast alle längeren Texte schrieb ich in einem Schwung, zwar viel zu spät, aber in kurzer Zeit. Und die wirklich wirklich gelungenen Texte schrieb ich meist derart übernächtigt, dass die Autorenzeile fast schon Betrug war. Denn ihr gemeinsames Merkmal war, dass sie mich später beim Durchlesen überraschten. Und ich dann dachte: Aha, das denke ich also!
Danach schrie mich der Abschluss zuweilen an, aber er schrie einen glücklichen, grausamen Mann an. Ich senkte meinen Kopf in Demut, aber es war die Demut eines Mönches, der einem Tobenden verzeiht.
Damals ignorierte ich es, heute verstehe ich, dass die Verzweiflung einiger Abschlussredaktorinnen wirklich echt war. Und ihr Hass auch. Kein Wunder, wenn man Woche für Woche als Erschiessungskommando zwangsverpflichtet wurde, ohne einmal abdrücken zu dürfen. Ich dagegen hatte das Gefühl: Das Ergebnis stimmt, also auch die Methode. Ausserdem hatte ich nach dem Schreiben sofort alles Herumgewinde vergessen. Ich war Profi genug, um zu wissen: Für 4 Stunden ist das wirklich nicht schlecht. Dass ich vorher 48 Stunden gelitten hatte, dass mehrere andere Leute (ohne den Spass am Ende) gelitten hatten, war bedauerlich. Aber etwa so bedeutend wie die Schale, wenn man das Ei gegessen hat.
Meine Ruhe war bei Licht betrachtet weniger die Demut eines Mönchs als die Skrupellosigkeit eines Süchtigen.
Winston Churchill, angeblich auch nicht ganz neurotypisch unterwegs, schrieb einmal: «Eine der fröhlichsten Erfahrungen ist, wenn jemand auf dich schiesst, ohne dass du getroffen wirst.» Kein Wunder, ging Sir Winston in seiner Karriere mehrmals hohe Risiken ein. Denn Hölle, Schwein und Schwefel – es gibt wenig, was so süchtig macht wie das Entkommen in letzter Minute.
Kurz, ich ging nicht ohne Grund zur Psychiaterin. Ein Instinkt sagte mir, dass der Aufbau einer Zeitung ganz andere Qualitäten verlangte als das Schreiben von Artikeln. Und dass meine alten Rezepte für diesen Streich nicht reichen würden. Weil es jetzt nicht mehr um Sprints ging, sondern um einen Marathon.
Ich war zwar in der Zwischenzeit einiges verlässlicher geworden. Kürzere Sachen schrieb ich fast ganz ohne Drama, ich hatte verstanden, dass Pünktlichkeit und Berechenbarkeit nicht einfach die Tugenden von kleinen Leuten sind, die vergessen haben, wie man betet. Ich war seit ein paar Jahren Vater, und die Übernahme von Verantwortung fing an, mich zu faszinieren.
Kurz: Das, was jetzt kommen würde, war eine andere Liga. Ich hatte nicht die geringste Lust, das Projekt oder mein Privatleben durch die üblichen Nachlässigkeiten zu versenken. Es war klar, dass das Projekt für alle Beteiligten ein Fall für einen Draghi-Put war: Wir dürfen das nicht vermasseln – whatever it takes. Für mich gehörten zu dem whatever eben unter anderem eine psychiatrische Diagnose – und etwas später eine tägliche Dosis Psychopharmaka.
Damals, Herbst 2016, hatte das Hauptquartier meines damaligen Arbeitgebers längst alle Farbe verloren. Ich hatte das Gefühl, mich wie ein Geist durch das Verlagsgebäude aus Plexiglas zu bewegen. Wenn ich über die Strategie der Teppichetage nachdachte, spürte ich schon seit langer Zeit keinen Zorn mehr, nur Höflichkeit. Die Welt meiner Jugend ging ein weiteres Mal unter.
Ich kündigte zum letztmöglichen Datum im Oktober. Als ich es getan hatte, trat ich aus der Glastür, war ein paar Sekunden traurig – und vergass dann die zehn Jahre, die ich dort gearbeitet hatte, für immer. Ich ging die Strasse hinunter und wählte die Nummer der Psychiaterin. Ich erreichte ihren Anrufbeantworter und bat um einen ersten Termin.
Etwas Neues lag in der Luft. Es war Zeit, jemand anderer zu werden.
---------------
PS: Falls Sie noch zehn Minuten Zeit finden, klicken Sie auf die im Beitrag bereits erwähnten Links zu Beau Brummell und dem Mann mit dem Hathaway-Hemd. Sie werden es nicht bereuen. Es sind tatsächlich zwei faszinierende Geschichten: Brummell war nicht nur der Erfinder der Herrenmode, sondern auch ihr erster Märtyrer. Und beim Hathaway-Mann lernen Sie, wie man mit Details Geschichten erzählt. Und mit einer 5-Cent-Augenklappe ein Multimillionen-Dollar-Geschäft aufbaut.
Illustration: Alex Solman