
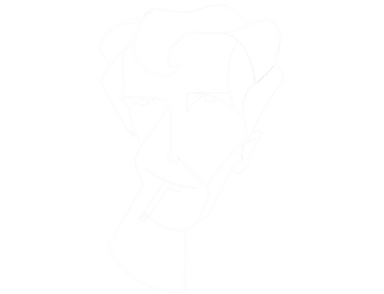
Der, der du niemals sein wirst
Sieben Jahre
Die ADHS-Kolumne, Folge 10 – Ungeschicktheit und Sehnsucht: Wie es gelingt, sein Leben auf die Reihe zu bringen.
Von Constantin Seibt, 16.07.2020
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Wir hatten drei Wochen von früh bis nach Mitternacht gearbeitet. Am letzten Abend stellten wir fest, dass wir noch zu wenig Tote hatten, öffneten eine Flasche Whiskey und schrieben gemeinsam ein neues erstes Kapitel – eine Schiesserei mit mehr Leichen als im Rest des Krimis.
Dann verliessen wir das Haus in den Bergen, drehten die Fenster runter, die Anlage auf und fuhren durch den Sommer, während «Long, Long Summer» von Element of Crime über die satten Felder dröhnte.
Unser Ziel war eine Stadtvilla in Zug, wo Michael eine Affäre mit der Tochter des Hauses hatte. Ihre Eltern waren oft auf Reisen, und Michael erzählte, dass das Elternschlafzimmer im Hausgiebel perfekt eingerichtet war.
Im Lauf des Abends stritten sich die beiden, sodass ich und Elisabetta im Elternschlafzimmer landeten. Wir waren beide blind und nackt wie neugeborene Katzen, als ich kurz doch die Augen öffnete und sah, dass der Vorhang brannte. Es war ein roter Brokatvorhang, schwer wie ein Sack Eisen. Ich riss ihn herunter und lernte, dass es keine gute Idee war, den Vorhang vor eine Lampe zu spannen, um farbiges Licht zu bekommen.
Am nächsten Morgen hatte Michael Geburtstag, und Elisabetta und ich zogen nach dem Frühstück los in die Zuger Innenstadt, wo wir in einer Zoohandlung zwei Meerschweinchen kauften. Das Geschenk begeisterte uns mehr als ihn.
Dann setzten Michael und ich uns in den Garten und schrieben das 30. Kapitel um. Er ging zurück ins Haus, ich las die drei Seiten noch einmal und faltete sie vorsichtig zusammen. Dann schrieb ich das Datum auf die Rückseite. Es war der 8.8.88.
Das perfekte Datum für den perfekten Tag.
Seitdem ist der 8.8.88 für mich ein Fixpunkt in der Zeit. Davor liegt der Winter – dahinter der Sommer.
Seitdem weiss ich, dass ich nie wieder das Recht haben würde, mich zu beklagen. Ich war 22 Jahre alt. Und alle meine Wünsche waren erfüllt worden: Ich hatte eine Freundin, die mit mir schlief. Und ich hatte ein Buch geschrieben.
Zugegeben, es war nur ein Krimi. Und zugegeben: Am Ende der Unschuld wartete schon die Schuld auf mich, geduldig wie alle Schatten: Ich liebte noch eine andere Freundin.
Aber ich wusste seit diesem Tag, dass Erlösung möglich war, in dieser Welt, gegen alle Wahrscheinlichkeit, für jede Kreatur, sogar für mich. Und es gab keinen Weg, das je wieder zu vergessen.
Strategie
Eigentlich sollte es das nicht geben. Sämtliche ADHS-Ratgeber sagen: Wer sich von Natur aus leicht irritieren lässt, hat bei seinen langfristigen Zielen ein ernsthaftes Problem.
Doch um ehrlich zu sein, hatte ich oft den umgekehrten Eindruck: dass meine weit besser organisierte Umgebung Dilettanten sind, was Strategie betrifft. Deshalb, weil sie mit grosser Geschicklichkeit andauernd Ziele erreichen, die sie gar nicht wollen.
Mein Eindruck ist, dass die meisten meiner Bekannten das Pech haben, ein wenig blöd geboren zu werden. Sie hatten nicht das Glück wie ich: umfassend blöd geboren zu werden, ohne jede Ahnung von egal was. Die Vorteile von Klugheit kennt jeder, aber Blödheit wird als Ressource unterschätzt. Wenig ist ein grösseres Geschenk.
Das deshalb, weil das Staunen der stärkere Motor als das Wissen ist und die Sehnsucht einen ungleich weiter bringt als das Können. Denn wenn dir nichts im Leben einfach fällt, wird zumindest das Schwierigste einfach: deine Mission. Es sind die für fast alle selbstverständlichen Dinge, die dir unendlich fern scheinen: ein paar Kollegen finden, eine Liebe, einen Job, echte Verantwortung – kurz: einen Platz in der Welt.
So verwirrend zuweilen mein Alltag ist – die grossen Linien meines Lebens hatten die Einfachheit eines Märchens. Und seltsamerweise auch die gleiche Zeiteinheit: Alles, was mir etwas bedeutete, brauchte fast immer genau sieben Jahre.
Ich musste sieben Jahre warten, bis ich das Rätsel meiner Kindheit gelöst hatte: wie Gruppen funktionieren. Dann dauerte es weitere sieben Jahre, bis mich zum ersten Mal jemand küsste und ich ein Buch schrieb.
Wieder sieben Jahre später hatte ich den ersten Vertrag in dem Job, in dem ich arbeiten wollte – wenn auch nur für eine Kolumne. Und es dauerte wieder sieben Jahre, bis ich die Chance bekam, die Zeitung zu gestalten, in der ich schrieb.
Sieben Jahre scheiterte und träumte ich – und dann öffnete sich eine Tür.
Sicher, das wirkt auf den ersten Blick nicht effizient: Doch der Vorteil der Ahnungslosigkeit ist der, dass man alle Umwege geht, alle Fehler macht, bevor man am Ziel ist: Ist die Tür offen, ist man bereit.
Der zweite Vorteil an einer klaren, fernen Sehnsucht ist, dass man nur einem Stern folgt. Die Nacht kann finster sein, der Morast stinkend, der Held alles andere als ein Held – du weisst, wohin du willst. Folgt man seiner Sehnsucht, kommt es nicht auf deine Fähigkeiten an, auch Ablenkungen zählen nicht, auch nicht Erschöpfung oder Blamagen. Dann verirrt man sich eben. Oder bleibt stecken. Und dann hebt man den Kopf, sieht in den Himmel und macht den nächsten Schritt.
Der dritte Vorteil ist, dass man tausend Enttäuschungen kennenlernt, aber nie die Enttäuschung. Als Kind verirrten wir uns bei Familienwanderungen im Tessin fast jedes Mal. Und meist hatte niemand an Proviant gedacht. Kamen wir dann nach Stunden doch zu irgendeinem Grotto, war der Wurstteller ein Wunder. Die Grossartigkeit des Essens bemisst sich nicht nach dem Koch, sondern nach dem Hunger.
Kurz: Grosse Ungeschicklichkeit ist das Rezept für grosses Glück. Nichts macht Erreichtes so wertvoll wie die Niederlagen und das Warten. Man darf nur nicht den Kurs verlieren.
Deshalb glaube ich, dass die Amateure den Weg kennen, die Profis ihr Herz. Objektiv gesehen habe ich ein vollkommen banales Leben gelebt. Aber nie hätte ich geträumt, so weit zu kommen.
Zeiten des Wartens
Okay, vollkommen fröhlich war das nicht immer. Und elegant eigentlich nie.
In den sieben Jahren, bis mich eine Frau küsste, gab es nur exakt drei Momente für begründete Hoffnung:
In der Probezeit im Gymnasium, als ein blondes, sommersprossiges Hippiemädchen mir vor dem Kopierautomaten sagte, ich hätte den Gang eines Prärieindianers.
Dann vier Jahre später, vor dem Geografiezimmer, als ein Kollege aus der Parallelklasse mich kurz nachdenklich ansah. Und danach sagte: «Ich glaube, du bist ein Typ, der später einmal eine Menge Frauen flachlegen wird.»
(Ich kam damals nicht auf die Idee, ihn zu fragen, woher er als Gleichaltriger verlässliche Informationen über Derartiges haben konnte. Heute glaube ich, er übte für die Zukunft. Denn später wurde er Manager des lokalen Fussballclubs: Sein Beruf wurde die Motivation von hoffnungslosen Fällen. Und das Entdecken von Talenten, wo sie sonst keiner sah.)
Kurz vor der Matur verzog ich mich an einem Vormittag in den Stadtpark Winterthur, um dort in Ruhe ein Handbuch für das Programmieren in Maschinensprache beim Sinclair ZX81 zu lesen. Ich lag lang ausgestreckt auf einer Parkbank, als ein untersetzter Herr in schwarzem Anzug erschien und mich fragte, ob hier noch frei sei. Er sah aus wie direkt aus dem 19. Jahrhundert: Er trug Backenbart, Weste und Uhrkette.
Ich hielt seine Frage für pädagogisch motiviert. Rundherum waren alle Bänke frei. Ich zog schlecht gelaunt meine Beine 30 Zentimeter an. Der Herr setzte sich und schwieg lange. Dann sagte er: «Darf ich dir eine Frage stellen?»
Ich bejahte.
Der Herr sagte: «Liegst du hier zum Vergnügen herum oder als Beruf?»
Ich wurde rot. Und stammelte: «Zum … Vergnügen.»
Der Herr nickte unmerklich und blieb noch eine Weile sitzen. Dann stand er ohne weitere Bemerkung auf und verliess mit schnellen Schritten den Park.
Ich starrte ihm hinterher, wie er den Kiesweg hinunterging. Zugegeben, nichts stimmte. Er hatte den falschen Stil. Und das falsche Alter. Es war auch die falsche Situation. Und nicht zuletzt das falsche Geschlecht. Aber er war unbestreitbar der erste Mensch, der mich als sexuelles Wesen sah.
Und das, stellte ich fest, war trotz allem eindeutig ein Fortschritt.
Als er um die Ecke bog, fühlte ich ihm gegenüber Dankbarkeit: Denn er war ein Bote der Hoffnung.
Zeiten der Lehre
Überhaupt schaffte ich es, ein Objekt der Begierde für die falschesten Leute zu sein. Die Erfreulichsten darunter waren diverse ältere, ruppige Damen. Sie standen meist hinter Theken und fütterten mich mit Gebäck, Süsswaren, Ermahnungen und ihrer Lebensgeschichte.
Weit verderblicher war die Aufmerksamkeit der Pädagogen. Ich zog sie an wie das Licht die Motten. Strenge, sanfte, monologisierende, fragende, unsichere, eiserne, männliche, weibliche, trockene und leidenschaftliche – ich hatte sie alle. Und alle glaubten, mich zu haben. Zumindest fast, bald, beinahe. Man musste nur eine Winzigkeit an mir geraderücken, bis aus mir etwas Vernünftiges werden würde.
Doch das passierte nie. Jeder machte ich Hoffnung. Jedem hörte ich zu. Keiner bekam mich.
Ich hielt mir immer mehrere Pädagoginnen warm. Und spielte die Lehre der einen gegen die Lehre des nächsten aus. Was meine Erziehung betraf, war ich damals wirklich schlimm – ich machte sehr beeindruckte Augen hinter meiner Brille, aber in meinem Herzen war ich koketter als jede Nackttänzerin in einem französischen Roman.
(Die gerechte Strafe dafür erhielt ich später: als ich mich selbst zu erziehen versuchte. Und überzeugt war, dass ich nur eine Winzigkeit geraderücken müsste, um endlich etwas Vernünftiges zu werden. Doch so sehr ich das versuchte: Es passierte nie.)
Am härtesten waren die Jahre, als ich für Mädchen interessant wurde – aber als bester Freund. Wir sassen viele Nächte in irgendwelchen Bars, redeten über das Leben, und gelegentlich sagten sie: «Warum muss man sich immer in Arschlöcher verlieben? Warum verliebt man sich nicht in einen Typen wie dich?»
Ich dachte dann jeweils, das sei der Anfang einer Erkenntnis. Anstatt schreiend die Bar zu verlassen.
Immerhin verdankte ich den sieben einsamen Jahren den Grossteil meiner Bildung. Ich las jede Nacht erbittert ein Buch.
Meist frass ich mich durch ein Gesamtwerk. Auf Kishon folgte Böll, durch den ich den Krieg kennenlernte. Dann durch Canetti eine spanische Strenge. Durch Poe und Stevenson das Gruseln. Durch Thomas Mann die Tradition. Durch Kafka Bürokratie und Sehnsucht. Die Wucht der Sprache durch Büchner – der jung genug gestorben war, sodass ein ganzes Universum in einem Band war.
Irgendwann kam auch Hermann Hesse, der mich einen Sommer lang in einen peinlichen esoterischen Taumel versetzte, in dem ich das Gras roch und indische Gedichte schrieb. Er starb durch eine Kritik von Tucholsky, der bewies, dass Hesse keinen Funken Humor hatte. Dann las ich Brecht – hart wie Whiskey pur. Dann Camus, einen Mann für die Wüste, die Sonne und das Trotzdem. Sartre, ein Idol ohne mir verständliche Botschaft. Wittgenstein, superpräzis, superunklar. James Joyce, das Chamäleon unter den Stilisten.
Den klugen Klatsch in den Romanen von Beauvoir. Reich-Ranicki, um Liebeserklärungen und Hinrichtungen zu lernen. Hemingway, der eine völlig unsentimentale Art des Jammerns erfunden hatte. Günther Anders, der über Technik in Tagebüchern denken konnte. Schliesslich ein Bündel Arztromane als Protest gegen das Studium. Und die Krimis von Dashiell Hammett und Raymond Chandler: als Chewinggum gegen den deutschen Mundgeruch.
Von Autor zu Autorin wechselte ich meine Ansichten, meinen Blick, meine Gefühle. Und den Stil, in dem ich schrieb. Zu schreiben hatte ich mit 14 angefangen, hauptsächlich aus dem Gefühl heraus, dass es keine Haltung war, den Rest meines Lebens als Zuschauer im Sessel zu sitzen. Ich wollte mitspielen – vielleicht als Amateur in der vierten Liga, aber immerhin.
Beim Schreiben machte ich alle Fehler, die nur möglich waren. Ich türmte Schachtelsätze aufeinander. Ich lieferte sorgfältige Beschreibungen, nach denen man etwas hätte zeichnen können – nur sehen konnte man es nicht. Ich schrieb Dialoge, in denen Papier mit Pappe sprach. Ich streute dutzendfach Adjektive.
Vor allem vergass ich den Plot. Meine Figuren sassen zehn Seiten in einem Café, bevor die Story abbrach. Ich hatte tausend Dinge im Kopf, aber nichts zu sagen.
Meine Unfähigkeit rettete mir immerhin das Leben. Etwa mit 20 hatte ich im Badezimmer einer befreundeten Familie zwei Röhrchen Schlaftabletten geklaut. Und eine Flasche Whiskey zum Herunterspülen gekauft. Ich war zum Schluss gekommen, dass ich ein Fehlversuch der Natur war: interessante Ansätze, aber eben: ein Fehlversuch.
Ich war entschlossen, dem ein Ende zu machen. Als alles schlief, machte ich mich an den Abschiedsbrief. Es sollte ein hochherziger, nicht sentimentaler Abschiedsbrief werden, der seine Leser mit Respekt vor der Konsequenz seines Autors zurücklassen sollte – und einem leisen philosophischen Bedauern über die Unfertigkeit der Welt, in die ein interessantes Experiment wie er nicht hineinpasste.
Ich schrieb mit grimmiger Entschlossenheit – und es war Quark. Ich setzte noch einmal neu an. Und es war wieder Quark. Als die Dämmerung das Fenster erleuchtete, sass ich in einem Müllhaufen von angefangenen Abschiedsbriefen, und meine Verzweiflung war heller Wut gewichen.
«Du bist sogar zu unfähig, dich umzubringen», dachte ich. Und warf die Schlaftabletten in den Müll, mit dem Entschluss, mich noch am gleichen Abend umzubringen, wenn ich endlich genug Stil gelernt hatte, um den Brief zu schreiben.
Was bis heute nicht passiert ist.
Zeiten des Kämpfens
Das Problem des Schreibens löste sich beim Billardspielen im Café Schlauch. Kurz vor Mitternacht kamen Michael und ich auf das übliche Thema: dass 99 Prozent aller Studenten der Germanistik Idioten waren.
Das, weil 99 Prozent der Weltliteratur so geschrieben waren, dass man nach Seite 1 freiwillig auf Seite 2 blätterte. Während bei 99 Prozent aller literaturkritischen Schriften das exakte Gegenteil der Fall war. Was hiess: Im Prinzip war ein Literaturstudium eigentlich eine perfekte Ausbildung für Beamte. Aus lebendigem Material wurden tote Akten angelegt.
Diese Polemik war alles andere als neu. Aber an diesem Abend gingen wir einen Schritt weiter. Wir fassten einen Plan: «Wir müssen sie schockieren!» Nur wie? Uns fielen gleich zwei begeisternde Möglichkeiten ein. Wir würden einen Arztroman schreiben. Oder einen Krimi. (Krimis waren damals nicht entfernt so salonfähig wie heute – sie galten als Abschaum.)
Wir warfen dreimal eine Münze: Sie entschied sich 2:1 für den Krimi. (Zur Steigerung der Schockwirkung schrieben wir ihn mit eingelegtem Arztroman.)
Wir schrieben Kapitel um Kapitel, anfangs ohne Plan. Es war eine ungeheure Erleichterung, nicht mehr Kunst schreiben zu müssen. Sondern handfeste Action: Falls einem gerade nichts einfiel, liess man einen Mann mit einem Revolver die Tür eintreten. Oder schrieb einen Satz wie: «Der Kommissar war etwa so erfreut, als hätte ihn seine Darmflora gebissen.»
Und es war eine Erlösung, nicht mehr das eigene Bücherregal, sondern nur einen einzigen Komplizen beeindrucken zu müssen. Klar, wir schrieben wilden, zynischen, geschmacklosen Schrott. Aber fröhlichen.
Endlich kam Leben in die Arbeit.
Genauso einfach war es mit der Liebe. Elisabetta arbeitete im Parterre des Mietshauses in der Bäckerei und wohnte in einem Verschlag unter dem Dach. Sie kam aus Italien, studierte Kunstgeschichte, war blond und rosa und hatte einen Akzent ohne H. Sie hatte etwas von Gelsomina in «La strada»: dieselbe Mischung von reinem Herzen und meistens Pech.
Ich dachte keinen Moment lang darüber nach, dass wir ein Paar werden würden, bevor wir es wurden. Sie hatte einen Freund. Er war ein verdammt gut aussehender Jurist, kam aus einer der besten Familien Zürichs und war, wie ich immer hätte werden wollen, aber niemals werden würde: gewandt, geschmeidig und makellos wie der Schatten einer Katze.
Doch er konnte nicht über Kafka und Thomas Mann sprechen. Ich konnte das. Ausserdem betrog er sie. Ich tröstete sie in ihrer Dachkammer. Und dann sagte sie eines Nachts: «Geh nicht weg.»
Als ich in der Morgendämmerung die Treppe hinunterging, um rechtzeitig bei der Arbeit zu sein, wusste ich, dass alles, was ich mir zwischen Mann und Frau an Umwerfendem vorgestellt hatte, eine Illusion gewesen war. Die Wirklichkeit war noch viel, viel schöner als jede Fantasie.
Und ich wusste, dass alle Verzweiflung, alle Wunden, alles Grübeln der letzten sieben Jahre für immer Geschichte waren. Egal, was noch passieren würde, ich würde ohne Bedauern sterben können.
Ich musste in dieser Woche das Büro meines Vaters hüten. Ich holte die Post, sortierte sie und legte die Beine auf den Tisch. Mein letzter Gedanke, bevor ich einschlief, war: «Jetzt brauche ich nur noch einen Job.»
Pünktlich, wie sonst nichts in meinem Leben, meldete sich das Problem für die nächsten sieben Jahre.
Illustration: Alex Solman