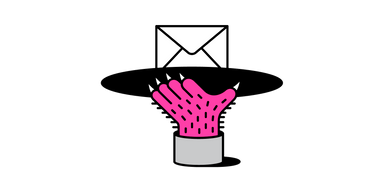
Die SVP sucht einen neuen Chef, SP-Referendum gegen Kinderabzüge – und eine Reise zurück in die Zukunft
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (84).
Von Philipp Albrecht, Andrea Arežina, Elia Blülle, Adrienne Fichter und Bettina Hamilton-Irvine, 16.01.2020
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Eigentlich wäre Magdalena Martullo-Blocher ja die perfekte nächste SVP-Präsidentin. Zumindest erfüllt sie einige der wichtigsten Anforderungen, die an die neue Parteispitze gestellt werden: So hat sie einen guten Draht nach Herrliberg. Sie könnte deshalb die Partei ganz natürlich von der zu Ende gehenden Ära Blocher in die Ära Martullo-Blocher überführen und so das Machtvakuum wieder schliessen.
Wer gesehen hat, wie Martullo an einer Kadertagung der Ems-Chemie ihre Mitarbeiter in den Senkel stellt, hat auch keinen Zweifel daran, dass sie in den SVP-Kantonalsektionen den Tarif durchgeben könnte, wie dies von der neuen Präsidentin verlangt wird. Und dass sie – nachdem der Versuch mit dem zu konzilianten Albert Rösti gescheitert ist – generell wieder schärfere Töne anschlagen würde.
Nicht zuletzt hätte Martullo auch das nötige finanzielle Polster, um die Aufgabe zu übernehmen: Denn so viel von der neuen Chefin gefordert wird, so wenig bekommt sie dafür. Gerade mal die Spesen werden vergütet.
Dass Martullo auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, SVP-Präsidentin zu werden, abwinkt, muss noch nichts heissen: Im Hause Blocher hat es Tradition, eigentlich nicht zu wollen. Aber dann irgendwann zu müssen. Doch dass die Unternehmerin und Nationalrätin kaum genügend Zeit für den Job hat, das glaubt man ihr sofort.
Fehlende Zeit dürfte auch bei den beiden Kronfavoriten Thomas Matter und Marcel Dettling ein Thema sein. So ist Matter Bankunternehmer, Nationalrat und Vater von vier Kindern, Dettling ist Bauer, Nationalrat, Vater von drei Kindern – und zudem Präsident des Kälbermästerverbands und Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Yberg. Dass beide mit einer Zusage zögern, überrascht daher nicht.
Als mögliche Präsidiumskandidatinnen ins Spiel gebracht worden sind auch der Walliser Nationalrat Franz Ruppen, die Baselbieter Nationalrätin Sandra Sollberger, der Berner Ständerat Werner Salzmann und die frisch gewählte Obwaldner Nationalrätin Monika Rüegger. Wer die Herkulesaufgabe antreten wird, zeigt sich in den nächsten Wochen: Ende Januar läuft die Frist für die Nominationen aus, am 28. März wird gewählt.
Und damit zum Briefing aus Bern.
Steuerbonus: Das Stimmvolk entscheidet im Mai
Worum es geht: Die Überraschung war gross, als CVP-Nationalrat Philipp Kutter vergangenen Herbst seinen Antrag durchbrachte: Eltern sollen in Zukunft pro Kind mehr Geld von den Steuern abziehen dürfen. Weil davon aber nur Familien mit hohen Einkommen profitieren würden, hat die SP das Referendum dagegen ergriffen. Am Dienstag hat sie 60’000 Unterschriften gegen die Vorlage eingereicht.
Warum Sie das wissen müssen: Der aktuelle Kinderabzug von 6500 Franken soll auf 10’000 Franken erhöht werden. Dies würde zu zusätzlichen Steuerausfällen von jährlich 370 Millionen Franken führen. Vom maximalen Abzug profitieren würden Doppelverdiener, die ein Bruttoeinkommen von mehr als 300’000 Franken haben, oder Alleinverdiener mit mindestens 200’000 Franken. Wer keine Bundessteuer bezahlen muss, wozu 44 Prozent der Familien gehören, wird mit höheren Abzügen nicht entlastet. Die Mittelschicht und die Niedrigverdienenden gingen also leer aus.
Was als Nächstes passiert: Wenn mindestens 50’000 der gesammelten Unterschriften gültig sind, wovon man ausgehen kann, kommt es zur Volksabstimmung. Der Bundesrat hat diese Woche entschieden, das Stimmvolk bereits am 17. Mai über das Referendum abstimmen zu lassen. Gegen die höheren Abzüge kämpft die SP gemeinsam mit weiteren linken Gruppierungen sowie einem liberalen Komitee, zu dem auch die GLP gehört. Etwas wankelmütig ist die FDP: Bei zwei von drei Abstimmungen im Nationalrat war die freisinnige Fraktion gegen höhere Abzüge. Beim dritten Mal aber stimmte die grosse Mehrheit der FDP-Nationalrätinnen plötzlich für den Vorschlag – und verhalf so der Idee zum Durchbruch.
Digitale Identität: Noch dieses Jahr wird über E-ID abgestimmt
Worum es geht: Das Schweizer Stimmvolk wird wohl noch dieses Jahr zum ersten Mal über digitale Demokratie abstimmen. Heute Donnerstag ist das Referendum gegen das E-ID-Gesetz mit mehr als 60’000 beglaubigten Unterschriften zustande gekommen – trotz fehlender Unterstützung der grossen Parteien. Die treibenden Kräfte hinter dem Referendum waren die Digitale Gesellschaft und der Verein PublicBeta.
Warum Sie das wissen müssen: Im Gegensatz zu Bürgern anderer europäischen Staaten haben Schweizerinnen noch keine eigene digitale staatliche Identität, mit der sie Umzüge melden oder sich in Konsultationen einbringen können. Das soll sich nun ändern. Doch das vorliegende Gesetz stösst auf Widerstand. Zwar sind die Gegner nicht per se gegen einen digitalen Pass. Sie kritisieren aber staatspolitische Aspekte. Denn die Vorlage würde es nur Privatunternehmen erlauben, eine staatliche digitale Identität herauszugeben. Hier sehen die Gegner des Gesetzes die öffentlichen Institutionen in der Pflicht und verweisen auf eine Umfrage, in der über 80 Prozent der Befragten keine privatisierte E-ID möchten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen stören sie sich zudem am «One for all»-Prinzip einer E-ID, bei dem das Benutzerkonto für Onlineshops mit jenem der Steuererklärung verknüpft würde. Diverse andere Staaten trennen diese Bereiche: Hier gibt es einerseits Smartcards, die vom Staat herausgegeben werden, und andererseits privatisierte E-IDs.
Was als Nächstes geschieht: Der Bundesrat wird demnächst kommunizieren, wann die Volksabstimmung stattfindet. Im Abstimmungskampf werden die Digitale Gesellschaft & Co. mächtigen Wirtschaftsverbänden wie etwa Economiesuisse gegenüberstehen, die auf eine schnelle Einführung der E-ID drängen. Eine Anbieterin der E-ID ist das Unternehmen SwissSign Group AG, ein Konsortium der grössten Schweizer Banken und Versicherungen.
Vaterschaftsurlaub: Es wird wohl doch nicht abgestimmt
Worum es geht: Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt es nicht zu einer Volksabstimmung über den bezahlten zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Eine Woche vor Ende der Sammelfrist fehlen den Gegnern der Vorlage noch mehrere Tausend Unterschriften.
Warum Sie das wissen müssen: Wer in der Schweiz einen Parlamentsentscheid vors Volk bringen will, muss in 100 Tagen 50’000 Unterschriften sammeln. Das kleine überparteiliche Komitee, das den im September beschlossenen Vaterschaftsurlaub verhindern will, hat noch bis am 23. Januar Zeit. Doch es wird eng: Obwohl die SVP ihre Anhängerschaft per Mail zum Handeln aufgerufen hatte und der «Weltwoche» ein Unterschriftenbogen beigelegt worden war, waren am 7. Januar erst 40’000 Unterschriften beisammen. Die zwei Gesichter des Komitees, die SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr und die Zürcher SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner, beschwichtigten, man werde das Ziel erreichen – auch wenn die Zeit wegen der nationalen Wahlen zu knapp gewesen sei. Erschwerend kam hinzu, dass der Gewerbe- und der Arbeitgeberverband nicht mitmachten. Sie sahen sich einem zu grossen gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, um eine Volksabstimmung zu gewinnen. Selbst die SVP ist gespalten. In der Romandie fand das Komitee keine Mitstreiter, weil dort selbst konservative Politikerinnen Männern eine Babypause zugestehen.
Wie es weitergeht: Wird im gleichen Tempo weitergesammelt, ist das Rennen verloren, und es kommt nicht zu einer Volksabstimmung. In diesem Fall wird der Bundesrat entscheiden, ab wann der neue Vaterschaftsurlaub bezogen werden kann.
Iran: Die Schweiz hilft, eine weitere Eskalation zu verhindern
Worum es geht: Vergangene Woche töteten die USA den iranischen General Qassim Soleimani in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die Konsequenzen: eine tiefe diplomatische Krise und die Rache des Irans, der zwei irakische Militärbasen beschoss, auf denen US-Militär stationiert ist. Nun zeigen Recherchen der «New York Times»‚ dass die Schweiz stark daran beteiligt war, eine komplette Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Kein europäischer Staat sei dabei wichtiger gewesen als die Schweiz.
Warum Sie das wissen müssen: Seit der Iran und die USA 1980 ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen haben, vertritt die Schweiz in Teheran die diplomatischen Interessen der USA und vermittelt zwischen den beiden Ländern. Gemäss der «New York Times»-Recherche hat der Schweizer Botschafter in Teheran nach der Tötung von Soleimani umgehend eine US-Nachricht an den iranischen Aussenminister übermittelt. Die Botschaft: Keine Eskalation, bitte.
Was als Nächstes passiert: Die Lage hat sich in den vergangenen Tagen wieder etwas beruhigt. Der diplomatische Kommunikationskanal zwischen den USA und dem Iran, den die Schweiz zur Verfügung stellt, funktioniere weiterhin, sagt das Schweizer Aussenministerium. Ansonsten hält sich das Departement aus Gründen der Vertraulichkeit bedeckt.
Der Apparat der Woche
Was für eine Nachricht: Die Schweiz war nach der Tötung des iranischen Generals durch die USA massgeblich dabei beteiligt, eine weitere Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Besonders aufhorchen lässt ein Detail dieser Geschichte: Denn die wichtige geheime Nachricht, welche die Trump-Regierung via Schweizer Botschaft dem Iran zukommen liess, wurde nicht etwa mit einem Anruf des weissen Hauses an den Schweizer Botschafter übermittelt. Nicht per Sykpekonferenz, Google-Hangout, verschlüsselter E-Mail oder codierter Nachricht. Nein, alles weit gefehlt. Die wichtige diplomatische Botschaft wurde per Fax geschickt. Was offensichtlich dem gängigen Protokoll entspricht: So wird der entsprechende Austausch in Krisensituationen laut «Wall Street Journal» hauptsächlich via verschlüsseltes Faxgerät abgewickelt. Back to the future, sozusagen.
Illustration: Till Lauer
Hinweis: In einer früheren Version schrieben wir, dass von den höheren Kinderabzügen nur Doppelverdiener mit Bruttoeinkommen von mehr als 300‘000 Franken profitieren würden. Richtig ist: Sie profitieren von den maximalen Abzügen. Zudem haben wir geschrieben, dass die Stiftung Konsumentenschutz treibende Kraft hinter dem Referendum war. Richtig ist: Die SKS hat sich zwar während der parlamentarischen Beratung stark gegen die frühere E-ID-Vorlage engagiert, sich danach aber zurückgezogen und die Unterschriftensammlung des Referendums nicht mehr unterstützt. Wir entschuldigen uns für die Fehler.