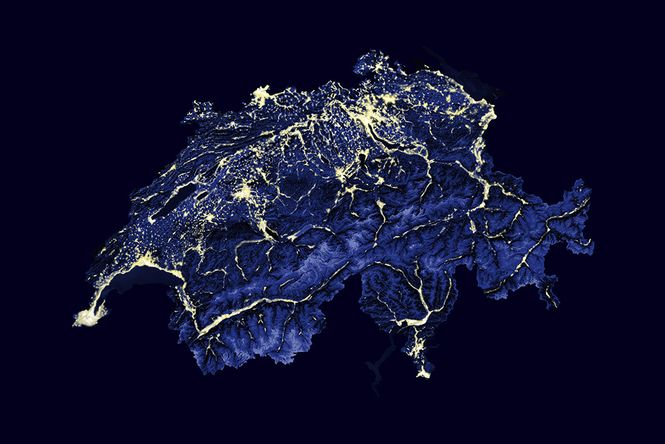
Düstere Zeiten für die Digitalisierung
Die Panne bei der Berechnung der Wahlstimmen wirft einmal mehr ein schlechtes Licht auf die Digitalkompetenz beim Bund. Dort existieren noch viele weitere digitalpolitische Baustellen. Das neu zusammengesetzte Parlament wird kaum imstande sein, diese zu lösen.
Ein Kommentar von Adrienne Fichter, 27.10.2023
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Stimmen, die drei- bis fünffach gezählt werden, ein Land, das drei Tage lang über falsche Parteienstärken diskutiert: Die Episode um die fehlerhafte Datenübermittlung bei den nationalen Wahlen zeigt exemplarisch, welchen Stellenwert die Cybersecurity in der Schweiz hat. Denn auch ein analoger Prozess wie die Wahl an der Urne oder per Brief ist von funktionierenden Technologien abhängig. Die Republik publizierte bereits 2020 eine Recherche zu den Sicherheitslücken von digitalen Ergebnisermittlungssystemen der Kantone. Doch die Regulierung und Harmonisierung von Wahlsoftware auf Bundesebene ist bislang schlicht kein Thema in Bern.
Seit Sonntag diskutierten Kommentatorinnen landauf, landab darüber, was der Rechtsrutsch bei den Wahlen für die Zuwanderung, das Klima, die Prämien oder die Zusammenarbeit mit der EU bedeutet. Aber eine profunde Analyse zur digitalen Zukunft der Schweiz? Sucht man vergebens.
Dieses Manko zeichnete sich bereits während des Wahlkampfs ab. Das Thema Digitalisierung war praktisch inexistent – ausser bei der Piratenpartei, die in ihrer Kampagne hauptsächlich auf Cyberthemen setzte. Beim berühmten Smartvote-Fragebogen wurden die rund 20 sehr gut konzipierten Fragen zur Digitalisierung aus dem Hauptfragebogen ausgeklammert und in einen Spezialfragenkatalog, den Digitalisierungsmonitor, ausgelagert. Gerade mal knapp 1200 der 4600 Kandidatinnen, die bei Smartvote partizipierten, füllten diesen aus, wie die Macher des Fragebogens auf Anfrage sagen.
Cyberthemen scheinen auch für die Wahlberechtigten wenig Relevanz zu haben: Gleich drei Digitalpolitikerinnen – Judith Bellaiche, Jörg Mäder und François Pointet, allesamt bei den Grünliberalen – wurden aus dem Nationalrat abgewählt. Dabei hatte die Zürcher Noch-Nationalrätin Bellaiche kurz vorher noch einen kleinen Triumph gefeiert. Sie konnte die grosse Kammer davon überzeugen, die drohende Chatkontrolle der EU hierzulande zu verbieten. Bei dieser geht es darum, Nachrichten auf verschlüsselten Messenger-Apps mit Material von Kindesmissbrauch abzugleichen und an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuschicken. Die geschähe mit einer Technologie, die stark fehleranfällig ist und massiv in die Privatsphäre aller Bürger eingreifen würde. Die Annahme von Bellaiches Motion war ein starkes Signal für Europa. Wer Bellaiches Kampf für Datenschutz beerben und fortsetzen wird, ist unklar.
Halten hingegen konnte sich Grünen-Präsident Balthasar Glättli, der vor allem für Überwachungsfragen sensibilisiert ist, und SP-Nationalrätin (und Glättlis Ehefrau) Min Li Marti, die stets die ethischen Aspekte im Blick hat. Ebenso wiedergewählt sind der profilierte Netzpolitiker Gerhard Andrey (Grüne), der viele digitalpolitische Akzente setzte, und auch der IT-Unternehmer und Cybersecurity-Experte Franz Grüter (SVP).
Was die Neueinzügerinnen in Bezug auf Digitalfragen werden bewirken können, ist noch nicht abschätzbar. Unter dem Strich lässt sich aber wohl sagen: Das neue Bundesparlament ist digital nicht kompetenter geworden.
Und das kann fatale Folgen haben, denn: Die digitalpolitischen Herausforderungen werden wachsen.
Da wäre etwa die erneute Revision des Nachrichtendienstgesetzes, die so viele schwerwiegende Eingriffe in die Privatsphäre vorsieht, dass die Behandlung des Geschäfts auf die neue Legislatur verschoben wurde. Ausserdem muss sich das Parlament mit geopolitischen Fragen von digitalen Lieferketten beschäftigen, die sich mit Netzausrüstern wie der chinesischen Firma Huawei stellen. Es muss sich mit dem Mammutprojekt Justitia 4.0 auseinandersetzen, das die Schweizer Justiz komplett digitalisieren möchte, wie auch mit Fragen der Regulierung von künstlicher Intelligenz.
Kaum förderlich ist dabei die Struktur der Bundesverwaltung. Anders als in Deutschland, wo ein eigenes Bundesamt für Digitalisierung geschaffen wurde, hat in der Schweiz jedes Dossier einen anderen politischen Schirmherrn, was in Inkohärenz und Kompetenzgerangel mündet: Es fehlt an einer Gesamtsicht über die vielen Siloprojekte des Bundes: die E-ID etwa, das E-Voting, die Public Cloud oder die elektronischen Patientendossiers.
Das Worst-Case-Szenario
Der Worst Case für die kommende Legislatur ist folgender: Wegen des Spardrucks bei der Bundesverwaltung und durch ein bürgerlich dominiertes Parlament, welches wie bis anhin auf Public Private Partnerships setzt und dabei die problematischen Seiten der Digitalisierung kaum in die Gleichung mit einbezieht, wird das neoliberale Mantra «Private können es besser!» der letzten Dekade fortgeführt – womit auch unzählige Fehler wiederholt werden.
Tritt dieses Szenario ein, werden die Folgen für die digitalen Bürgerrechte verheerend sein:
Die Schweiz wird keine Adaption des von der EU geplanten «AI Acts» forcieren und damit auf ein eigenes verbindliches Gesetz zur künstlichen Intelligenz verzichten. Der Schweizer Ansatz wird stattdessen sein: Jeder Sektor und jede Branche erhält andere Regeln. Es drohen mehr Bürokratie und auch Rechtsunsicherheit.
Der Plan für den Aufbau einer eigenen Swiss Government Cloud für schützenswerte Daten des Bundes, der Kantone und internationaler Organisationen wird stark gebremst, weil das Parlament die erforderlichen Mittel nicht freigibt. Die Ambitionen für digitale Souveränität werden damit geschwächt.
Es drohen weitere Desaster wie jenes um das Jugendschutzgesetz, bei dem die Implikationen einer De-facto-Alterskontrolle für Netflix oder Youtube vom Bundesparlament völlig verkannt wurden.
Mit der bürgerlichen Mehrheit in beiden Kammern wird auch der Law-and-Order-Kurs fortgesetzt, die technischen Überwachungsmöglichkeiten für das Bundesamt für Polizei ausgebaut (das auch Dienstleister für die Kantone ist), wie auch der Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr und der Nachrichtendienst.
IT-Firmen müssen mehr verbindliche Auflagen des Bundes erfüllen. Doch der Sparkurs und die bürgerliche Ausrichtung der beiden Kammern wird sich weiterhin auf das Beschaffungswesen auswirken: Der geforderte Datenschutz und die Cybersicherheit werden vom Bund in den Ausschreibungen nicht angemessen eingepreist. Die Auftragnehmerinnen setzen damit nur das Nötigste um. Das nächste Xplain-Debakel steht schon vor der Tür.
Dafür, ob sich diese düsteren Prognosen bewahrheiten, wird insbesondere bei der FDP und der Mitte massgebend sein, was man aus der Vergangenheit gelernt hat. Können sich diese dazu durchringen, der Bundesverwaltung genügend Ressourcen für den Aufbau von interner IT-Kompetenz bereitzustellen? Zeigen sie sich resistent gegenüber den Partikularinteressen wirtschaftlicher Lobbyverbände? Und beschäftigt sie sich in ausreichendem Masse mit den ethischen Implikationen von Digitalvorlagen?
Falls sich all diese Fragen mit Ja werden beantworten lassen, dürfte das Worst-Case-Szenario zumindest «mitigated» werden, wie es im Jargon der Cybersecurity-Fachleute heisst: Das Szenario tritt zwar ein, kann aber abgeschwächt werden.