
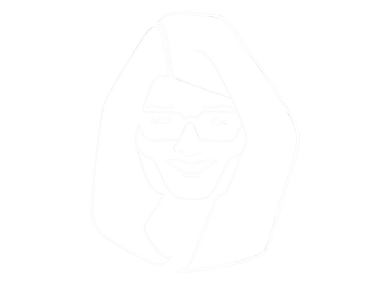
«Auch ich war gegen alles»
Pablo Picasso verstand die indigene Kunst Afrikas nicht. Er lernte trotzdem von ihr. Kulturelle Aneignung? Ja. Aber keine koloniale Abneigung.
Von Kia Vahland, 09.05.2023
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Sklaverei, Kolonialismus, internationale Ausbeutung: Das prägt die Geschichte der Moderne, prägt Europas Beziehungen zum Rest der Welt. Lange aber schien es, als ginge all dies Mitteleuropa nichts an, als sei die systematische Unterdrückung der Bevölkerungen in Afrika, Asien und Lateinamerika etwas, was nur Briten, Französinnen, Spanier und Portugiesinnen historisch belaste, nicht aber Schweizerinnen oder Deutsche.
Die Untaten der deutschen Besatzer in Ozeanien und Afrika wurden heruntergespielt, und die Schweiz schien ganz aussen vor zu sein, weil sie als Bergland ohne Seemacht keine Kolonien hatte. Was aber ihre Geschäftsleute, Bankiers, Forschenden und Söldner nicht hinderte, vom Kolonialismus der anderen gehörig zu profitieren. Noch 1864 erklärte der Bundesrat Sklaverei für «zweckmässig».
Die mangelnde historische Aufarbeitung, das lange Ignorieren der Verbrechen, die anhaltenden ökonomischen Abhängigkeiten haben ihren Preis. Heute misstrauen viele Einwohnerinnen im Globalen Süden den schönen Worten aus dem Norden und fragen sich, wie ernst gemeint die Rede vom Universalismus der Menschenrechte eigentlich sei. Und ob ihre Länder nicht genauso gut mit China und Russland Geschäfte machen könnten wie mit Europa, Nordamerika und Australien.
Dabei gelingt es gerade dem Regime im Kreml immer wieder, sich als antikolonial hinzustellen, ja als das eigentliche Opfer westlichen Imperialismus – unter Leugnung der eigenen Eroberungen im 19. und 20. Jahrhundert auf dem eurasischen Kontinent – und der eigenen Kriegsverbrechen heute.
Es ist also reichlich spät, wenn nun deutsche Städte Strassen umbenennen, die bisher preussische Schlächter ehrten, wenn eine Apotheke jetzt lieber anders heisst, wenn Historiker und Aktivistinnen sich um einen neuen Namen für das Agassizhorn bemühen (benannt nach dem Naturforscher Louis Agassiz). Ausgetragen wird die Auseinandersetzung vor allem im symbolischen und kulturellen Raum, obwohl doch die Gesellschaften als Ganze von dem langjährigen Unrecht und seinen Folgen profitierten.
Im Zentrum der Debatte stehen dabei westliche Museen, die in den Kolonien erstandene oder gestohlene Artefakte und Kunstwerke beherbergen und sich nun mit Recherchewünschen und Rückgabeforderungen konfrontiert sehen.
Manchmal ist der Raub eindeutig, wie bei den von britischen Soldaten brutal geplünderten und 1897 verscherbelten Benin-Bronzen. Nicht eindeutig ist aber auch in diesem Fall, an wen restituiert werden sollte: Geplant war, dass die deutschen Bestände der Benin-Bronzen nach Rückgabe vom nigerianischen Museumsverband NCMM verwaltet werden, nun stellte sich aber heraus, dass der scheidende Präsident des Landes die Eigentumsrechte dem Oba, einem Königshaus, übertragen hat. Sie könnten also in einem Palast statt in einem öffentlichen Museum landen. Was auch deshalb nicht unproblematisch ist, weil die Vorfahren des Oba den Europäern Sklaven verkauft hatten für das Metall der Bronzen – ein Teil der Geschichte, den das Königshaus heute nicht gerne erzählt.
In anderen Fällen von mutmasslicher Raubkunst fehlen historische Zeugnisse für eine Rekonstruktion der Geschehnisse, was Rückgaben erschwert. Wer damals fern der Heimat Kunst und Kultgegenstände kaufte oder eben mit Gewalt erpresste, scherte sich nur selten um die Entstehungsgeschichten und Bedeutungen der Stücke. Hauptsache, sie liessen sich in Europa verkaufen.
Doch nicht alle Europäerinnen im frühen 20. Jahrhundert betrachteten Werke aus Afrika oder Ozeanien als Dekor, Handelsware oder Trophäen. Zahlreiche Künstlerinnen und Kunstliebhaber der Avantgarden bewunderten die nach Europa und in die USA verfrachteten Masken, Nagelskulpturen und andere in ihren Augen geheimnisvollen Objekte. Sie projizierten ihre Sehnsucht nach ästhetischem Aufbruch und Ursprünglichkeit in die Werke und sahen sich durch sie legitimiert, ihre eigene Formensprache radikal zu reduzieren. Was nicht heisst, dass sie auch die spirituellen Anliegen der Schöpfer wirklich verstanden oder sich dieser Schwierigkeit auch nur bewusst gewesen wären.
Besonders intensiv identifizierte sich Pablo Picasso mit den unbekannten Bildhauern aus der Fremde. Schon lange hatten den Maler frühmittelalterliche Skulpturen aus Spanien und die katholische Mystik fasziniert. So archaisch sollte auch seine Kunst werden, direkt und dringlich. Als dann Holzfiguren aus Afrika in Pariser Galerien auftauchten, sah er sich bestätigt in seiner – von vielen Zeitgenossinnen geteilten – Zivilisationskritik. «Magisch» seien diese Gestalten, sie wendeten sich, so der Spanier, «gegen alles, gegen unbekannte, bedrohliche Geister». Und er folgerte: «Auf einmal begriff ich: Auch ich war gegen alles.»
Im Jahr 1907 blies er zum Angriff und zielte auf das Liebste von Kollegen wie Henri Matisse und Jean-Auguste-Dominique Ingres: den glatten, harmonisch proportionierten, hemmungslos idealisierten Frauenkörper in der Kunst.
Er spannte eine raumhohe Leinwand und versammelte auf ihr fünf nackte Frauen, wie sie noch nicht zu sehen waren. Die linke schiebt einen braunen Vorhang zur Seite und gibt so den Blick frei auf einen eisig klirrenden, blau-weiss zersplitterten Raum. Obwohl sie im Profil dargestellt ist, wie eine Figur der alten Ägypter, schaut ihr Auge uns frontal an.
Auch die drei mittleren Frauen starren die Betrachtenden an, und das eher musternd als einladend. Ihre athletischen Leiber wirken kantig bis dreieckig. Das Gesicht der Sitzenden vorne ist zur Maske verzerrt, mit schnauzartiger Nase, blau angelaufen wie das eine schiefe Auge. Die Frau rechts im Bild mit ihren grün gestreiften Wangenknochen und dem dunklen Blick verschliesst sich ebenfalls in mystisch-animalischer Aura. Überhaupt keine der Dargestellten gewährt Einblicke in ihr Innenleben.
Später wird das Gemälde gegen Picassos Willen «Les Demoiselles d’Avignon» genannt, nach dem Carrer d’Avinyó, einer Strasse in Barcelona, die für ihre Prostituierten bekannt war. Heute befindet sich das Bild im Museum of Modern Art in New York.
Der Maler freute sich über diese «Summe von Zerstörungen», die er auf der Leinwand angerichtet hatte, und wohl noch mehr über die entsetzten Reaktionen: Freunde spotteten über die eckigen, langen Nasen, die sie an ein Stück Brie erinnerten. Georges Braque machte das zweifelhafte Kompliment, Picasso habe beim Malen wohl Petroleum getrunken, um Feuer zu speien.
Der Kunstkritiker André Salmon, ein anderer, eigentlich wohlmeinender Zeitgenosse, lästerte, die «Hässlichkeit der Gesichter» auf dem Bild lasse einen «vor Abscheu vereisen». Das bezog sich wohl auf die beiden Figuren rechts, die deutlich von den formreduzierten afrikanischen Plastiken inspiriert sind. Picasso karikierte diese nicht, er wollte von ihnen lernen, die einengenden europäischen Vorstellungen von Schönheit abzulegen und ein Gesicht in wenigen Grundzügen zu erfassen. So markiert das Gemälde den Auftakt einer neuen Kunst, des Kubismus, den Picasso bald darauf gemeinsam mit Braque fortentwickeln sollte.
Hat Picasso sich künstlerisch an den afrikanischen Skulpturen bereichert, ihre Energien vereinnahmt für seine eigene Agenda der Provokation, sie sich kulturell angeeignet? Sicherlich. Doch er hat sich auch geweigert, die Masken und Statuen einfach als Handelsgegenstände und Schmuckstücke abzutun, sie zu profanisieren, obwohl sie doch einst kultische Funktionen hatten. Diese verstand Picasso wohl nicht – aber er erkannte an, dass sie existierten.
Franzosen verübten in diesen Jahren brutale Verbrechen in ihren afrikanischen Kolonien, etwa in Französisch-Kongo, und die Pariser Zeitungen übten sich in Schuldumkehr: Die Einheimischen wurden als blutrünstig beschrieben, als noch viel gewalttätiger als die Besatzer. Man fürchtete die angeblichen Ritualmorde der sogenannten Wilden und auch, dass sie alle nach Europa kommen könnten, um sich zu rächen.
In diesem Klima der rassistischen Angstlust war es ein Statement, sich als Künstler mit den Indigenen gemein zu machen. Wobei Picasso kein antikolonialer Kämpfer war. Er suchte in erster Linie Vorbilder abseits der modernen Konventionen und fand sie ausser in den altiberischen Steinmetzen eben auch in den afrikanischen Schnitzern.
Heute fällt es schwer, in den um 1900 herbeigeschafften Objekten der ethnologischen Museen etwas anderes zu erkennen als Symbole europäischer Schuld. Doch auch das verengt den Blick auf die indigenen Kulturen, denn die Stücke wurden nicht als Vorwürfe aus Holz und Federn geschaffen, sondern weil sie etwa im Ritual gebraucht wurden, Ahnen ehrten, spirituelle Kraft ausdrückten oder einfach im Alltag nützlich waren.
Raubgut den Nachfahrinnen zurückzugeben, ist richtig und wichtig, die Stücke aber unbesehen alle abzuschieben, nur um das eigene Gewissen zu erleichtern und die Schuldzeichen nicht mehr vor Augen zu haben, das würde ihren Schöpfern nicht gerecht. Besser wäre es, zu lernen, zu teilen und zu helfen. Man kann unrechtmässigen Besitz abgeben und sich trotzdem weiter darum kümmern, in internationalen Kooperationen etwa. Oder Künstlerinnen aus Ozeanien und Afrika bitten, ihrerseits europäisches Kulturgut zu kommentieren.
Picasso tat dies einst mit den alten Masken, besten Willens, wenn auch nicht unbedingt besten Wissens.
Illustration: Alex Solman
Klaus Herding: «Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon», Fischer Verlag 1992. 104 Seiten. (Nur noch antiquarisch erhältlich.)
Bénédicte Savoy: «Afrikas Kampf um seine Kunst», C. H. Beck 2021. 256 Seiten, ca. 37 Franken.