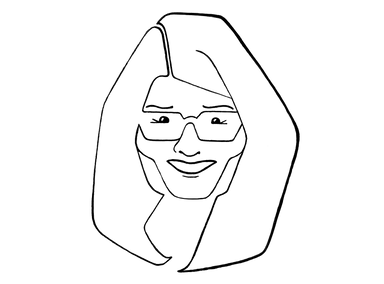
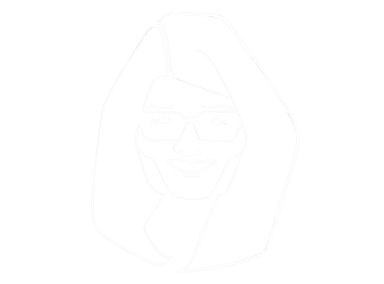
Das Bild vom Krieg
Wer keinen Krieg erlebt hat, kann sich die Gewalt und das Grauen nur schwer vorstellen. Bilder können dabei helfen. 1937 gelang es Pablo Picasso mit «Guernica», die Weltöffentlichkeit aufzurütteln für den Schrecken des Spanischen Bürgerkrieges.
Von Kia Vahland, 15.03.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Wie weit reicht das Vorstellungsvermögen? Was vermag sich eine auszumalen, die in Zürich oder Hamburg einen Alltag hat, den Kindern ein Frühstück macht, ins Büro fährt und abends wieder die Haustür aufschliesst, wissend, dass in der eigenen Wohnung schon noch alles an seinem Platz sein wird? Lässt es sich nachempfinden, wie es den Übernächtigten in den Kiewer U-Bahn-Schächten geht, welchen Lebensmut das Orchester der Stadt aufbrachte, um am hellen Tag auf dem Maidan zu spielen? Was es bedeutet, vor lauter Durst Wasser aus den Heizkörpern zu trinken oder seine hochschwangere Frau beim Bombenangriff auf die Geburtsklinik von Mariupol zu verlieren?
Kia Vahland ist Kunsthistorikerin, Sachbuchautorin und Meinungsredaktorin der «Süddeutschen Zeitung». Für die Republik bringt sie einmal im Monat ausgewählte Meisterwerke mit der Aktualität in Zusammenhang und beschreibt das Zusammenspiel von Kunst, Gesellschaft und Politik.
An viele Kriege, viele Bilder der Gewalt haben sich die Bürger der Wohlstandsländer im Laufe der Jahre gewöhnt. Nur ab und an drang noch eine Fotografie durch die empathiesicheren Westen: die des syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi etwa, dessen Leichnam im Herbst 2015 an der türkischen Küste lag. Plötzlich entdeckten die Europäerinnen, die doch von all den anderen Toten im Mittelmeer wussten, ihr Entsetzen. Und sie fühlten sich mit dem eigenen Mitgefühl mitunter recht wohl – ohne dass sich für die Betroffenen etwas geändert hätte.
Diesmal ist es anders. Eine Grossmacht überfällt einen Flächenstaat, der vielfältige Handels-, Familien- und Freundesbande mit Resteuropa unterhält. Die Attacke gilt nicht nur der Ukraine, sondern auch den Prinzipien der Staatensouveränität und der freiheitlichen Demokratie. Dass aber der Rest der Welt von Anfang an auch emotional involviert war, liegt nicht nur an der Tragweite der Geschehnisse. Es liegt auch am Medienwandel, daran, dass dieser Krieg in Echtzeit vor Ort in sehr viele Smartphones eingespeist wird und sofort auf sehr vielen anderen Smartphones überall auf der Welt erscheint. Morgens nach dem Aufwachen, in der Mittagspause, nachts, wenn man nur kurz auf die Uhr schauen wollte und dann doch beim Nachrichtendienst Twitter landet. Der Krieg ist da.
Es gab schon einmal einen Krieg, dessen Bilder auch in die Wohnzimmer der Nichtbeteiligten vordrangen. Die Fotografien und Berichte, die ab 1936 aus dem Spanischen Bürgerkrieg in Paris, London und New York eintrafen, waren verstörend neu: Reporter und Fotografinnen berichteten nicht mehr nur aus der Ferne, sondern besuchten umkämpfte Städte und Dörfer. Manche ergriffen Partei für die gewählte republikanische Regierung, die von den Militärs um General Franco mithilfe deutscher und italienischer Faschisten bekriegt wurde. Die Medienleute publizierten Heldenposen, aber auch Bilder der Ausgebombten, Verletzten, Bangenden und Toten. Diese schockierten Zeitungs- und Magazinleserinnen im Ausland auch deshalb so, weil die Regierungen des freien Westens sich in den Konflikt nicht einmischen wollten (obwohl sie das, anders als heute im Atomzeitalter, zu diesem Zeitpunkt wohl noch ohne hohes eigenes Risiko gekonnt hätten).
Am 28. April 1937 erreichte die Nachricht Paris, dass deutsche Flieger zwei Tage zuvor den baskischen Ort Guernica mit Bomben und Brandsätzen zerstört und zahlreiche Bewohner getötet oder verwundet hatten. Fassungslosigkeit machte sich breit und Wut auf die eigene Hilflosigkeit.
Einer aber reagierte umgehend: der Spanier Pablo Picasso. Er zog sich in sein Atelier unweit der Seine zurück, rauchte Kette, entwarf und verwarf Ideen im Furor. Schliesslich stand seine Antwort an General Franco saalhoch im Raum. Dreieinhalb Meter hoch und fast acht Meter breit konfrontiert Picassos Gemälde Betrachterinnen mit dem Schrecken dieses Krieges und aller Kriege.
«Guernica» ist in dunklen Grautönen gehalten, als wolle die Leinwand Trauer tragen. Bei einem so schwarz-weissen Bild mussten die Menschen sofort an Pressefotografien denken, und tatsächlich formuliert der Maler hier einen quasidokumentarischen Anspruch. Er war nicht dabei, als die Dächer in Guernica unter deutschen Bomben einstürzten, aber er zeigt der Welt, was so ein Überfall bedeutet.
Todesangst fliesst aus verlorenen Augenpaaren, die vor Schreck kaum weinen können. Eine Mutter mit einem toten Baby in den Armen will schreien, ihre spitze Zunge reckt sich dem Himmel entgegen, von dem nichts zu erhoffen ist. Auch der traurige Stier, der sich an sie schmiegt, kann sie nicht beschützen. Am Boden liegt ein Mann und stirbt, seine Faust greift noch die zerborstene Waffe, sein Körper aber ist schon in einzelne Teile zersprungen. Vielleicht hat er zuvor das verletzte Pferd geritten, das über ihm in Panik ausbricht, erhellt von einer schwachen Deckenlampe.
Rechts verbrennt ein Haus und auch eine Frau. Eine andere kniet und klagt. Sie wenigstens könnte einmal Kunde geben von dem, was hier geschieht – gemeinsam mit dem grossen Kopf, der sich von aussen durch ein Fenster reckt und sich nicht scheut, alles genau wahrzunehmen. Zu ihm gehört eine Öllampe, die ein starker Arm hineinträgt in das Drama, als wolle er die Not ans Licht bringen und wie die Freiheitsstatue von New York die Hoffnung auf bessere Zeiten hochhalten.
Die Gepeinigten drücken ihr Leid nach Kräften aus – aber sie brauchen auch jene, die sie anhören und anblicken. Picassos Bild möchte nicht einfach nur das Elend der Welt vorführen, um Betrachter zu deren eigener Genugtuung zu rühren. Es ist auch eine Handlungsaufforderung an Aussenstehende. Der Maler wollte offensichtlich, dass sich die Leute wirklich vorstellen, wie sich Krieg anfühlt, und dann ihre Konsequenzen daraus ziehen.
Ausgestellt wurde das Werk erstmals im spanischen Pavillon der Weltausstellung 1937 in Paris. Es war nicht unbedingt das, was sich die spanische Regierung dort vorgestellt hatte – zu wenig heroisch, zu avantgardistisch in der Bildsprache kam diese Anklage in ihren Augen daher. Doch die deutschen Nazis und die spanischen Putschisten schäumten, und vor allem sorgte das Gemälde in der westlichen Öffentlichkeit dafür, dass die Gräueltaten der europäischen Faschistinnen nicht gleich wieder vergessen wurden.
Solange Franco nach seinem Sieg über die Republik Spanien regierte, war das Bild auf Picassos Geheiss nicht in dem Land zu sehen. Heute gehört das – durch die vielen frühen Reisen stark beschädigte – Werk dem Museo Reina Sofia in Madrid. Und im Gebäude der Vereinten Nationen in New York hängt ein grosser Wandteppich mit dem Motiv. An Kraft hat es nicht verloren. Als die USA 2003 den Irakkrieg begannen, liess ihr damaliger Aussenminister Colin Powell den Teppich abhängen, bevor er sich in dem Raum erklärte. Ein totes Kind, ein panisches Pferd, ein brennendes Haus zum Kriegsauftakt, das hätte Fragen aufkommen lassen.
Noch hat auf Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine kein Künstler mit einem vergleichbar grundsätzlichen Werk wie Picassos «Guernica» reagiert. Mediennutzerinnen bleibt vorerst nur, unter den vielen Bildern aus dem neuen Krieg zu trennen zwischen Fakes und Dokumentarischem, Propaganda und Momentaufnahmen, die eine Ahnung vermitteln von der Lage vor Ort. Sich berühren, aber nicht manipulieren zu lassen, sich einzulassen auf die bedrückende Lebenswelt der anderen, ohne sie mit der eigenen zu verwechseln. Hinschauen, aushalten, einen helfenden Arm anbieten und die Öllampe einer gemeinsamen Zukunft weiter aufrecht halten.
Illustration: Alex Solman