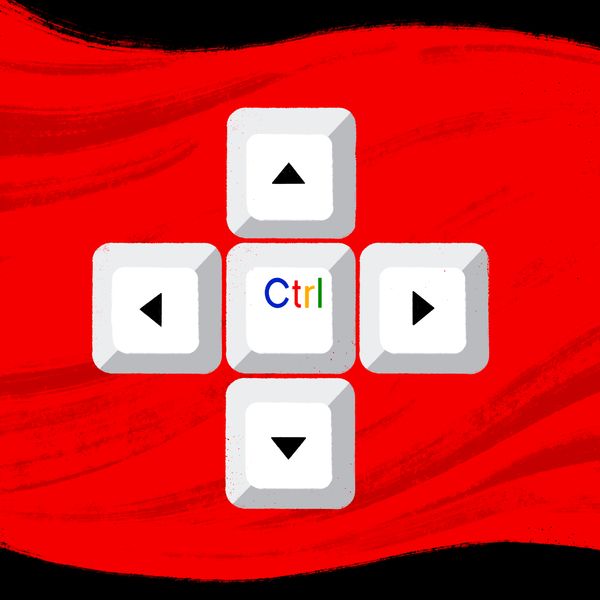Inside Google Schweiz
Der Standort Zürich hat grosse Bedeutung für den amerikanischen Big-Tech-Konzern. Doch was genau in der Schweiz entwickelt wird, behalten die Beteiligten lieber für sich. Warum eigentlich? «Do not feed the Google», 10. und letzte Folge.
Von Adrienne Fichter, Balz Oertli (Text) und Goran Basic (Bilder), 09.02.2023
Mehr als 5000 Mitarbeiter aus 85 Nationen, 100’000 Quadratmeter Bürofläche: Google ist wichtig für die Stadt Zürich. Der Schweizer Standort ist Googles grösstes Forschungs- und Entwicklungszentrum ausserhalb der USA. Doch nach aussen bleibt der Konzern erstaunlich abgeschirmt. Wie wenig hierzulande über das Innenleben von Google Schweiz bekannt ist, zeigte sich im Oktober 2019. Dass in Zürich eine Google-Gewerkschaft gegründet worden war, enthüllte nicht ein Schweizer Medium, sondern das US-Medienportal «Vox».
Die Welt der Zoogler, wie Google seine Zürcher Mitarbeiterinnen nennt, ist ein Paralleluniversum, aus dem nur hin und wieder ein paar Details dringen. Zum Beispiel, wenn ein Praktikant seine 9000 Franken Praktikumslohn auf Tiktok ausplaudert. Schweizer Medien erhalten selten Einblick, und wenn, dann an orchestrierten Besuchstagen. Zuletzt bei der Eröffnung der neusten Büros in Zürich, wo Journalisten Googles Mitarbeiter-Rutschbahn bestaunen durften.
Wir haben in den letzten Monaten versucht, die Blackbox Google in Zürich zu knacken. Wir wollten wissen: Welche Bedeutung hat der Zürcher Standort für die bekannten Google-Produkte? Woran wird in der Schweiz überhaupt gearbeitet?
Serie «Do not feed the Google»
Der diskrete Überwachungsgigant: Wir zeichnen nach, wie der Google-Konzern zur Bedrohung für die Demokratie wurde – und die Schweiz zu seinem wichtigsten Standort ausserhalb des Silicon Valley. Gespräche mit Internet-Expertinnen aus den USA, den Niederlanden, Deutschland und Kanada. Zur Übersicht.
Folge 2
Vom ungehinderten Aufstieg zum Monopol
Folge 3
Die Entzauberung von Google
Folge 4
Wenn ethische Werte nur ein Feigenblatt sind
Folge 5
Half Google, einen Schweizer auszuspionieren?
Folge 6
Auf dem Roboterpferd in die Schlacht
Folge 7
Gewinne maximieren, bis sie weg sind
Folge 8
Google und die Schweiz – eine Liebesgeschichte
Folge 9
Google im rot-grünen Steuerparadies
Sie lesen: Folge 10
Inside Google Schweiz
Bonus-Folge
Podcast: Warum sind alle so verschwiegen?
Um mehr über Google in Zürich zu erfahren, fragten wir auch mehrfach bei der Medienabteilung des Schweizer Ablegers an. Doch schnell wird klar, dass Google lieber schweigt. Uns werden alle Zugänge verwehrt, versprochene Gespräche wieder abgesagt. Also haben wir öffentliche Quellen ausgewertet und an offiziellen Kanälen vorbei mit ehemaligen und aktuellen Mitarbeiterinnen gesprochen.
Dabei fanden wir Verblüffendes heraus: Ohne den Zürcher Standort würden heute viele Google-Produkte nicht funktionieren. Verklausuliert gibt das der Konzern auch selber zu: «Wir sind quasi ein Exportunternehmen mit Sitz in der Schweiz», sagte Patrick Warnking – bis Ende 2022 Google-Schweiz-Chef – vergangenen Sommer im Magazin «Die Volkswirtschaft», einer Publikation des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Im Gespräch mit der Republik wird ein Insider noch etwas deutlicher: «Es ist einfacher zu sagen, was nicht hier entwickelt wird.» Die Zoogler werkeln in der Schweiz an allen Produkten des Google-Ökosystems. Produkte, die Milliarden Menschen weltweit jeden Tag nutzen: Search, Youtube, Maps, Assistant, Gmail und vieles mehr.
Doch warum diese Verschwiegenheit? Die Gründe dafür liegen in Konflikten mit der EU, im Selbstbild vieler Zoogler, das sich nicht mit den Realitäten deckt – und auch an der immer repressiveren internen Diskussionskultur.
«OK Google»: Wer hats erfunden?
Gondeln als Sitzungsräume, «Hoi zäme» als Begrüssung an der Eingangstür, ein Plakat mit den Worten «Schriibsch mer mal wieder en Liebesbrief?» im Schaufenster, am Schweizer Nationalfeiertag die Schweizer Fahne im Google-Logo der Suchmaschine: Google betont, manchmal locker-gelassen, manchmal etwas anbiedernd, gerne die eigene Swissness.
Ein Blick in die Stellenausschreibungen – 198 in dreieinhalb Monaten – zeigt eindrücklich: Bis vor kurzem brummte bei Google Schweiz der Wachstumsmotor. Erst im Januar 2023 haben die Massenentlassungen in der Tech-Branche den Grosskonzern erreicht. 12’000 Angestellte, knapp 6 Prozent aller Beschäftigten, will der Tech-Gigant entlassen. Gemäss mehreren informierten Quellen wird der Standort Zürich in ähnlichem Masse von den Entlassungen betroffen sein. Aktuell würden die Verhandlungen zwischen Personalvertretung und Management noch laufen, es sei jedoch noch nicht klar, wann die Kündigungen genau ausgesprochen würden.
Was nichts daran ändert: Zürich ist nicht irgendein Aussenposten. Seit der Ansiedlung 2004 arbeiten hier viele Angestellte am Fundament der Google-Produkte. Was auch praktische Gründe hat: Da Zürich in einer anderen Zeitzone liege als Kalifornien, sei es zum Beispiel einfacher gewesen, hier das Back-up des Infrastrukturteams anzusiedeln, sagt ein Insider. Denn die Verfügbarkeit ist damit immer gewährleistet. Google nennt das «Core» oder auch «Site Reliability Engineering». Man könnte es auch das Rückenmark vieler Google-Anwendungen nennen.
Je tiefer wir graben, desto klarer wird, dass es zwei Kategorien von Google-Projekten gibt in Zürich. Diejenigen, die Google gerne zu PR-Zwecken zur Schau stellt. Und die anderen, über die der Konzern aus guten Gründen lieber schweigt.
Eines der bekanntesten Schweizer Vorzeigeprojekte ist Google Assistant. Am 10. September 2019, als 15 Jahre Google Schweiz und die Eröffnung des neuen Hauptsitzes an der Europaallee gefeiert werden, steht der Sprachassistent im Mittelpunkt der Präsentation. Anwesend ist Prominenz aus Politik und Wirtschaft: Ringier-CEO Marc Walder, der damalige SBB-Chef Andreas Meyer und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch posieren für Gruppenfotos, die Zürcher Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh nimmt an einem Podium teil, SVP-Bundespräsident Ueli Maurer überbringt Grussworte.
Präsentiert wird Googles Sprachassistent von Behshad Behzadi, Vice President of Engineering und Zoogler seit 2006. Sein Linkedin-Profil zeugt von der Wichtigkeit des Schweizer Standorts für den Mutterkonzern: «Co-founder of Google Assistant, Co-founder of Google Lens, Co-founder of Google Smart Display, Co-founder of Next-Gen Assistant».
Behzadi hat mit diversen Hacks die Suchqualität von Google Assistant verbessert. Wer den sprachgesteuerten Algorithmus fragt: «Wo lebt Amal Clooney?», erfährt, dass die Menschenrechtsanwältin zusammen mit ihrem Ehemann ein anschauliches Immobilienportfolio besitzt. Wer weiter fragt: «Wie heisst ihr Ehemann?», wird mit grosser Wahrscheinlichkeit George Clooney als Antwort erhalten. Der Algorithmus hat korrekt erkannt, dass sich das «ihr» auf die vorherige Frage bezieht. An dieser Kontextualisierung seien die Google-Forscherinnen in den USA stets gescheitert, sagen mehrere Quellen. Und der Standort Zürich habe einen Grossteil zur Lösung beigetragen.
Damit nicht genug: Jede Person, die schon mal den Google Assistant benutzt hat, nutzt damit wohl eine Schweizer Erfindung. Der Google Assistant wird mit «OK Google» aktiviert; sobald der Algorithmus diesen Befehl erkennt, erwacht er und erwartet eine Frage. «Die Idee zum Befehl ‹OK Google› kann man durchaus als Zürcher Erfindung bezeichnen», sagt ein Direktbeteiligter.
Stolz betonen höchste Google-Manager die Swissness ihres virtuellen Assistenten. An der Jubiläumsfeier führt Behzadi vor, welche schweizspezifischen Fragen Google Assistant inzwischen zu beantworten weiss. Wie viele Kalorien «ein Gipfeli» hat zum Beispiel. Der Algorithmus liefert auch die Antwort auf die Mutter aller Schweizer Fragen: «OK Google, wer hats erfunden?»
Spracherkennung bildete von Anfang an einen Zürcher Schwerpunkt. Bereits die allererste Stellenausschreibung von Google Schweiz nannte die Spracherkennung als Fokus. In der hauseigenen Broschüre «#GrueziGoogle», in der auf 43 Seiten ausgebreitet wird, was alles «aus der Schweiz für die Welt» entwickelt werde und wie Google Appenzeller KMU unterstütze, erzählen Mitarbeiterinnen ausserdem, wie Zürcher Google-Softwareingenieure «100 Millionen Phishing-Attacken» verhindern würden – jeden Tag. Der Bereich «Trust and Safety»: Auch er ist ein Standbein des Schweizer Google-Ablegers.
Doch es gibt auch Google-Produkte, an denen die Zoogler massgebend mitarbeiten, über die sie aber lieber schweigen.
Google lebt vom Sammeln und Auswerten von Daten und vor allem: von Werbung. Datengetriebene Werbung macht laut Unternehmensangaben 80 Prozent des Umsatzes aus. Über dieses Kerngeschäft spricht der Konzern allerdings nur ungern. Zum Beispiel darüber, dass in Zürich die Monetarisierung von Google-Produkten optimiert wird. So haben Zoogler die Werbeplattform True View programmiert, mit der Youtube monetarisiert wird.
Dass in Zürich an der Werbemaschinerie des Google-Konzerns getüftelt wird, wissen wir aus Blogartikeln von Zooglerinnen. Nicht selten geben Mitarbeiter unbeabsichtigt Hinweise auf die Geschäfte von Google in der Schweiz. So wie im Werbeprospekt «#GrueziGoogle», der anlässlich der Eröffnung der neusten Google-Büros an der Zürcher Europaallee lanciert wurde. Darin erzählt Tech-Standortleiterin Lucia Terrenghi eher beiläufig, wie wegen der Pandemie der E-Commerce-Bereich von Google angekurbelt worden sei.
Konkret geht es dabei um Google Shopping, ein Erfolgsprodukt developed in Switzerland. Während Corona hat Google Shopping ordentlich zugelegt. Heute kaufen täglich eine Milliarde Menschen via Google ein, verkündete Google-CEO Sundar Pichai vergangenen Sommer. Umsatzzahlen gibt der Konzern keine bekannt. Das gesamte Werbegeschäft brachte Google 2022 innert der ersten neun Monate 148,258 Milliarden Dollar ein. Im Mai 2022 sagte Google-Shopping-Chef Bill Ready an einer Konferenz, sein Bereich leiste «seit mehreren Quartalen in Folge den grössten Beitrag zum Wachstum».
Google Shopping – ein Glücksfall für Google Schweiz. Es sei nur zum Zürcher Projekt geworden, sagt eine Quelle, weil es «zu langweilig für Mountain View» war. Mountain View, also der Google-Hauptsitz in den USA, und der Standort Zürich hätten sich vor allem in der ersten Dekade des Schweizer Google-Ablegers um den Lead bei Produkten oder Produktkomponenten gestritten. «Es war und ist immer ein Politikum und ein zähes Ringen», sagt ein langjähriger Zoogler. Allerdings beschäftigen sich mit dieser Cashcow inzwischen nicht nur etliche Zürcher Ingenieure.
Google Shopping hat auch den Zorn der Brüsseler Wettbewerbsbehörden geweckt.
Ursprünglich hiess der Preisvergleichsdienst Froogle und wurde 2002 lanciert. In den letzten Jahren verschmolzen die Suchfunktion und Google Shopping immer mehr miteinander. Wer auf Google nach einem Produkt sucht, kommt kaum am Google-Shopping-Karussell vorbei. Konkurrenten wie Amazon oder Ebay beschwerten sich darüber bei den EU-Wettbewerbshütern. Die prominente Platzierung des eigenen E-Commerce-Bereichs in der eigenen Suchmaschine: ein klassischer Fall von Wettbewerbsbehinderung. Google missbraucht seine marktbeherrschende Stellung bei Suchmaschinen.
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager verhängte deshalb 2017 eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google. Ein EU-Gericht bestätigte die Strafe im November 2022 gegen den Widerstand der Google-Anwälte.
Und fast hätte Google Flights das gleiche Schicksal ereilt. Die Google-eigene Flugsuche wurde ebenfalls in Zürich entwickelt, wie Quellen belegen. Auch hier handelt es sich um einen Vergleichsdienst, der prominent in der konzerneigenen Suchmaschine angezeigt wird. Dafür reicht die Eingabe «Zürich Barcelona Flug» – und schon poppt der Google-Service unübersehbar auf. Auch dieses Angebot geriet ins Visier der EU-Kartellbehörde. Es bedroht Konkurrenzportale wie Booking.com und Expedia.com. Doch hier kam der Datenkonzern einer Klage zuvor: Buchungen von Flugreisen sind für europäische Kunden nicht mehr über Google Flights möglich.
Dass Google über diese Geschäfte, die aus dem Nicht-EU-Land Schweiz betrieben werden, lieber schweigt, leuchtet ein. Die Schweizer Politik zeigt bisher kein Interesse, wettbewerbsrechtlichen Fragen kritisch nachzugehen. Die US-amerikanischen und europäischen Debatten über Googles Monopolstellung sind hierzulande praktisch inexistent. Und Google möchte, dass dies auch weiter so bleibt.
Als Google böse wurde
Bei keinem anderen Produkt betont der Konzern die Entwicklung am Schweizer Standort so stark wie bei Google Maps. In der Werbebroschüre #GrueziGoogle wird beschrieben, wie der Genfer Henri Dufour mit dem Abbild der Schweiz die Grundlagen der modernen Kartografie legte. Dass Maps in der Schweiz entwickelt wird, geht auf Googles Kauf der Luzerner Firma Endoxon zurück, die bereits in den 1990er-Jahren Luftbilder digitalisierte und Karten erstellte. Über 50 Mitarbeiter zogen 2006 vom Schlössli Schönegg in Luzern zu Google nach Zürich, damals an der Freigutstrasse.
Ohne die in der Schweiz entwickelten Funktionalitäten wäre Google Maps eine ziemlich mittelmässige Karte. Die Maps-Ingenieure tüftelten hier an all den Funktionen, die heute kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken sind: den Verbindungsanzeigen des öffentlichen Verkehrs, den Velorouten, dem blauen Suchpfad auf den Karten, der uns dynamisch durch Metropolen und Landschaften navigiert.
Es sind praktische Funktionen, die jedoch auch viel über unser Privatleben preisgeben. Denn die Standortinformationen verraten, wie und wo wir leben, wen wir lieben und wo wir hingehen. Einige Mitarbeiterinnen aus dem Team Maps in Zürich überlegten sich deshalb, wie solche Funktionen datensparsamer umgesetzt werden könnten. Zum Beispiel die «Live Business»-Funktion: Sie zeigt auf Maps an, wie belebt ein Ort ist, den man besuchen möchte. Dafür wird allerdings auf die Standortdaten von Google-Nutzern zurückgegriffen.
Luuk van Dijk war von 2005 bis 2015 (mit zwei Jahren Unterbruch) für Google Schweiz tätig. Sein Team und er beschäftigten sich mit dem Datenschutzdilemma von Live Business und arbeiteten 2014 an einer technischen Lösung, die Nutzerinnen ermöglichen sollte, zu entscheiden, ob sie die Standortdaten freigeben wollen oder nicht.
Ins Produkt floss das Ergebnis aber nie ein. Google versprach zwar, dass jeder Nutzer selbstbestimmt entscheiden könne. 2018 enthüllte die Nachrichtenagentur AP jedoch, dass Google diese Informationen auch dann sammelt und auswertet, wenn der Standortverlauf ausgeschaltet wird. Google musste einräumen, dass sogar bei normalen Suchanfragen der Standort an Google-Server übermittelt wird, was den Big-Tech-Konzern vor drei Monaten als Resultat einer Klage von 40 US-Bundesstaaten 391 Millionen US-Dollar kostete. Und im Januar wurde eine weitere Zahlung von 29,5 Millionen Dollar zum gleichen Datenschutzskandal verhängt.
Der frühere Zoogler van Dijk sagt dazu gegenüber der Republik: «Zwischen 2008 und 2012 wurde Google langsam ein böses Unternehmen.» Er ist einer der wenigen, die sich in dieser Recherche mit seinem Namen zitieren lassen. Ein anderer Insider sagt ernüchtert, dass es zwar auch in Zürich Datenschutzteams gebe, aber Wachstumsziele und Produktefahrpläne niemals darunter leiden dürften. Google sei halt doch durch und durch ein US-Datenkonzern. Auch das ist mit ein Grund, warum Google Schweiz nicht gerne über sein Innenleben spricht: Das Selbstbild, von Zürich aus Gutes zu tun, kollidiert mit der Realität eines Konzerns, der einzig auf die Umsatzzahlen schaut.
Nicht nur bei Google Maps, auch im Team Youtube mussten einige der Zooglerinnen schmerzhaft lernen, ihre ethischen Ansprüche der Profitmaximierung von Mountain View unterzuordnen. Zürich ist der grösste Entwicklungsstandort für Youtube ausserhalb des Hauptsitzes. Ein ganzes Bürogebäude an der Europaallee, Hausnummer 1, befasst sich ausschliesslich mit dem weltgrössten Videoportal. Die Sitzungszimmer im Gebäude sind nach berühmten Youtubern wie PewDiePie oder MrBeast benannt.
Vor elf Jahren siedelten die ersten Youtube-Ingenieure in Zürich an. Seither haben die Zoogler massgeblich mitgewirkt, dass sich Youtube zur Geldmaschine entwickelte. Die Zoogler arbeiteten an Analysetools wie dem «Creator Studio», das Künstlerinnen Werkzeuge für die Publikation und Vermarktung ihrer Videos zur Verfügung stellt. Und sie sind verantwortlich für das Herzstück: die Content-ID. Damit wurde die Grundtechnologie für das spätere EU-Urheberrecht entwickelt: Die Content-ID verhindert, dass Youtube zu einem Piraterieportal verkommt. Noch 2011 hat sich ein «grosser Teil» der damals 600 Zürcher Google-Mitarbeiterinnen mit dieser Innovation beschäftigt, wie der damalige Sprecher der Zeitung «Der Sonntag» verriet.
Die Lösung funktioniert so: Von jedem urheberrechtlich geschützten Werk wird ein sogenannter digitaler Fingerabdruck erstellt. Jedes auf Youtube hochgeladene Video wird mit den bekannten Fingerabdrücken verglichen, um festzustellen, ob das Video urheberrechtlich geschütztes Material benutzt oder nicht. Wird solches identifiziert, können Rechteinhaber wählen, ob der Inhalt ignoriert, gelöscht oder monetarisiert werden soll. Wird Monetarisierung gewählt, blendet Youtube Werbung ein und reicht einen Teil der Einnahmen an die Rechteinhaber weiter.
Was aber, wenn Entwicklungen aus Zürich nicht Googles Geldmaschinen am Laufen halten, sondern moralische Probleme lösen wollen? In den 2010er-Jahren arbeiteten die Zoogler an einer Lösung, mit der auf Youtube hochgeladenes Videomaterial – schon damals waren es 100 Stunden pro Minute, heute sind es 500 Stunden – auf Inhalte wie Pornografie oder Gewalt geprüft werden kann, damit es nicht für die Monetarisierung mit Werbung freigegeben wird.
Dies sollte ein manueller Prozess mit menschlicher Beteiligung sicherstellen. Doch in den USA hielt man nichts von diesen Sorgfaltspflichten beim Reviewprozess. Die Konsequenzen zeigten sich 2015: Es wurden nicht nur Videos des Islamischen Staats auf Youtube ausgespielt. Wer draufklickte, erhielt davor auch noch kommerzielle Produktwerbung ausgespielt. «Das US-Management war komplett ignorant, sie hätten besser auf uns gehört», sagt eine ehemalige Zooglerin.
Mit welchen Videos darf man Geld verdienen? Wie weit darf man für die Verbesserung von Karten und Suchanfragen in die Privatsphäre von Usern eindringen? Es sind solche ethischen Fragen, die hier in Zürich diskutiert werden. Das Management entscheidet sich jedoch meist für die profitabelste Variante, entgegen dem Rat engagierter Softwareingenieurinnen – und rudert erst zurück, wenn der öffentliche oder politische Druck zu gross wird. Auch die Gewerkschaft Syndicom, die mit Google-Mitarbeitern in Kontakt steht, bestätigt das. Viele Zoogler störten sich an der «Machtstruktur» des Konzerns, «wie alles aus den USA gesteuert wird mit minimalem Input aus der Schweiz».
Die Pflicht, stets gute Performancezahlen zu liefern, veränderte die Arbeitskultur und auch die Geschäftsfelder während der letzten 20 Jahre Google in Zürich: weg vom Fokus auf den normalen Internetnutzer hin zu Firmenkunden, die ihre Daten virtuell speichern wollen.
Vom Hoodie zur Krawatte: Google Cloud
Wer sind sie eigentlich, diese Zoogler? Bundesrat Guy Parmelin begründete den Mangel an Cyberexpertinnen bei der Armee Ende 2017 in der Zeitung «Bund» damit, dass von jährlich 250 an der ETH ausgebildeten IT-Spezialisten 200 zu Google gingen. Nicht nur von Parmelin, von allen Seiten hören wir während der Recherchen: Google sei ein Staubsauger für ETH-Absolventinnen.
Die Mehrheit der Google-Mitarbeiterinnen in Zürich wird allerdings aus dem Ausland rekrutiert. Früh stellte sich Zürich als sehr attraktiv heraus für gut ausgebildete Informatikerinnen aus der Ukraine, Russland und weiteren Ländern in Osteuropa, wie aus mehreren Gesprächen hervorgeht. Google Zürich ist das perfekte nächste Karriereziel. Nicht zu weit weg von zu Hause und trotzdem in einem der angesagtesten Tech-Unternehmen der Welt.
Vor allem aber lockt Zürich mit der hohen Lebensqualität all jene IT-Cracks an, die mit dem Silicon-Valley-Lifestyle wenig anfangen können. Sie kommen mit Partnern, Kindern, bleiben für einige Jahre oder wollen sesshaft werden. Zürich ist kein Durchgangsstandort. Die meisten kommen, um zu bleiben.
Auch wegen des Gehalts. Google (und die anderen US-Tech-Firmen wie Apple und Amazon) bezahlen Softwareingenieuren nicht das Doppelte, sondern das Dreifache im Vergleich zur lokalen Konkurrenz. Gespräche bestätigen durchs Band: Wer bei Google als Softwareingenieur arbeitet, verdient bereits nach wenigen Jahren bis zu 350’000 Franken, auch ohne Führungsfunktion.
Google offeriert noch weitere Annehmlichkeiten: Fitnessräume, Massagen, Billardtisch, dazu ein interner Coop@home-Shop und einen Zuschuss an die Krankenkasse. Das kulinarische Verwöhnprogramm der hauseigenen Restaurants ist berühmt. Zoogler essen umsonst. Ein ehemaliger Koch schwärmt: «Es gab alles: Lachs, Sushi, Pizza, Pasta. Vegan, glutenfrei, ohne Alkohol, ohne Schwein.» Er wurde zwar nicht besser entlöhnt als anderswo, aber auch die Küchenangestellten essen «aufs Haus».
Doch mit den Annehmlichkeiten wird den Angestellten getreu dem Motto «Zuckerbrot und Peitsche» viel abverlangt. Die Zoogler arbeiten hart und viel. Gegenüber dem Magazin seiner ehemaligen mittelfränkischen Fachhochschule sagte ein Grafiker bei Google: «Man denkt erst, man ist im Schlaraffenland angekommen. Die meiste Zeit sitze ich aber an meinem Rechner.» Es sei eine seltsame Mischung, zu den Auserwählten zu gehören und gleichzeitig den Kündigungsdruck im Nacken zu haben, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter, dem gekündigt worden ist. Sein Name: Grigory Yakushev. Er litt an einem Burn-out, über das er 2021 mit dem «Business Insider» gesprochen hat.
Bei Google Zürich habe er in den Teams Calendar und Suchmaschine mit den klügsten Köpfen zu tun gehabt, was ihn immer motiviert habe. Damit habe sich auch der Druck erhöht: «Wenn jeder einzelne Mensch um einen herum extrem fähig und talentiert ist, muss man ziemlich schnell laufen, um mitzuhalten.» Mental-Health-Probleme waren in den 2010er-Jahren noch ein Tabu. Yakushevs Chef war ein fähiger Ingenieur, brillant und technisch versiert. Doch mit persönlichen Problemen wie Burn-outs sei er völlig überfordert gewesen, sagt Yakushev. Heute arbeitet er in Luuk van Dijks eigener Firma.
Der Wettbewerbsdruck bei Google Schweiz sei enorm. Man werde schnell ausgewechselt, wenn man nicht liefere, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin.
Einige der Zoogler, mit denen wir gesprochen haben, nennen die frühen 2010er-Jahre als Zäsur. Davor herrschte eine Phase des kreativen Ausprobierens. Besonders die Zoogler, die seit den Nullerjahren dabei waren, betonten die Autonomie im «Zurich Office» und die früheren Freiheiten. Wer eine gute Idee hatte, entwickelte einen Prototyp, wurde im US-Hauptquartier Mountain View vorstellig und bekam Stellenprozente.
Noch heute schwärmen die Zoogler von der Ära, als Google in Zürich noch sehr klein war, als etwa «Karaoke from Hell» an den «Thank god it’s Friday»-Apéros im Hürlimannareal auftraten. 60-Stunden-Arbeitswochen seien normal gewesen: «Die Leute haben ihre ganze Freizeit geopfert», erinnert sich Luuk van Dijk.
«Es gab in den verspielten Nullerjahren aber auch viele ‹Löli-Projekte›, die überhaupt keine Kohle eingespielt haben», erinnert sich ein anderer Zoogler. Dann wurde 2011 der Mitgründer Larry Page neuer CEO von Google. Und die Ära des Ausprobierens war vorbei. Page trimmte das Unternehmen auf Effizienz, der Fokus wurde auf Produkte gelegt, die Umsatz versprachen.
Diese Veränderung zeigt sich auch an Googles Schwerpunktprojekten in Zürich. Einerseits dem Software-Paket «Google Workspace», das alle bekannten Google-Anwendungen wie Mail, Calendar, Docs aus einem Guss für Firmen anbietet. Andererseits am neuen Geschäftsfeld Google Cloud. Auf Google Maps fände man Google Clouds zum Beispiel an der Bärengasse 25. Hier «könnte eine Privatbank beheimatet sein», schrieb die «Finanz und Wirtschaft» nach einem Besuch letzten Sommer. Die Zeitung traf Roi Tavor, seit Juni Managing Director of Google Cloud Switzerland & Austria, einen Manager auf der gleichen Hierarchiestufe wie der damalige Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking.
Der Cloudmarkt in der Schweiz boomt. Das Bundesamt für Energie erwartet mehr als eine «Verdoppelung des Stromverbrauchs durch die Rechenzentren in der Schweiz in den nächsten 5 Jahren». Franz Grüter, Verwaltungsratspräsident des Rechencenterbetreibers Green und SVP-Politiker, ist überzeugt: «In den nächsten 3 bis 5 Jahren werden die Karten neu gemischt.»
Google will von Zürich aus ein Stück vom Cloud-Kuchen abzwacken. Auch, weil die Online-Werbung – Googles Hauptgeschäft – immer stärkeren Gegenwind bekommt. Einerseits wird sie selbst in den USA immer mehr Restriktionen unterworfen und zunehmend zum Gegenstand von Klagen, andererseits stellt der intelligente Chatbot Chat GPT eine ernst zu nehmende Konkurrenz für die Suchmaschine dar.
Das Cloud-Geschäft habe auch die Belegschaft verändert, erzählen mehrere Zoogler. Man sehe in Zürich immer weniger «freie Elektronen», also «Google-Mitarbeiter, wie man sie sich vorstellt: Sie sehen ein Problem und lösen es», erzählt jemand. Die meisten seien heute so drauf: «Am Morgen rein, klare Aufträge bekommen und am Abend wieder raus.»
Das Cloud-Business ist nicht nur irgendein Google-Produkt, es symbolisiert auch den Wandel vom hippen Lifestyle-Service zur Corporate-Denke, vom Hoodie zu Krawatte. Trotz der Datenschutzskandale, die für Schlagzeilen sorgen, haben viele Software-Ingenieure die ursprüngliche Mission von Google verinnerlicht: «Die Informationen dieser Welt organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar machen.» Für sie hatte die «einfache» Userin mit ihren Bedürfnissen oberste Priorität, in der eigenen Wahrnehmung auch gegenüber zahlenden Werbekunden. Der Wandel hin zum Fokus auf Unternehmensprodukte behagt vielen Zooglern nicht.
Früher waren Mitbestimmung und Eigeninitiative für viele ein Grund, bei Google zu arbeiten. Dies hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert, wie sich bei der Google-Gewerkschaft zeigt. Ein Thema, über das kaum jemand offen sprechen will. Aus Angst vor Repressionen des Arbeitgebers.
Proteste von Zooglern kennt der Konzern nicht – ändert sich das bald?
Viele Big-Tech-Firmen wirtschafteten fast 20 Jahre lang unreguliert und ohne grosse rechtliche Leitplanken. Erst jetzt haben Politikerinnen aus den USA und der EU begonnen, Wettbewerbsregeln für das digitale Zeitalter aufzustellen und Datenschutzbestimmungen auch durchzusetzen.
Doch oftmals ziehen sich kartellrechtliche Verfahren oder Datenschutz-Gerichtsfälle über Jahre hin. Veränderungen innerhalb der grossen Konzerne geschehen daher fast nur durch Selbstregulierung. Etwa wenn sich Mitarbeiterinnen auflehnen und von innen gegen fragwürdige Projekte wehren. Nirgendwo trifft das mehr zu als bei Google. So geschah es zum Beispiel bei den umstrittenen Projekten «Maven» und «Dragonfly», die vom Google-Management in der US-Zentrale aufgrund des enormen internen Widerstands am Ende eingestellt worden sind.
Dragonfly war eine zensurkonforme Suchmaschine für Festlandchina. Maven ein gemeinsames Projekt mit dem US-Verteidigungsdepartement.
Die Projekte versetzten 2018 auch die Zürcher Google-Belegschaft in Aufruhr, wie mehrere Quellen bestätigen. Google wollte auf den chinesischen Markt drängen und dem Platzhirsch Baidu Marktanteile abjagen. Dafür entwickelte der Konzern eine Suchmaschine, welche die Zensurregeln Chinas einhält. Eine, die keine Resultate zum Suchbegriff «Tiananmen-Massaker» anzeigt. Weltweit protestierten Google-Mitarbeiterinnen dagegen, auch in Zürich, wie der «SonntagsBlick» recherchierte.
Wurde in Zürich an Dragonfly gearbeitet? Unklar. Auf diese Frage erhielten wir nur ausweichende Antworten. Das Know-how und die Projektteams wären vorhanden gewesen, bestätigen uns mehrere Quellen. Doch dass ein solches Projekt überhaupt zur Debatte stand, habe zu einer Politisierung des Personals beigetragen, sagen Zoogler, die an der Bildung der Google-Gewerkschaft indirekt beteiligt waren.
2018 kam auch noch ein anderes Problem in den Google-Offices ans Licht: Sexismus. An diversen Google-Standorten gab es gigantische Walk-outs. Auf Twitter sind auch Bilder mit Hunderten Protestierenden vor den Zürcher Büros zu finden. Der Grund für die Proteste: eine interne Kultur der sexuellen Belästigungen, wie die «New York Times» berichtete. Gab es diese Kultur auch bei Google Schweiz? Ja, wie ein Tweet von Kelly Ellis nahelegt, die wegen gender discrimination gegen Google klagte: Sie war auch am Standort Zürich belästigt worden. Ellis reagierte nicht auf die Anfrage der Republik.
Inspiriert von den weltweiten Bewegungen protestierender Tech-Arbeiter forderten auch die Zoogler mehr Mitspracherechte. Eine Gruppe wandte sich an die Gewerkschaft Syndicom. Das Ziel: die Gründung einer Google-Gewerkschaft. Obwohl das Zürcher Google-Management dies – wie Medienberichten zu entnehmen ist – verhindern wollte, stimmte die Belegschaft für die Schaffung einer Personalvertretung. Im Juli 2020 wählten die Zoogler ihr erstes Employee Representation Comittee.
Allerdings hat die Gewerkschaft bloss bescheidene Kompetenzen. Syndicom schreibt der Republik, die Rechte der Personalvertretung seien auf das gesetzliche Minimum beschränkt. Es sei vorgekommen, «dass der ERC [die Personalvertretung] Bedenken und Ideen zu mitarbeiterrelevanten Themen eingebracht hat, diese aber grossmehrheitlich ignoriert wurden». Immerhin, so schreibt Syndicom weiter und lässt damit tief blicken, habe die Personalvertretung den Vorteil, dass diese «die Stimme mit geringerer Angst vor Entlassung oder anderen Repressionen erheben» könne.
Was in vielen Gesprächen mit Zürcher Google-Angestellten deutlich wird, ist die einschüchternde Wirkung der «Hire and Fire»-Mentalität ihres Arbeitgebers und das eher schwache Schweizer Arbeitsrecht – besonders in Kombination mit dem Ausländerrecht. Nicht wenige Zoogler fühlen sich nur ungenügend geschützt. Und begehren auch deshalb nicht auf, weil Google den Aufmüpfigen oft direkt kündigt – und Mitarbeiterinnen damit auch das Aufenthaltsrecht in der Schweiz, das an den Arbeitsvertrag gekoppelt ist, verlieren.
Gerne hätten wir für diese Recherche direkt mit den Gewerkschaftern bei Google gesprochen. Trotz anfänglicher Bereitschaft erhielten wir eine Absage. Dieses Muster wiederholte sich unzählige Male sowohl bei aktuellen als auch bei ehemaligen Zooglern. Gerade mal knapp 30 Mitarbeiter waren bereit, mit uns zu sprechen, bis auf zwei wollte niemand mit Namen hinstehen, und manche liessen sich nicht zitieren, obwohl sie Google bereits vor einer Dekade verlassen haben. Grund dafür ist eine Abkürzung mit drei Buchstaben: NDA. Non Disclosure Agreements untersagen es Angestellten und Ehemaligen, über Google-Interna zu reden – sonst drohen Klagen.
Die Angst vor der Entlassung, vor Repressionen – sie war in den Gesprächen mit unseren Quellen stets spürbar. Für viele Angestellte in Zürich war ursprünglich das Beste an Google die Offenheit: Man wusste alles, was intern passierte, man konnte über alles intern diskutieren. Man hatte das Gefühl, gemeinsam und hoch motiviert an einem Projekt zu arbeiten, das allen das ganze Wissen der Welt zur Verfügung stellen wollte, sodass alle voneinander lernen können.
Diese Zeiten sind vorbei. Google hat auch intern einen guten Teil seines Glanzes verloren. Die «Don’t do evil»-Zoogler sind ruhiger geworden. Sie wurden zurechtgewiesen, eingeschüchtert, entlassen – oder sind selbst gegangen. Ein Zürcher Google-Mitarbeiter umschreibt es so: «Am Anfang [der internen Proteste] waren noch die Fighter hier, die ‹Don’t do evil›-Leute. Das hat sich geändert.» Heute kämen die Apolitischen, sagt ein ehemaliger Interaction Designer.
Das zeigte sich auch vergangenen September, als an diversen Google-Standorten ein weltweiter Aktionstag gegen das Project Nimbus stattfand, eine stark kritisierte Kooperation zwischen Google und Israels Regierung und Militär.
In Zürich war von Protesten nichts zu hören. Doch möglicherweise gibt es dafür bald wieder ein Momentum: Zurzeit laufen wegen der angekündigten Entlassungen Verhandlungen zwischen der Personalvertretung – mit Unterstützung der Gewerkschaft Syndicom – und dem Google-Schweiz-Management, wie uns mehrere Quellen bestätigen. Für viele Zoogler sind die Sparmassnahmen nicht hinnehmbar. Besonders Mitarbeitende mit russischer Staatsbürgerschaft, deren Aufenthaltserlaubnis in der Schweiz an ihre Arbeitsstelle bei Google gekoppelt ist, seien verunsichert.
Es organisiere sich gerade intern Widerstand, sagt uns ein Insider diese Woche. Und dann folgt der Satz, auf den wir in unserer Recherche immer wieder stossen: «Mehr darf ich dazu nicht sagen.»
Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik und dem Dezentrum, einem Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Ebenfalls für diese Serie arbeitete die Republik mit dem WAV zusammen, einem unabhängigen Schweizer Recherchekollektiv.
Balz Oertli arbeitete in den letzten Jahren in unterschiedlichen Funktionen als Journalist beim SRF. Seit diesem Jahr arbeitet er vollständig beim Recherchekollektiv WAV. Diese Recherche wurde von der Republik finanziert. Zusätzliche Unterstützung erhielten die WAV-Autoren von Investigativ.ch und Journafonds.
In einer früheren Version schrieben wir von laufenden Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Personalvertretung. Gemeint sind natürlich Verhandlungen zwischen Personalvertretung und Management. Vielen Dank für den Hinweis aus der Leserschaft.