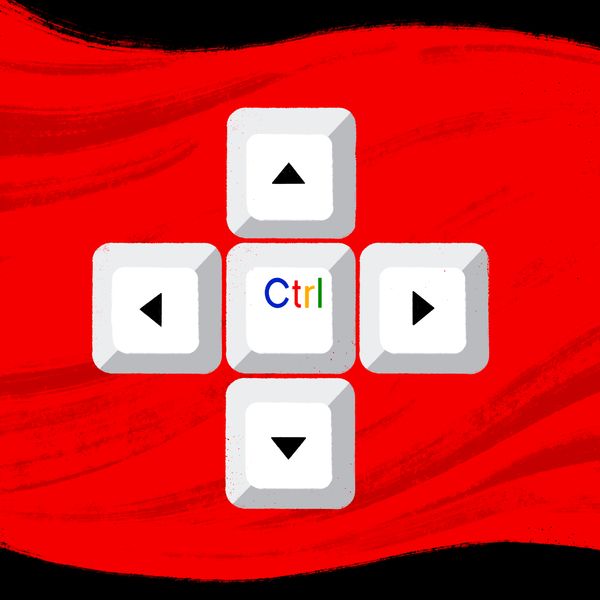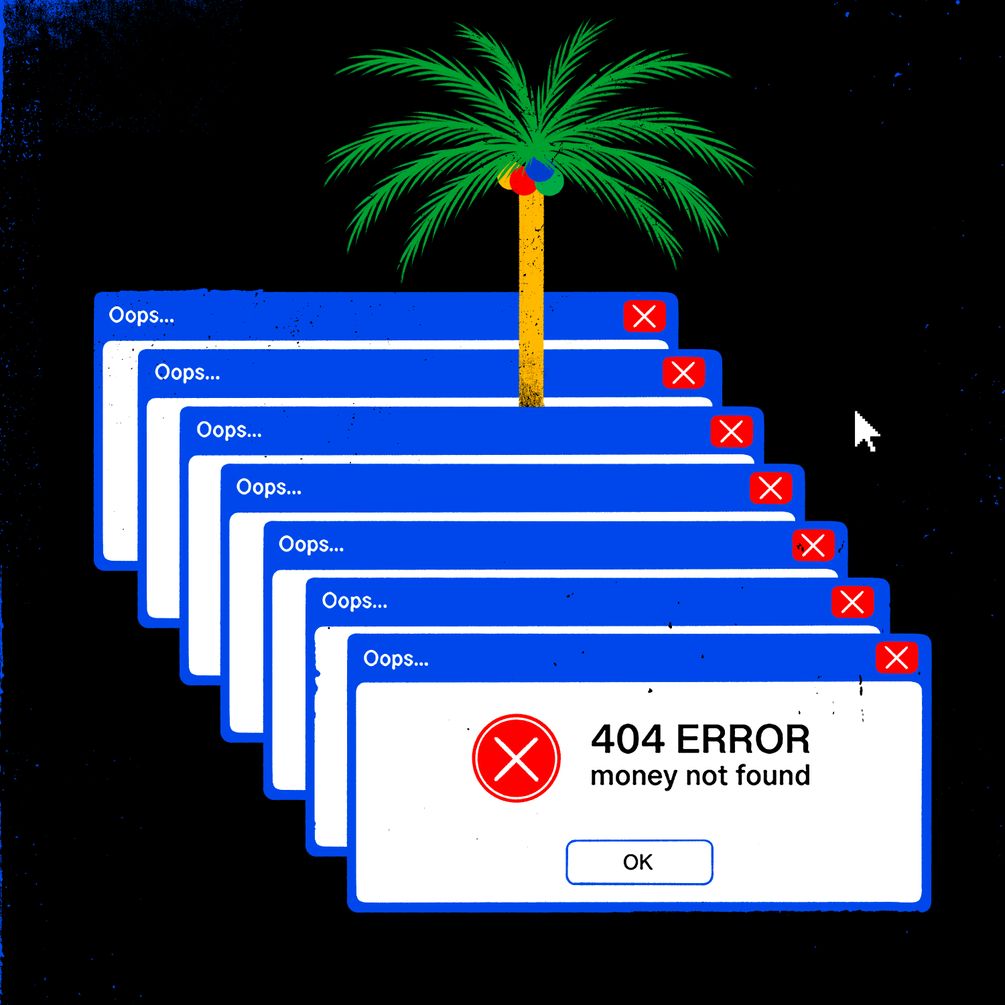
Gewinne maximieren, bis sie verschwunden sind
Milliarden verdienen und in Steuerparadiese transferieren: die britische Labour-Abgeordnete Margaret Hodge, der EU-Abgeordnete Paul Tang und ihr Versuch, das Geschäftsmodell von Big Tech zu zerschlagen. «Do not feed the Google», Folge 7.
Von Daniel Ryser, Ramona Sprenger (Text), Adrià Fruitós (Illustration), Kate Peters und Jussi Puikkonen (Bilder), 30.01.2023
Der Cyberspace ist die ultimative Offshore-Gerichtsbarkeit. Eine Ökonomie ohne Steuern. Bermuda in the sky with diamonds.
Die Infrastruktur, das Ökosystem, die guten öffentlichen Schulen: Das sind die Dinge, die man bei Google an der Schweiz liebe, sagte der damalige Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking im April 2022.
Was man bei Google auch liebt: die Milliarden, die man in Europa und in den USA verdient, durch Steuerschlupflöcher auf die Bermuda-Inseln zu transferieren.
2016 verschob Google 16 Milliarden in die Steueroase im britischen Überseegebiet. 2017 waren es 20 Milliarden. Im Jahr darauf 22 Milliarden. Und 2019 – bevor das Steuerschlupfloch Irland Ende 2020 schliesslich gestopft wurde – dann 75,4 Milliarden Dollar.
Serie «Do not feed the Google»
Der diskrete Überwachungsgigant: Wir zeichnen nach, wie der Google-Konzern zur Bedrohung für die Demokratie wurde – und die Schweiz zu seinem wichtigsten Standort ausserhalb des Silicon Valley. Gespräche mit Internet-Expertinnen aus den USA, den Niederlanden, Deutschland und Kanada. Zur Übersicht.
Folge 2
Vom ungehinderten Aufstieg zum Monopol
Folge 3
Die Entzauberung von Google
Folge 4
Wenn ethische Werte nur ein Feigenblatt sind
Folge 5
Half Google, einen Schweizer auszuspionieren?
Folge 6
Auf dem Roboterpferd in die Schlacht
Sie lesen: Folge 7
Gewinne maximieren, bis sie weg sind
Folge 8
Google und die Schweiz – eine Liebesgeschichte
Folge 9
Google im rot-grünen Steuerparadies
Folge 10
Inside Google Schweiz
Bonus-Folge
Podcast: Warum sind alle so verschwiegen?
Es war in England gewesen, wo die Steuerpraktiken von Google und den Starbucks und Amazons dieser Welt spätestens ab 2012 für grosses negatives Aufsehen gesorgt hatten. Einerseits dank Whistleblowern, die mit internen Dokumenten an Journalisten von Reuters herangetreten waren. Und dann dank Margaret Hodge, der damaligen Vorsteherin des Komitees für öffentliche Ausgaben des Vereinigten Königreichs, die zu diesen Whistleblowern Kontakt aufnahm und dann die Chefs der Konzerne zu öffentlichen Anhörungen lud, wie sie im Gespräch mit der Republik sagt.
«Google manipuliert absichtlich die Realität seiner Geschäfte, um nicht seinen gerechten Anteil an Steuern für das Gemeinwohl zahlen zu müssen», sagte Labour-Politikerin Hodge damals. Angesichts der Unterlagen, die einem zugespielt worden seien, sei die Lage eindeutig: Das Vorgehen von Google sei «kalkuliert und unethisch» und ziele einzig darauf ab, Milliarden Pfund an der englischen Unternehmenssteuer vorbeizutricksen. Google-Vizepräsident Matt Brittin wiederum sagte vor dem Ausschuss, trotz eines Jahresumsatzes von mehreren Milliarden Pfund tätige Google in England gar keine Verkäufe und schulde dem Land deshalb auch keine Steuern.
Als Lizenzgebühren auf die Bermudas geschleust
Paul Tang verschwindet vor dem Bildschirm im Dampf seiner E-Zigarette. Der niederländische Abgeordnete des EU-Parlaments und Sozialdemokrat ist in Brüssel Vorsitzender des Unterausschusses für Steuerfragen. Er war Mitinitiator einer Allianz aus Politikern und NGOs gegen das Ad Tracking, die sich zum Ziel gesetzt hatte, das Geschäftsmodell von Big Tech zu zerschlagen.
Das System dieser US-Unternehmen, Geld aus Europa herauszuschleusen, funktioniere praktisch genau gleich, sagt der Ökonom und EU-Steuerexperte. «Amazon hatte 2020 ein grossartiges Jahr. Es war Covid, alle kauften online, und ihr Umsatz schoss von 32 Milliarden auf 44 Milliarden Dollar hoch», sagt Tang. Europa aber habe von diesem Zuwachs nichts gesehen, weil die Unternehmen zusätzliche Kosten einführten in Form von Lizenzgebühren. «So auch bei Google: Selbst in Dublin bleibt kaum viel Geld liegen, weil es von dort weiterbewegt wird.»
«Nehmen wir das Beispiel Nike», sagt Tang. Diesen Fall kenne er im Detail. Wie Amazon und Google sei Nike ein US-Unternehmen. Die Art, wie das Geld ins Ausland transferiert werde, sei ziemlich identisch, man könne das System auch auf Google anwenden.
«Wie Google macht Nike in Europa den grössten Profit in Frankreich, in Deutschland und England. Das sind die grössten Märkte», sagt Tang. Von dort würden die Gewinne dann transferiert, bei Amazon nach Luxemburg, bei Google nach Irland und im Fall von Nike in die Niederlande: «Dorthin, wo die Firmen ihren europäischen Sitz haben.»
«Die Profite von Nike werden nicht in Deutschland oder in Frankreich verbucht, sondern in Holland», sagt der Niederländer. «Dieser Sitz, und so läuft das auch bei Amazon und bei Google, generiert wiederum selbst Kosten. Und zwar in Form von Lizenzgebühren für die Verwendung der Marke. Diese Marke ist als Tochtergesellschaft auf den Bermudas angesiedelt. Also transferiert das europäische Hauptquartier dieses Geld – als Kosten verbucht – ins Steuerparadies. Das ist der Grund, warum diese Unternehmen in Europa kaum Steuern bezahlen: Man führt zusätzliche Kosten ein und transferiert die Profite als Kosten auf die Bermudas. Das ist kein fairer Deal.»
In Frankreich habe der Staat deswegen gegen Google einen Rechtsstreit um über eine Milliarde Euro Steuerrückzahlungen verloren. Die Steuerbehörde wollte nicht akzeptieren, dass die französischen Profite als Verkäufe in Irland verbucht würden. «Google machte geltend, man habe keine physische Niederlassung in Frankreich, was wichtig ist, wenn man ein Unternehmen besteuern will. Und Google hat damit vor Gericht gewonnen», sagt Tang.
«Völlig und absolut und total unmoralisch»
Wir erreichen Margaret Hodge, die ehemalige Vorsteherin des Komitees für öffentliche Ausgaben, via Zoom-Call in London. Obwohl die öffentlichen Google-Anhörungen zehn Jahre her sind, braucht die Labour-Abgeordnete keine zwei Minuten, um in Fahrt zu kommen.
«Was mich wirklich, wirklich wütend macht, ist die Tatsache, dass diese Unternehmen, ob sie nun im Vereinigten Königreich oder anderswo tätig sind, für den Erfolg ihres Unternehmens von den Ergebnissen der öffentlichen Ausgaben abhängig sind. Sie brauchen gesunde Arbeitskräfte. Sie brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte. Sie brauchen eine Kommunikationsinfrastruktur, die gut funktioniert. Sie brauchen eine Verkehrsinfrastruktur. Dennoch weigern sie sich mit voller Absicht, einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der Dienstleistungen zu leisten, auf die sie dann angewiesen sind. Das ist völlig und absolut und total unmoralisch.»
Google sei eines von vielen Beispielen internationaler Unternehmen, «die finanzielle Strukturen geschaffen haben, die kein anderes Ziel haben, als die Gewinne in Gerichtsbarkeiten zu transferieren, die entweder sehr tiefe oder gar keine Steuern erheben», sagt Margaret Hodge.
Wir sprechen mit der Labour-Politikerin und ehemaligen britischen Arbeitsministerin über die Aussage von Google-Vizepräsident Matt Brittin, Google tätige in England gar keine Geschäfte – und schulde dem Land deswegen auch keine Steuern.
Die Unterlagen, sagt Hodge, die man 2012 von Google-Whistleblowern zugespielt und vom Comptroller and Auditor General of the United Kingdom – quasi der oberste Finanzprüfer für das Königreich – habe untersuchen lassen, hätten es eindeutig gezeigt: Google tätige seine Verkäufe tatsächlich in Britannien und nicht irgendwo sonst, wie das Unternehmen behauptet habe. «Und wenn man das tut, wenn seine Geschäftstransaktionen hier stattfinden, dann muss man auch hier seine Steuern zahlen», sagt Hodge. Einzig die Schlussrechnung der ganzen Geschäfte sei dann aus Irland geschickt worden.
Aber wie ist das möglich?
«Weil die Server in Irland stehen», sagt Hodge.
Wie geht das?
«Niemand von den Whistleblowern und Google-Kundinnen, die wir hier einvernommen haben, hatte das Gefühl, sie würden Geschäfte mit Google in Irland machen», sagt die Labour-Abgeordnete. «Der eine Google-Angestellte legte einen Verkaufsplan vor. Die andere Angestellte hatte einen Bonus wegen ihrer guten Verkäufe erhalten. Sie hatten also klare Verkaufsziele. Und wenn man mit den Anzeigenkunden sprach, war es dasselbe: Man traf sich in London, verhandelte in London, unterschrieb in London. Google suchte öffentlich nach Verkaufsangestellten in London. Sie hatten ein grosses Büro an der Tottenham Court Road, wo sie sich mit ihren Kundinnen trafen. Heute haben sie ein noch viel grösseres Büro an allerbester Adresse am King’s Court. Und selbst wenn man seine Rechnungen bezahlte, bezahlte man diese an eine Bank in England und nicht an eine Bank in Irland. Aber die Rechnung für die Dienste, die kam aus Irland. Und zwar ganz einfach eben deshalb, weil dort die Google-Server stehen. Das reicht der Steuerbehörde: Dort wo die Server stehen, dort zahlt Google die Steuern, obwohl jeder einzelne Geschäftsschritt in England abgewickelt wird. It’s completely bonkers, es ist komplett übergeschnappt.»
Erfand Google eine Protestbewegung?
Im Sommer 2022 wurde in Brüssel im Europäischen Parlament der «Digital Markets Act» verabschiedet, das Gesetz über die digitalen Märkte, das zusammen mit dem Gesetz über digitale Dienste Big Tech zumindest teilweise stark regulieren soll. Während der Konsultationsphase seien die Parlamentarierinnen mit Nachrichten von kleinen und mittleren Unternehmen bombardiert worden, das Gesetz abzuschwächen und das geplante Verbot von Ad Tracking zu streichen: Ohne dieses Ad Tracking könnten die KMU gar nicht überleben. «Wir wurden verfolgt, und zwar mit ebenjenem personalisierten Tracking, das wir verbieten wollen», sagt der niederländische Abgeordnete Paul Tang.
Nach der Abstimmung seien Indizien aufgetaucht, dass es diese Graswurzelbewegung der KMU, welche die rechte Ratsseite schliesslich dazu gebracht habe, gegen ein Trackingverbot zu stimmen, so gar nie gegeben habe. Sondern dass sie von Big Tech bezahlt worden war. Das Magazin «Politico» berichtete im Oktober 2022 mit Verweis auf Dokumente, die man habe einsehen können.
«Wir lassen untersuchen, ob Google während der Debatten zum ‹Digital Markets Act› in Brüssel Astroturfing betrieben und eine Protestbewegung erfunden hat», sagt Paul Tang. Astroturfing meint eine künstlich geschaffene Graswurzelbewegung, also gekaufte politische Stimmung, verdecktes Lobbying, was in Brüssel verboten ist.
Sebastiano Toffaletti, Generalsekretär der Europäischen Digitalallianz für KMU – des grössten KMU-Netzwerkes in Europa –, teilt offensichtlich die Einschätzung von Paul Tang, dass nämlich jene KMU, die sich für Google in Brüssel eingesetzt hatten, für ihr Lobbying bezahlt worden seien. Nach der Verhaftung der Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili im Dezember 2022 im Rahmen eines Korruptionsskandals twitterte Toffaletti: «Eva Kaili steht eindeutig in Verbindung mit mindestens zwei der ‹KMU- oder Start-up-Verbände›, denen eine Verbindung zu #bigtech vorgeworfen wird.»
Allein 2021 investierte Big Tech fast 100 Millionen Euro für Lobbying gegen die EU-Gesetze, die Big Tech regulieren sollen.
«Das Gesetz ist ein Kompromiss»
Die Gesetze über die digitalen Dienste beziehungsweise über die digitalen Märkte haben zum Ziel, die Marktmonopole von Big Tech einzuschränken und zum Beispiel die sogenannte Selbstbevorzugung zu verbieten und das Ad Tracking stark zu regulieren. Das Gesetz trat am 1. November 2022 in Kraft. Im Frühling 2023 wird die EU gemäss Tang eine Liste vorlegen, wer mit den Monopolisten, den sogenannten Gatekeepern, gemeint ist. Diese haben dann sechs Monate Zeit, sich dem Gesetz anzupassen.
Ein Smartphone mit dem Google-Betriebssystem Android wird in der EU dann nicht mehr automatisch den Google-Browser Chrome als Standardanwendung haben dürfen. Google wird nicht mehr Apple jedes Jahr mit vielen Milliarden Dollar bezahlen können, damit die Google-Suchmaschine auf den iPhones als Standard gilt. Amazon, Apple und Google werden die eigene Plattform nicht mehr dazu benutzen dürfen, eigene Produkte zu bevorzugen. Und auch die Nutzung persönlicher Daten zu Werbezwecken wird weiter reguliert: Wer einen Google-Dienst nutzt, soll bestimmen können, ob die anfallenden Daten mit den Daten aus anderen Google-Diensten kombiniert werden dürfen oder nicht.
Big Tech habe lange die Erzählung verbreitet, sie seien technologische Wunderkinder, man solle sie einfach machen lassen, sagt der Europaabgeordnete Paul Tang. Sie würden ja schliesslich die Welt verbinden. Zahlreiche Skandale hätten dieses Narrativ zerschmettert. Daraufhin habe Big Tech in Brüssel das Narrativ geändert: Das Ad Tracking sei essenziell für das Überleben kleiner und mittlerer Unternehmen. So habe sich schliesslich die Ratsrechte gegen ein Trackingverbot gestellt. «Die haben das neue Narrativ geschluckt. Alle lieben schliesslich KMU.»
«Der jetzige Gesetzesbeschluss ist ein Kompromiss», sagt der Ökonom. «Er schlägt zwar einen tiefen Keil in das Geschäftsmodell von Big Tech, weil sie nun ihre Datensätze begrenzen müssen, was für sie ziemlich schwierig ist. Aber wir wollten viel weiter gehen. Wir wollten ein komplettes Verbot des Ad Tracking. Wir werden dieses Ziel nicht aufgeben.»
Google und Facebook würden gemeinsam fast den kompletten Online-Anzeigenwerbemarkt kontrollieren und damit fast ihr ganzes Geld verdienen: Bei Facebook seien es 98 Prozent der Einnahmen, bei Google etwa 80 Prozent.
Am Ende stelle sich die Frage: Akzeptiere man, dass es im Markt Gatekeeper gebe und dass man mit Gesetzen einfach dafür sorgen müsse, dass diese ihre Marktmacht nicht missbrauchen würden? Oder es setze sich die Meinung durch, dass jemand nicht gleichzeitig Anbieter und Nutzer einer Plattform sein könne. Und dass man Big Tech zerschlagen und zwingen müsse, Geschäftsbereiche zu verkaufen, die mit den eigenen Kerndienstleistungen konkurrierten.
«Eine Bombe unter euch platzieren»
Die Labour-Abgeordnete Margaret Hodge sagt, sie habe aufgehört, Amazon zu nutzen. Bei Google sei das leider nicht möglich. Auch wenn das Beispiel für Amazon wie auch für Google stehe: «Ich kaufte bei Amazon ein Buch. Auf meiner englischen Seite, die amazon.co.uk heisst. Ich kaufte dieses Buch, bezahlte dafür mit meiner Kreditkarte in England. Das Paket erreichte mich mit der Briefmarke mit dem Bild der Queen. Geliefert wurde es vom Postboten, der für die englische Post arbeitete. Aber verbucht wurde der Gewinn in Luxemburg. Was für ein totales Desaster. Es ist ekelhaft, erschütternd.»
Auch mit den eigenen Steuerbehörden war Margaret Hodge in der ganzen Angelegenheit gar nicht zufrieden. Es könne ja nicht sein, dass es in einem Land, wo den normalen Bürgerinnen und Bürgern die Steuern automatisch mit dem Lohn abgezogen würden, für Schwerreiche und internationale Konzerne völlig intransparente Spezialregeln gebe. Und dass diese Unternehmen offenbar kaum Rechenschaft ablegen müssten, ganz im Gegensatz zu den Bürgerinnen und Bürgern, die penibel verfolgt würden. Bald habe man realisiert: Die Steuerbehörde hatte mit verschiedenen internationalen Unternehmen, mit Goldman Sachs beispielsweise, «Sweetheart-Deals» abgeschlossen, deren Inhalt nicht transparent war.
«Wir begannen, Fragen zu stellen», sagt Margaret Hodge. «Der Chef der Steuerbehörde verneinte, dass es solche Deals gegeben habe. Aber wir hatten einen Whistleblower. Ohne Whistleblower geht es nicht. Die Dokumente zeigten: Der Chef unserer eigenen Steuerbehörde hatte uns angelogen. Weitere Fälle kamen ans Licht. Wir realisierten: Das hat System. Und das führte uns schliesslich zu Google.» Der Steuerbehörde antwortete Hodge: «Am liebsten würde ich eine Bombe unter euch platzieren.»
Google sei clever, sagt Hodge. In England habe das Unternehmen die Politik regelrecht infiltriert, um seinen Ruf zu verbessern. Google habe parteiübergreifend viele ehemalige Politikerinnen oder Politikberater angeheuert. Und in den Sport investiert. Und in gute Zwecke. «Sie investieren eine riesige Menge Geld in private Projekte, um ihren Ruf aufzupolieren. Und natürlich nutzen sie dafür das Geld, das sie eigentlich verdammt noch mal versteuern müssten, um unsere öffentlichen Dienstleistungen mitzufinanzieren. Sie sind wirklich boshaft.»
Hunderte Millionen Pfund habe England durch die Tricksereien verloren. (Der «Independent» bezifferte die Zahl im Jahr 2017 auf 700 Millionen Pfund, die Google dem Vereinigten Königreich noch schulde.)
Das Thema war nach den öffentlichen Anhörungen im Jahr 2013 in England nicht mehr unter den Teppich zu kehren.
Der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich bezüglich Steuerrückforderungen derzeit mit einer 13-Milliarden-Euro-Strafe, die Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, 2016 gegen Apple wegen eines «Sweetheart-Deals» mit dem Tiefsteuerland Irland verhängt hatte. (Dieselbe Vestager war vom Magazin «Time» als «Googles schlimmster Albtraum» bezeichnet worden, nachdem sie den Konzern zweimal wegen Missbrauch seiner Marktstellung beziehungsweise wegen Selbstbevorzugung der eigenen Dienste zu Strafen von 2,42 Milliarden beziehungsweise 4,34 Milliarden Euro verurteilt hatte.)
Verschiedene europäische Länder, darunter Frankreich und das Vereinigte Königreich, führten 2020 eine Steuer auf das Unternehmenseinkommen ein. Das bedeutet: Egal, wohin die Tech-Giganten ihre Gewinne tricksen, um diese 3 Prozent «Digital Service Tax» kommen sie nicht herum. Das Vereinigte Königreich generierte damit im ersten Jahr Einnahmen von 430 Millionen Dollar. 90 Prozent davon seien von fünf grossen Unternehmen gekommen, darunter offenbar Google, Meta, Amazon und Ebay.
Das neue Steuerregime soll 2024 durch ein globales Steuerabkommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ersetzt werden. Es soll sicherstellen, dass Unternehmen wie Google oder Amazon ihren gerechten Anteil an Steuern in den Ländern bezahlen, in denen sie ihre Geschäfte tätigen.
«Der Trick dieser Unternehmen ist letztlich ziemlich simpel, aber man muss ihn eben durchschauen», sagt Margaret Hodge. «Die Steuerfachleute verwenden einen Fachjargon, um die Steuer als ein Mysterium darzustellen, das wir anderen nicht verstehen können. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Steuern uns allen gehören. Wir müssen es also alle verstehen können und ein Mitspracherecht haben. Das haben wir mit den öffentlichen Anhörungen geschafft. Wir haben die Debatte weg von den Fachleuten in die Cafés, in die Restaurants, in die Kneipen verlagert. Als ich mich mit dem Thema auseinanderzusetzen begann, sagte ein Akademiker in Oxford zu mir: Das ist viel zu kompliziert für dich, das verstehst du nicht, Margaret. Das war wirklich unerhört, ungeheuerlich.»
Die öffentlichen Anhörungen hätten geholfen, das Thema populär zu machen und sicherzustellen, dass Google mit ein paar schönen Worten und Sponsorings nicht wieder vom Radar verschwinde. «Viele Anhörungen kamen in den Nachrichten. Und das ist es letztlich, was wir Politikerinnen tun können und was auch gegen Google eine wirksame Waffe ist: die Stimme erheben.»
US-Republikaner und Demokraten vereint gegen Big Tech
«Diese Diskussion um die Zerschlagung von Big Tech und vom Verbot des Überwachungskapitalismus wird weiter an Fahrt aufnehmen», sagt der Niederländer Paul Tang. Nicht nur in der EU, sondern auch in den USA. Dort sei, angeführt vom republikanischen Staat Texas, eine Sammelklage von zehn Staaten gegen Google hängig, und zwar wegen Missbrauch des Marktmonopols zur Kontrolle der Preisgestaltung und Beteiligung an Marktabsprachen. Der Kampf gegen Big Tech sei einer der wenigen politischen Debatten in den USA, die bipartisan geführt würden, also parteienübergreifend.
So habe US-Präsident Joe Biden im Sommer 2021 Lina Khan zur Vorsitzenden der Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde (FTC) vorgeschlagen und schliesslich als solche ernannt. Lina Khan, eine Rechtsprofessorin an der Columbia-Universität, hatte 2017 eine Abhandlung mit dem Titel «Amazon’s Antitrust Paradox» publiziert – eine Antwort auf Robert Borks neoliberales Pamphlet «The Antitrust Paradox» von 1978, das den Boden legte für die Entfesselung von Big Tech.
Khans Abhandlung sorgte in den USA für Aufsehen in Juristenkreisen und wurde von der «New York Times» als «Neuausrichtung im Monopolrecht» bezeichnet, als Antwort auf Jahrzehnte neoliberaler Entfesselung. Das heutige Kartellrecht, das sich darauf konzentriere, die Verbraucherpreise niedrig zu halten, könne gegen die wettbewerbswidrigen Auswirkungen plattformbasierter Geschäftsmodelle nichts ausrichten, schreibt Khan. Die signifikante Monopolstellung von Amazon, Facebook, Google und Apple führe zu «weniger Innovation, weniger Auswahl für die Verbrauchenden und einer geschwächten Demokratie».
Joe Biden habe Lina Khan damals für das Amt vorgeschlagen, sagt der EU-Abgeordnete Paul Tang, «weil sie es als ihre Aufgabe sieht, Big Tech zu zerschlagen».
Kurz vor der Publikation dieses Artikels und einige Wochen nach dem Interview mit Paul Tang machte das US-Justizministerium ernst: Gemeinsam mit acht Bundesstaaten verklagte es Google wegen wettbewerbsfeindlicher und illegaler Methoden, mit denen sich der Konzern der Konkurrenz bei der Online-Werbung entledigen wollte. Ziel der Klage ist es, Google zu zerschlagen. Die Klage ist einer der wenigen Vorstösse, mit denen die Bundesregierung die Zerschlagung eines grossen Unternehmens fordert. Das letzte Mal geschah dies, als die Kartellbehörden in den Achtzigern das Telekommunikations-Konglomerat Bell Systems zerschlugen.
Google regulieren? Den Überwachungskapitalismus verbieten? Google zerschlagen? Aber ist das überhaupt möglich? Wo wir doch alle von Google abhängig sind?
Kartelle aufbrechen, Kompatibilität der Systeme erhöhen
Wir müssten «die Idee zurückgewinnen, dass wir das Digitale ohne den Überwachungskapitalismus haben können», sagte die emeritierte Harvard-Professorin Shoshana Zuboff 2019 dem «Guardian». Die Wirtschaftswissenschaftlerin hatte ebenjenen Begriff des Überwachungskapitalismus geprägt. Dieses Vorgehen erfordere die Empörung von Bürgerinnen, Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Gesetzgebern. Der Überwachungskapitalismus habe zwanzig Jahre lang fast völlig ungehindert schalten und walten können. Aber er sei noch immer sehr jung.
Jedes Mal, wenn sie öffentlich auftrete, frage sie in das Publikum, warum die Leute gekommen seien, welche Sorgen sie umtrieben, sagt Zuboff. Es seien immer dieselben Antworten: «Privatsphäre. Dystopie. Kontrolle. Monopol. Manipulation. Einmischung. Ausbeutung. Demokratie. Fehlinformation. Angst. Freiheit. Macht. Rebellion. Sklaverei. Widerstand.»
Der Journalist fragte, wie ein erfolgreicher Widerstand gegen Big Tech möglich wäre. «Regulierung», sagte Zuboff. «Das ist es, was die Technologieunternehmen am meisten fürchten.»
Sobald man Unternehmen einmal habe Monopole bilden lassen, sei es sehr schwer, sie zu zerschlagen, sagt der kanadische Computerwissenschaftler und Bestsellerautor Cory Doctorow – der Mann, der zu Beginn dieser Serie den Aufstieg der Big-Tech-Monopole nachgezeichnet hatte. «Kartellrecht ist langsam. Weil diese Unternehmen so viel Geld und Macht haben, um sich gegen die Durchsetzung von Antimonopolen zu wehren.»
Ein interessantes Beispiel sei IBM, sagt Doctorow: «Eine Art quasistaatliche Organisation in den Vereinigten Staaten, die so tief in den militärisch-industriellen Komplex der USA eingebettet war, dass sie als Teil der US-Regierung betrachtet wurde.» Als das US-Justizministerium 1970 schliesslich ein Kartellverfahren gegen IBM einleitete, habe IBM jedes Jahr mehr Geld für externe Kartellrechtsanwälte ausgegeben als das US-Justizministerium für all seine Fälle in all den zwölf Jahren des Verfahrens zusammen.
Als Ronald Reagan Präsident geworden sei, hätte das Ministerium die Klage fallen lassen. Aber die «zwölf Jahre kartellrechtliche Hölle» hätten dazu geführt, dass IBM beim Bau des ersten PC keine proprietäre Hardware verwendete, sondern handelsübliche Hardware, «die jeder kaufen konnte, sodass jede den PC klonen konnte».
«Wir müssen Kartellverfahren gegen Google und die anderen Unternehmen einleiten und sie aufbrechen», sagt Doctorow. Regulierungen wie das EU-Gesetz über die digitalen Märkte seien zwar ein Anfang, würden aber nicht weit genug gehen. «Wenn wir einen Interessenkonflikt haben, können wir nicht sagen: ‹Sie müssen versprechen, dass Sie Ihren Konflikt nicht missbrauchen werden.› Wir müssen sagen: ‹Diesen Interessenkonflikt darf es gar nicht erst geben.›»
Wie er das genau meine, fragen wir ihn.
Es müsse verhindert werden, dass die Big-Tech-Unternehmen überhaupt in Situationen kommen könnten, wo Selbstbevorzugung möglich sei. «Wir müssen sie zwingen, Geschäftsbereiche zu verkaufen, die mit ihren Kerndienstleistungen konkurrieren», sagt Doctorow. «Sie müssen wählen, ob sie eine Plattform sein wollen oder ob sie auf dieser Plattform verkaufen wollen.»
Zudem müsse man die Kompatibilität erhöhen.
«Nehmen wir als Beispiel Twitter und Mastodon», sagt Doctorow.
Die Tech-Industrie habe, als sie zur Macht aufgestiegen sei, Gesetze beeinflusst, welche die Kompatibilität massiv erschwert hätten. Was es den Leuten heute erschwere, einen Dienst zu wechseln.
«Stellen Sie sich vor, Sie könnten von Twitter zu Mastodon wechseln und einfach alle ihre Follower mitnehmen oder weiterhin mit ihnen kommunizieren: Es wäre ein No-Brainer», sagt der Computerwissenschaftler.
«Oder Sie könnten sich auf dieselbe Art zwischen Facebook und Google und einer Alternative entscheiden, die Sie nicht ständig ausspioniert.»
Cory Doctorow sagt, das wäre dann ein tatsächlicher Marktplatz mit Angebot und Gegenangebot. «Im Gegensatz zum heutigen Regime mit Apple, Facebook und Google, die einem, sobald man die Schwelle zu deren Geschäft übertritt, auf den Kopf schlagen, alles wegnehmen und sagen: ‹Oh, haben Sie denn nicht die Nutzungsbedingungen unter der Fussmatte gesehen?›»
Zur Serie «Do not feed the Google» und zur Co-Autorin
Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik und dem Dezentrum, einem Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Ebenfalls für diese Serie arbeitete die Republik mit dem WAV zusammen, einem unabhängigen Schweizer Recherchekollektiv.
Ramona Sprenger ist Interaction Designerin aus Zürich. Als Partnerin beim Think & Do Tank Dezentrum engagiert sie sich für eine nachhaltige Digitalisierung, bei der die Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Aktuell arbeitet sie für TA-Swiss an einer Publikation zu Blockchain und Kultur und baut mit Climate Ticker eine Plattform für offene, lokale Klimadaten und lokalpolitische Massnahmen auf.