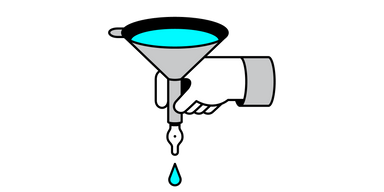
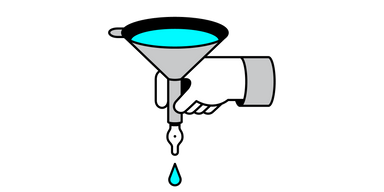
Weitere Detonationen auf der Krim, Dürre bedroht Rheinschifffahrt – und eine Öko-Katastrophe in der Oder
Woche 33/2022 – das Nachrichtenbriefing aus der Republik-Redaktion.
Von Christian Andiel, Reto Aschwanden, Elia Blülle, Cornelia Eisenach, Oliver Fuchs, Daniel Graf und Boas Ruh, 19.08.2022
Keine Lust auf «Breaking News» im Minutentakt? Jeden Freitag trennen wir für Sie das Wichtige vom Nichtigen.
Jetzt 21 Tage kostenlos Probe lesen:
Ukraine: Weitere Angriffe auf die Krim, Streit über EU-Visa für Russen
Das Kriegsgeschehen: Auf der russisch besetzten Krim ist am Dienstagmorgen ein Munitionslager in einer Militärbasis explodiert. Das russische Verteidigungsministerium spricht von einem «Sabotageakt». Auch Wohngebäude seien betroffen, 2000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Am Sonntag zerstörte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben das Hauptquartier der russischen Söldnertruppe Wagner im Donbass. Laut ukrainischen Aussagen wurden seit Kriegsbeginn mehr als 44’000 russische Soldaten getötet, überprüfen lässt sich diese Zahl nicht.
In der Gegend um die Stadt Cherson im Süden des Landes hat die ukrainische Armee gezielt Brücken und damit Nachschubwege der russischen Truppen zerstört. Das ist von strategischer Bedeutung: Über den Dnipro führen in dieser Region nur wenige Verbindungen – und ohne Nachschub bleibt den Russen nur der Rückzug. Das wiederum würde dem ukrainischen Militär bei der angekündigten Gegenoffensive in die Karten spielen. Begünstigt würde eine solche auch dadurch, dass die russische Marine laut dem britischen Geheimdienst derzeit kaum in der Lage ist, Odessa vom Meer her einzunehmen. Dadurch könnten die dort stationierten Soldaten der Ukraine in andere Gebiete verlegt werden.
Putin bekräftigte am Montag, das Ziel bleibe die Einnahme des Donbass: Die russische Armee erfülle in den «Volksrepubliken Donezk und Luhansk» ihre Aufgaben. Bei Artillerieangriffen in der Region Donezk kamen Anfang Woche mindestens drei Zivilisten ums Leben, zahlreiche wurden verwundet. Laut dem russischen Verteidigungsministerium starben bei Angriffen auf Gebiete in Cherson und Donezk mehr als 420 ukrainische Soldaten. Auch die zweitgrösste Stadt der Ukraine, Charkiw, wurde im Lauf der Woche wiederholt beschossen. Mehrere Menschen wurden getötet.
In Saporischschja wird das grösste Atomkraftwerk Europas weiter beschossen. Russland und die Ukraine weisen sich gegenseitig die Verantwortung dafür zu. Der ukrainische Präsident Selenski fordert, die russischen Truppen, die seit März dort stationiert sind, sollen aus der Anlage abziehen, und warnt, ein radioaktiver Zwischenfall würde auch EU-Staaten sowie die Türkei und Georgien treffen.
Die internationalen Entwicklungen: Am Dienstag ist der erste Getreidefrachter im Auftrag des Uno-Welternährungsprogramms aus dem ukrainischen Hafen Piwdenni ausgelaufen. Das Schiff bringt Weizen ans Horn von Afrika, wo Hunger herrscht. Der Frachter Razoni, das erste Schiff, das die Ukraine nach der langen Blockade verlassen hatte, ist diese Woche in Syrien eingetroffen. Laut der Uno ist seit Anfang August mehr als eine halbe Million Tonnen Getreide über das Schwarze Meer ausgeführt worden. Gemäss ukrainischen Angaben könnten im September insgesamt 3 Millionen Tonnen Getreide verschifft werden.
Verschiedene EU-Staaten streiten sich über Einreise-Einschränkungen für Russinnen. So wollen Finnland, Estland, Litauen und Polen die Visavergabe für den Schengenraum massiv einschränken oder haben es bereits getan. Deutschland hingegen lehnt generelle Einreisesperren ab. Kanzler Scholz möchte die Ausreise für Russen, die das Land verlassen wollen, «um der Diktatur in Russland zu entkommen», nicht verkomplizieren.
China schickt für eine gemeinsame Militärübung Soldaten nach Russland. Peking betont aber, das habe nichts mit der aktuellen Lage zu tun, sondern sei Teil einer seit Jahren laufenden, bilateralen Vereinbarung.
Am Donnerstag trafen sich in Lwiw Selenski, der türkische Präsident Erdoğan und Uno-Generalsekretär António Guterres. Bei den Gesprächen sollten unter anderem die Möglichkeiten eines Verhandlungsfriedens ausgelotet werden.
Rheinschifffahrt droht wegen Trockenheit auszufallen
Darum geht es: Der Pegelstand des Rheins sinkt, sinkt und sinkt. Aufgrund der seit Wochen anhaltenden Trockenheit führt der Fluss stellenweise so wenig Wasser, dass es für Transportschiffe zunehmend schwierig wird, ihre Waren in die Schweiz zu transportieren. In Kaub zwischen Mainz und Koblenz, wo das Wasser besonders flach fliesst, beträgt der Pegelstand (nicht die tatsächliche Flusstiefe, sondern das Mass für die Schiffbarkeit) nur noch 34 Zentimeter. Stellenweise ist der Pegel sogar bereits unter null gefallen. Um ihren Tiefgang zu verringern und den Rhein passieren zu können, müssen Lastkähne ihre Ladekapazität um bis zu 75 Prozent verringern. Sinkt der Pegel in den nächsten Wochen noch weiter, muss die Schifffahrt womöglich eingestellt werden.
Warum das wichtig ist: Der Rhein ist einer der wichtigsten Transportwege in die Schweiz – primär Erdöl, Rohmaterialien, aber auch Lebensmittel gelangen über den Fluss ins Land. Die Wasserknappheit führt nun dazu, dass sich die Transport- und folglich auch die Güterpreise massiv verteuern. Zusätzlich verschärft die verringerte Transportkapazität die ohnehin schon angespannten Lieferengpässe und die Energieknappheit.
Was als Nächstes geschieht: Das deutsche Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt geht davon aus, dass der Pegel bis Ende nächster Woche wieder etwas steigt. Meteorologen rechnen mit Regen. Eine längerfristige Entspannung der Situation brächte das aber nicht. Vergangene Jahre haben gezeigt, dass die Niedrigwasserphase bis in den Oktober andauern kann.
Attentat auf den Autor Salman Rushdie
Darum geht es: Am vergangenen Freitag ist der Schriftsteller Salman Rushdie bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem vermummten Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter war auf die Bühne gestürmt und stach vielfach mit einem Messer auf Rushdie ein. Mehrere Menschen aus dem Publikum eilten Rushdie zu Hilfe, sodass der Angreifer überwältigt und von der Polizei festgenommen werden konnte. Rushdie wurde per Helikopter ins Spital gebracht und operiert. Er erlitt schwere Verletzungen am ganzen Körper und im Gesicht, ist mittlerweile aber bei Bewusstsein und ansprechbar.
Warum das wichtig ist: Das Attentat hat eine lange Vorgeschichte. 1988 veröffentlichte Salman Rushdie den Roman «Die satanischen Verse», der dem Autor in Teilen der islamischen Welt Blasphemievorwürfe eintrug und massive Proteste hervorrief. Im Februar 1989 rief der iranische Machthaber Ayatollah Khomeini in Form einer Fatwa zur Ermordung Rushdies und aller an der Veröffentlichung des Buches beteiligten Personen auf. In der Folge kam es zu mehreren Attentaten und gewaltsamen Protesten, bei denen mehr als drei Dutzend Menschen ihr Leben verloren. Rushdie musste untertauchen und viele Jahre im Untergrund leben. (Zu den genauen Hintergründen lesen Sie hier unsere Einordnung.) Das iranische Regime hat die Fatwa nie offiziell widerrufen. In den letzten Jahren hielt aber auch Rushdie selbst die Gefahr für gebannt und trat öffentlich wieder ohne Polizeischutz auf. Nun spricht die Indizienlage dafür, dass der mutmassliche Täter, ein 24-jähriger US-Bürger mit familiären Wurzeln im Südlibanon, 33 Jahre nach Khomeinis Fatwa den Mordaufruf gegen Rushdie vollstrecken wollte.
Was als Nächstes geschieht: Der 24-Jährige wird sich vor der US-Justiz wegen versuchten Mordes zweiten Grades verantworten müssen. Vor einem New Yorker Gericht hat er auf «nicht schuldig» plädiert. Salman Rushdie befindet sich seiner Familie zufolge auf dem Weg der Besserung: Er werde bleibende, «lebensverändernde» Schäden davontragen, müsse aber nicht mehr künstlich beatmet werden und zeige bereits wieder seinen typischen kämpferischen Humor, schrieb sein Sohn Zafar am Samstag. Laut Informationen von CNN konnte Rushdie bereits mit den Ermittlern sprechen.
Grosses Fischsterben in der Oder
Darum geht es: Im deutsch-polnischen Grenzfluss Oder findet eine ökologische Katastrophe statt. Über 130 Tonnen Fischkadaver haben Helferinnen bereits geborgen. Auch Muscheln und Schnecken sind betroffen. Bekannt wurde die Umweltkatastrophe in Deutschland ab dem 9. August, doch bereits Ende Juli gab es Hinweise auf ein Fischsterben nahe der Stadt Oława, südöstlich von Wrocław (Breslau). Die deutschen Behörden erfuhren verspätet von den Hinweisen aus Polen, doch auch innerhalb Deutschlands verlief die Kommunikation schleppend.
Warum das wichtig ist: Das Fischsterben ist ein Schlag für das Ökosystem des Flusses. Noch ist nicht klar, inwieweit andere Tiere wie Insekten und Krebse betroffen sind sowie solche, die sich von Fischen ernähren, wie etwa Kraniche oder Fischotter. Auch ist unklar, inwiefern der Fluss chronisch belastet ist. Auf der politischen Ebene hat die Meldeverzögerung die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen belastet. Mittlerweile wurde eine Taskforce mit Expertinnen beider Länder gegründet, um die Ursachen zu ermitteln. Indizien sprechen dafür, dass das Gift der Alge Prymnesium parvum verantwortlich sein könnte. Sie kommt normalerweise im leicht salzhaltigen Brackwasser vor und konnte sich wohl aufgrund eines stark erhöhten Salzgehaltes, des warmen Wassers und der hohen Sonneneinstrahlung vermehren. Die Veränderungen gehen wahrscheinlich auf Industrieabfälle zurück, die in den Fluss eingeleitet wurden.
Was als Nächstes geschieht: Um zu verhindern, dass Fischkadaver in das Stettiner Haff und weiter in die Ostsee treiben, wurden Ölsperren errichtet. Die polnische Regierung hat 210’000 Euro Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zu den Verursachern der Verschmutzung führen.
Zum Schluss: Bitte mehr trinken (Alkohol, versteht sich)
Die Jugend Japans befindet sich auf Abwegen. Seit der Corona-Krise trinken die jungen Leute immer weniger Alkohol. Das dürfe so nicht weitergehen, findet die Regierung in Tokio. Denn mit dem sinkenden Alkoholkonsum schwinden auch die Einnahmen aus der Alkoholsteuer. Um den Staatshaushalt nicht trockenzulegen, gibt es nur eine Lösung, könnte man denken: mehr Sake. Deshalb sucht die japanische Steuerbehörde Ideen, wie der japanische Reisschnaps und andere Alkoholika wieder beliebter gemacht werden könnten. Falls Sie einen Vorschlag einreichen möchten, können Sie dies noch bis zum 9. September tun. Gesucht sind neue Produkte und Designs; Ideen, die das Trinken in den eigenen vier Wänden fördern – und explizit auch neue Verkaufsmethoden unter Verwendung von künstlicher Intelligenz und dem Metaversum. Na dann, Prost!
Was sonst noch wichtig war
Die Corona-Lage: Das Bundesamt für Gesundheit meldet 18’204 positive Tests, damit liegt der 7-Tage-Schnitt 5 Prozent unter jenem der Vorwoche. Zudem fielen weniger Tests positiv aus und auch die Zahl der Hospitalisierten ist gesunken. Grossbritannien hat als erstes Land einen weiterentwickelten Impfstoff von Moderna zugelassen, der auch gut gegen die derzeit zirkulierenden Omikron-Varianten schützen soll. In der Schweiz ist der Antrag auf Zulassung hängig.
Schweiz: Die Finanzmarktaufsicht (Finma) verlangt von der Krankenkasse CSS, dass sie Prämiengelder im Umfang von 129 Millionen Franken an ihre Kundinnen zurückbezahlt. Laut Finma hat die CSS Zusatzversicherten jahrelang überhöhte Kosten verrechnet.
Deutschland: Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat Israel bei einem Staatsbesuch in Deutschland vorgeworfen, «Holocausts» an den Palästinensern verübt zu haben. Die Empörung ist gross, auch gegenüber Bundeskanzler Scholz, der diese Äusserung, die bei einer Medienkonferenz in seiner Anwesenheit fiel, erst im Nachhinein verurteilte.
Türkei/Israel: Die beiden Länder wollen wieder volle diplomatische Beziehungen einrichten. Das Verhältnis war seit 2010 gestört, seit 2018 gab es keine Botschafter mehr im jeweils anderen Staat.
USA: Liz Cheneys Zeit im Repräsentantenhaus läuft ab. Bei den republikanischen Vorwahlen im Bundesstaat Wyoming verlor die Vizevorsitzende des Komitees, das den Kapitolsturm untersucht, sehr deutlich gegen die von Trump unterstützte Harriet Hageman.
Taiwan: Erneut hat eine Delegation von Abgeordneten des US-Kongresses das Land besucht. China startet als Reaktion umgehend neue Militärmanöver. Das US-Handelsministerium kündigte für den Herbst Gespräche über eine Vertiefung der Handels- und Investitionsbeziehungen mit Taiwan an.
Saudiarabien: Salma al-Schihab wurde zu 34 Jahren Haft verurteilt. Die Doktorandin und zweifache Mutter hatte auf Twitter unter anderem Aufrufe zur Freilassung von politischen Gefangenen geteilt. Menschenrechtler sehen das beispiellose Urteil als Drohbotschaft von Kronprinz Muhammad bin Salman.
Kenia: Der bisherige Vizepräsident William Ruto ist mit 50,5 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt worden. Vor der Bekanntgabe des Resultats gab es im Wahlzentrum Tumulte. Der unterlegene Oppositionsführer Raila Odinga will das Ergebnis anfechten.
Ecuador: Präsident Guillermo Lasso hat erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Zuvor waren bei einer Explosion mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das Land kämpft seit Monaten gegen eskalierende Bandengewalt.
Die Top-Storys
Was hätten Sie getan? Nach der Invasion wurde dem ukrainischen Präsidenten Selenski vorgeworfen, er habe die Gefahr heruntergespielt. War er naiv? Nein, sagt Selenski. Hätte er seine Landsleute früher gewarnt, wäre Panik ausgebrochen, «und dann hätten uns die Russen danach in drei Tagen überrannt». Was ging vor dem Krieg in den USA, Russland, den EU-Ländern und vor allem der Ukraine vor? Eine Recherche der «Washington Post» blickt hinter die Mauern der Regierungssitze.
Kamikazemission gegen Trump Liz Cheney ist Republikanerin, sie vertritt den stockkonservativen Bundesstaat Wyoming im Kongress. Doch damit ist bald Schluss: Diese Woche verlor sie erwartungsgemäss die parteiinternen Vorwahlen gegen eine Trump-treue Parteikollegin (siehe oben). Cheney ist die bekannteste Republikanerin, die sich öffentlich gegen Ex-Präsident Donald Trump stellt. Ihren Weg von der Politikerin, die Trump bei Abstimmungen einst zu 93 Prozent unterstützte, zeichnet «Liz Cheney’s Kamikaze Campaign» im «New Yorker» nach. (Paywall)
Vamos a la Playa Der Sommer macht gerade Pause, also holen wir uns das Ferienfeeling in die regensichere Stube. Eine Arte-Dokumentation blickt zurück auf die Italo-Disco, ein musikalisches Phänomen der 80er-Jahre, das nie ernst genommen wurde, nun aber sehr ernsthaft aufgearbeitet wird. Ein Wiedersehen mit Righeira, Gazebo und Sabrina.
Illustration: Till Lauer