
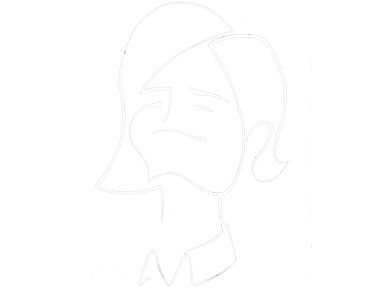
Ein Handbuch für Demokratie
Es fehlt heute nicht an Gründen, die globale politische Entwicklung pessimistisch zu betrachten. Man kann das aber auch anders sehen.
Von Daniel Binswanger, 04.06.2022
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Manchmal treffen Bücher, die von drohenden Gefahren sprechen, so frontal den Nerv der Zeit, dass ihre eigene Lancierung zunächst verunmöglicht wird. Ein tragisches Beispiel ist Michel Houellebecqs Roman «Unterwerfung», der in durchschaubar provokativer Absicht die Vision eines zur islamistischen Theokratie gewordenen Frankreichs entwirft – und genau am Tag des Terroranschlages auf «Charlie Hebdo» herauskam. Houellebecq sagte Lesungen und Medienauftritte fast gezwungenermassen ab. So sehr seine finstere Prophetie bestätigt zu werden schien, für eine Buchpremiere war es der falsche Moment.
Zu Zeiten des Russland-Ukraine-Krieges ist es nun ein politischer Essay, der am 1. April erschien und in den Medien nur sehr spärlich diskutiert worden ist: «Das grosse Experiment» von Yascha Mounk. Es ist nicht so, dass das Werk den russischen Neo-Imperialismus zum Thema hätte. Im Gegenteil: Es handelt von der Zukunft der Demokratie. Aber insofern als der Publizist und Dozent an der Harvard University die These entwickelt, dass dem demokratischen, liberalen Verfassungsstaat trotz aller Bedrohungen die Zukunft gehört; insofern er das Ideal der Demokratie nicht nur affirmiert, sondern sich auch hinsichtlich ihrer intakten Kraft und Durchsetzungsfähigkeit kämpferisch und optimistisch zeigt, kann «Das grosse Experiment» als Buch der Stunde gelten. Gerade weil für seine Lancierung nun alles andere als ein idealer Moment war.
Was Mounk mit seinem neuen Opus liefert, ist eine Art pragmatisches Handbuch für eine demokratische Zukunft. Es ist kein komplexes, akademisches Werk der avancierten Demokratietheorie, wie es Mounk andernorts vorgelegt hat. Es ist auch nicht primär eine Kritik der Fehlentwicklungen und Bedrohungen, denen liberale Verfassungsstaaten heute ausgesetzt sind – ihres «Zerfalls», wie Mounk es in einem Essay von 2018 formulierte. In «Das grosse Experiment» tut er beinahe das Gegenteil: Er versucht die Bedingungen zu analysieren, unter denen eine inklusive, liberale Demokratie auch in Zukunft prosperieren kann.
Seine Zuversicht versteht sich alles andere als von selbst. Luzide erscheint sie dennoch.
Mounk versucht ein paar Eckpfeiler einzuschlagen, ein paar Grundsatzfragen zu klären, etwas Übersicht zu schaffen. Wer sich von der Gewalt und der Wirrnis dieser Kriegszeiten gelegentlich überwältigt fühlt, der sollte dieses Buch lesen. Es liefert eine pragmatische Antwort darauf, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und weshalb der liberale Verfassungsstaat trotz allem gar nicht so schlechte Karten hat, diesen Kampf zu gewinnen.
Das Kernthema von «Das grosse Experiment» verrät bereits der Untertitel: «Wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert». Das ist gemäss Mounk die grosse Herausforderung unserer Zeit, der Grund, weshalb sich an so vielen Orten des Globus das Gefühl einer Krise der Demokratie einstellt, weshalb die Demokratie momentan eher auf dem Rückzug und der Autoritarismus auf dem Vormarsch ist.
Die «diverse Demokratie», wie Mounk es nennt, das heisst der demokratische Staat, der gleichberechtigte multiethnische, konfessionelle Gruppen und sexuelle Orientierungen umfasst, ist ein relativ neues Phänomen. Er stellt die Gesellschaft vor spezifische, neue Herausforderungen. Aber die diverse Demokratie bietet auch neue Chancen. Und hat sich insgesamt trotz aller Schwierigkeiten viel besser entwickelt, als wir es häufig wahrhaben wollen.
Historisch betrachtet, so Mounk, bleibt die diverse Demokratie bis heute ein Experiment. Typischerweise konstituierten sich frühe demokratische Gemeinwesen wie etwa das antike Athen oder die italienischen Stadtstaaten als homogene In-Groups, die kaum ethnische oder religiöse Diversität kannten. Die Vereinigten Staaten, als älteste moderne Demokratie, waren zwar immer ein ethnisch und konfessionell diverses Einwanderungsland, was aber einherging mit Sklaverei und extremen Formen von Diskriminierung. Erst in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts hat die Bürgerrechtsbewegung begonnen, mit dem Ideal einer multiethnischen Demokratie im vollen Sinne ernst zu machen.
Gleichzeitig begannen die europäischen Staaten, sich definitiv in Einwanderungsländer zu verwandeln, sodass ihr bis dahin stark auf demografischer und kultureller Homogenität beruhendes Selbstverständnis zunehmend obsolet wurde. Heute sind alle westlichen Staaten de facto zu «diversen Demokratien» geworden – auch wenn sie dieser Tatsache nur ungenügend gerecht werden. Das bleibt nicht ohne massive politische Folgen. Es funktioniert insgesamt aber dennoch besser, als es häufig den Anschein hat.
Grundsätzlich stellt Diversität für die Demokratie eine Herausforderung dar. Historisch betrachtet waren es Imperien, die Vielvölkerstaaten bildeten. Wenn die breite Bevölkerung an politischen Entscheidungen gar nicht erst beteiligt ist, führt die Diversität der verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch nicht zu politischen Problemen.
Für Demokratien hingegen wird es zur Herausforderung, wenn die gesellschaftlichen Konfliktlinien entlang identitätspolitischer Abgrenzungen verlaufen. Es drohen dann drei Fehlentwicklungen, die Mounk anhand von vielen konkreten Beispielen erläutert: Anarchie, Dominanz oder Fragmentierung.
Anarchie droht da, wo ethnische, tribale oder konfessionelle Konflikte schlicht zu einem failed state führen, wie Mounk etwa am Beispiel von Afghanistan darlegt. Momentan ist das Land unter der Gewaltherrschaft der Taliban geeint, aber es dürfte schon bald wieder in tribale und konfessionelle Faktionen zerfallen.
Dominanz ist die Funktionsstörung, die in stärkerer oder milderer Form alle demokratischen Staaten dieser Welt betrifft: Die Mehrheitsgesellschaft diskriminiert Minderheiten, denen eine abweichende Identität zugeschrieben wird oder die die Anerkennung einer abweichenden Identität aktiv einklagen. Demokratien beruhen auf dem Mehrheitsprinzip, und deshalb ist die Diskriminierung von Minderheiten durch die Mehrheit eine ständige, systemimmanente Gefahr. Sie wird dann ganz besonders akut, wenn identitätspolitische Mehrheitsverhältnisse sich umdrehen könnten, die Mehrheit – ob begründet oder unbegründet – sich also davon bedroht sieht, zur neuen Minderheit zu werden. In allen liberalen Demokratien unterliegen Minderheitenrechte deshalb einem besonderen Schutz – was natürlich aber nicht verhindert, dass Diskriminierungen das tägliche Zusammenleben in mehr oder minder starkem Mass beeinträchtigen können.
Schliesslich gibt es auch die Gefahr der Fragmentierung. Dieses Phänomen wurde phasenweise als demokratiepolitisches Ideal betrachtet, besteht ihr Grundgedanke doch darin, die institutionelle Macht nicht nur auf das Mehrheitsprinzip zu gründen, sondern alle relevanten Minderheiten permanent daran zu beteiligen. In einigen Ländern funktioniert das ausgezeichnet, etwa in den Niederlanden, in Österreich und natürlich in der Schweiz.
Der niederländische Politologe Arend Lijphart entwickelte in den 1960er-Jahren eine allgemeine Theorie dieser «Konkordanzdemokratie», die insbesondere zur Blaupause werden sollte für ehemalige Kolonien, die zu unabhängigen Staaten wurden. Als Vorzeigemodell galt der Libanon, wo die Macht zwischen Schiiten, Sunniten und Christen «konkordanzdemokratisch» geteilt wurde. Doch dann versank das Land in einem langen, blutigen Bürgerkrieg. Es sollte sich zeigen, dass «Konkordanzdemokratie» nur da funktioniert, wo die Machtfragmentierung durch sehr starke Kohäsionsfaktoren kompensiert wird.
Wie muss die Demokratie diesen systemischen Fehlentwicklungen entgegentreten? Mounk betrachtet den «philosophischen Liberalismus» als Grundvoraussetzung der diversen Demokratie: «Die Regierung (…) verfügt nicht über die moralische Autorität, den Menschen zu sagen, was sie denken, wen oder was sie anbeten oder wie sie ihr Privatleben gestalten sollen.» Er verteidigt den philosophischen Liberalismus insbesondere gegenüber den Theorien des Kommunitarismus. Minderheitenrechte müssen geschützt werden. Aber die Grundverpflichtung des Staates liegt immer im Schutz der Rechte seiner Bürgerinnen und nicht im Schutz der Gemeinschaften, denen sie angehören.
Letztlich muss dieser «philosophische Liberalismus» durch einen Grundsockel universalistischer Werte getragen werden. Und wie werden universalistische Werte zu einer gelebten Praxis? Hier hält Mounk ein überraschendes – und nuancenreiches – Plädoyer für den «Kulturpatriotismus».
Bei aller Diversität ist eine wenigstens in manchen Aspekten geteilte Alltagskultur die Klammer, die die Bewohnerinnen eines Landes miteinander verbinden kann. «Ich bin zu der Überzeugung gekommen», sagt Mounk, «dass Kulturpatriotismus ein wichtiger und weithin unterschätzter Bestandteil der Liebe zu einem Land ist. Diverse Demokratien, die darauf angewiesen sind, dass ihre Bürger ein echtes Gefühl von Solidarität empfinden, sollten ihn – ohne ihn von oben zu verordnen oder als Mittel des Ausschlusses zu missbrauchen – unumwunden willkommen heissen.»
Dass wir bei allen Differenzen mit unseren Mitbürgerinnen sehr viele Dinge teilen, ist die Grundlage der diversen Demokratie. Die Besonderheiten von Gruppenidentitäten anzuerkennen, ernst zu nehmen und zu schützen, ist enorm wichtig, sagt Mounk, aber man darf diese Gruppenidentitäten nicht «essenzialisieren», zu unverhandelbaren Zugehörigkeits- und Ausschlussmerkmalen machen.
Kultur ist auch deshalb ein Integrationsfaktor, weil sie wandelbar ist und sich auch ständig wandelt. Weil sie offen ist für alle Abschattungen, Übergänge, Hybridisierung. Wenn man heutige «Deutsche» nach ihrem Lieblingsessen befragt, rangieren Döner und Spaghetti sehr weit oben. Damit ist die kulturelle Identität der Bundesrepublik bestimmt nicht erschöpfend beschrieben. Es widerlegt auch nicht die Tatsache, dass kulturelle Traditionen immer wieder missbraucht werden, um Minderheiten auszuschliessen. Aber, so Mounk, es zeigt dennoch, dass kulturelle Appropriationen sich ganz von selber ständig vollziehen. Und dass wir das bejahen sollten.
Ein zentrales Anliegen von Mounks Analyse ist der Nachweis, dass sämtliche Demokratien zwar nach wie vor Diversitätsdefizite haben, dass die Fortschritte aber dennoch beachtlich sind. Die politischen Erfolge des Rechtspopulismus lassen immer wieder die Frage aufkommen, ob das Integrationspotenzial moderner Gesellschaften nicht an eine Grenze stösst und ob künftig nicht mit Rückschritten zu rechnen ist.
Mounk zeigt insbesondere für die USA, dass bezüglich Einkommensniveau und Bildungschancen die Unterschiede zwischen weissen Amerikanerinnen und People of Color zwar immer noch markant sind, sich aber sehr stark reduzieren. Hinzu kommt, dass «Mischehen» immer häufiger werden, die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen also zunimmt. In der amerikanischen Politik wird die identitätspolitische Polarisierung zunehmend wichtiger. Das muss aber nicht unumkehrbar sein. Es entspricht nicht der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
Wir leben heute in ethnisch, konfessionell, kulturell und genderpolitisch diversen Gesellschaften. Wenn unsere Demokratien tatsächlich davon überfordert sein sollten, werden autoritäre Modelle sich durchsetzen. Auch dafür ist Putins Aggressionskrieg ein unzweideutiger Reminder.
Ein nüchterner Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung zeigt die Schwierigkeiten, aber auch die Erfolge der diversen Demokratie. Das grosse Experiment kann weitergehen. Es gibt Anlass zur Hoffnung, dass es gelingt.
Illustration: Alex Solman