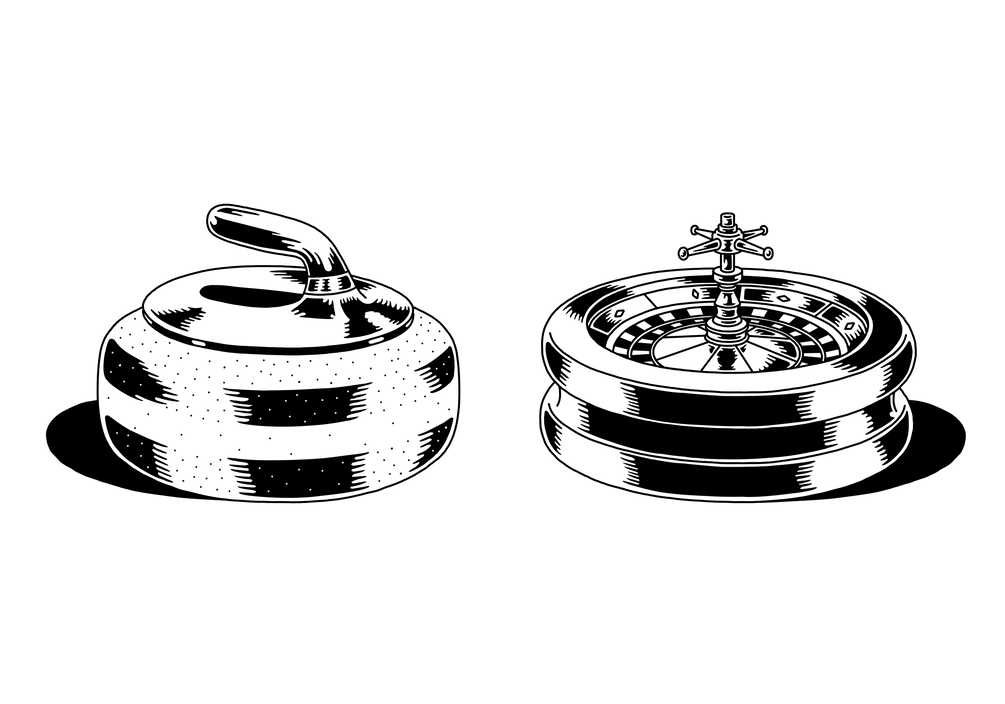
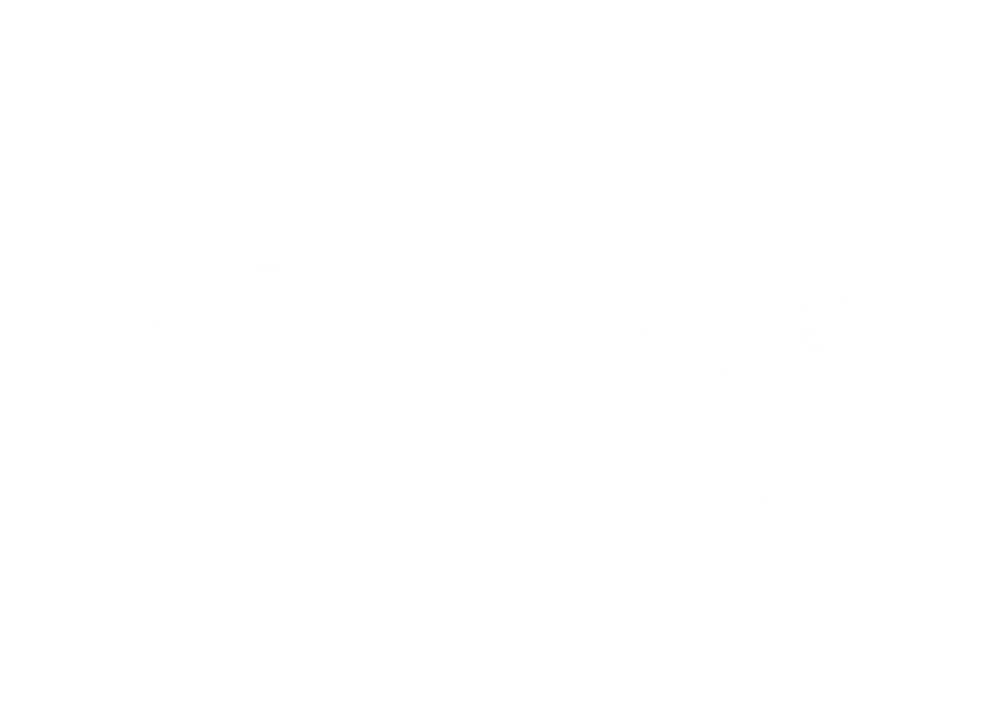
Das Ethos der Gnadenlosigkeit
Wir leben in einer Phase der Krisen und ideologischen Umbrüche. Und ein Begriff wird dabei immer wichtiger: Eigenverantwortung. Was hat das zu bedeuten?
Von Daniel Binswanger (Text) und Olivier Heiligers (Illustrationen), 16.04.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Kaum etwas hat so viel Macht über unser Zusammenleben wie die Leitbegriffe, mit denen wir darüber urteilen. Modifikationen des Sprachgebrauchs gehen häufig einher mit einschneidenden politischen Umwälzungen. Jetzt plötzlich, da wieder Krieg herrscht in Europa, stehen Wörter wie «Bewaffnung», «Verteidigungswille» und «Flüchtlingshilfe» hoch im Kurs – mit schwer zu ermessenden Folgen. Der Versuch zu verstehen, auf welche Welt wir zusteuern, sollte aber nicht darauf verzichten, ihren Zustand vor dem russischen Überfall zu reflektieren – umso mehr, als wir es mit einer schnellen Abfolge von epochalen Krisen zu tun haben. Auf welche Werte prallt die neue Militarisierung der internationalen Politik? In welche ideologischen Lücken stösst sie vor?
Vor dem Russland-Ukraine-Krieg kam Covid – und erschien seinerseits wie ein weltanschaulicher Wendepunkt. Besonders eine Diskursverschiebung, welche die Corona-Krise in der Schweiz gebracht hat, ist folgenreich und erklärungsbedürftig: die eigentliche Epidemie des Wortes Eigenverantwortung.
Pandemie-Rhetorik
Blenden wir zurück: Keine Medienkonferenz, keine Regierungserklärung ging über die Bühne, ohne dass der Begriff Eigenverantwortung im Zentrum gestanden hätte. «Wir erwarten Eigenverantwortung von allen»: So lautete zum Beispiel im Dezember 2020 die Kernaussage von Bundesrat Alain Berset im grossen Jahresrückblicksgespräch. «Nur mit Eigenverantwortung und Wahlmöglichkeit kann echter sozialer Zusammenhalt entstehen», sagte der Gesundheitsminister etwa zur Impfkampagne im letzten Sommer.
Eigenverantwortung war der Grundappell, den die Behörden an die Bürgerinnen richteten. Sie sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, glimpflich und mit nur milden Zwangsmassnahmen die Corona-Krise zu meistern. Sie sollte die weitgehende Zurückweisung durchgreifender staatlicher Anordnungen rechtfertigen und das Vertrauen auf die Vernunft der Bürgerinnen bekräftigen. Sie war das Gütesiegel der Schweizer Strategie.
Was immer Covid-19 sonst noch ausgelöst hat: Eigenverantwortung wurde als der tragende Grundwert affirmiert.
Das ist bei Licht betrachtet verblüffend – zunächst einmal, weil es so sachfremd ist. In der Republik wurde des Öfteren darauf hingewiesen und auch in zahlreichen anderen Publikationen: Über die richtige Kalibrierung von Massnahmen und den angemessenen Grad der Freiwilligkeit spezifischer Bestimmungen kann man legitime Debatten führen. Aber um Eigenverantwortung im eigentlichen Sinn geht es beim Umgang mit einer Infektionskrankheit per definitionem nicht.
Es ist im Fall einer Epidemie nun einmal nicht so, dass es, solange ich für allfällige negative Folgen auch die Konsequenzen trage, meiner individuellen Verantwortung überlassen werden kann, ob ich mich selbst gefährden will oder nicht. Das mag zutreffen, mindestens bis zu einem gewissen Grad, beim Helmtragen, beim Tabakkonsum oder beim Basejumping. Eine Epidemie jedoch ist dadurch charakterisiert, dass ich potenziell auch andere infiziere und durch mein Verhalten in Gefahr bringen kann. Für meine Mitbürgerinnen trage ich deshalb ebenfalls Verantwortung. An der Fürsorge für die Gesundheit meines Umfelds muss sich der Umgang mit der Ansteckungsgefahr deshalb ebenfalls ausrichten.
Dieses simple Argument ist immer wieder gemacht worden, und die Debatte braucht hier nicht wiederholt zu werden. Es kommt hinzu, dass die Schweizer Covid-Politik mit Eigenverantwortung de facto auch gar nie viel zu tun hatte. Es wurde zwar ein relativ liberales Massnahmenregime praktiziert, aber das bedeutete nicht, dass die Behörden für die Folgen der Pandemie gegenüber betroffenen Bürgern nicht die Verantwortung übernommen hätten – weder im Bereich der wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, wo phasenweise schnelle und unbürokratische Hilfen gesprochen wurden; noch im Bereich der gesundheitlichen Schäden, wo die Forderung, Ungeimpfte sollten selber für Hospitalisierungen verantwortlich gemacht werden und die Kosten tragen, zwar vereinzelt erhoben, aber nie ernsthaft diskutiert wurde.
Es stellt sich jedoch eine andere, viel grundsätzlichere Frage: Weshalb dann der flächendeckende Appell an die Eigenverantwortung? Weshalb dieses seltsame Wording? Aus welchem Grund hat die Eidgenossenschaft einen Kategorienfehler zur Staatsräson erhoben?
Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass zwar befremdlich erschien, wie ausgerechnet in einer Pandemie die Eigenverantwortung zum Leitsatz erhoben wurde, dass dies den Terminus aber nicht im Geringsten daran gehindert hat, Konsenskraft zu entfalten. Man hätte auch von «gemeinsamer Anstrengung», von «freiwilliger Rücksicht auf die Gefährdeten» oder ganz einfach von «Verantwortung» sprechen können. Das haben die Behörden am Rande auch getan, aber im Zentrum stand immer die Eigenverantwortung.
Man darf davon ausgehen, dass diese Strategie nicht das Ergebnis einer banalen Fehlanalyse, sondern vielleicht sogar der Ausdruck von Kommunikationskompetenz gewesen ist.
Die Verantwortlichen zählten offenbar darauf, dass Eigenverantwortung als Mobilisierungsformel alle anderen Alternativen schlägt. Dass der Begriff verpflichtender ist als «freiwillig». Volksnäher als «Solidarität». Vermittelbarer als nackte «Verantwortung». Ist Eigenverantwortung inzwischen unser höchster Tugendbegriff geworden? Die durchschlagendste aller Pathosformeln? Die behördliche Corona-Kommunikation legt diesen Schluss zumindest nahe.
Ein verblüffender Sonderfall
Was also hat es auf sich mit diesem Konzept? Weshalb kann es eine solche Appell-Funktion erfüllen? Die Frage stellt sich nicht nur vor dem Hintergrund der Pandemiebewältigung. Eigenverantwortung zeichnet sich aus durch eine Reihe frappierender Eigenheiten: Zunächst erscheint ihre Dominanz wie eine Besonderheit des politischen Diskurses in der Schweiz. Deutsche oder österreichische Politikerinnen benutzen den Begriff deutlich weniger. Selten einmal tauchte er in einer Merkel-Rede auf, etwa als sie im Jahr 2015 mit Bezug auf die Eurokrise sagte: «Solidarität und Eigenverantwortung sind wieder zwei Seiten einer Medaille.» Selbst im Programm der deutschen FDP – der liberalen Partei, die zu dem Konzept im Prinzip eine besondere Affinität haben sollte – spielt Eigenverantwortung nur am Rande eine Rolle. Im neuen «Leitbild-Update» taucht der Begriff erst gar nicht auf.
In Österreich mag die Situation schon etwas anders sein, wo die Neos sich die Eigenverantwortung recht prominent auf die Fahne schreibt. Aber die Neos kam bei den Nationalratswahlen 2019 auf 8 Prozent der Stimmen. Was für ein Gegensatz zur Schweiz, wo sowohl die FDP als auch die SVP permanent mit Eigenverantwortung argumentieren. Oder wie heisst es doch so schön am Anfang der «Vision» der FDP, die 2018, also noch lange vor der Pandemie, von der Parteipräsidentenkonferenz verabschiedet wurde und den Titel «Unsere Schweiz – unsere Heimat» trägt: «In der Schweiz übernimmt jede und jeder Eigenverantwortung.» Eigenverantwortung erscheint hier beinahe wie der Kerngehalt des helvetischen Nationalstolzes.
Nicht weniger markant ist die Zunahme der Häufigkeit von «Eigenverantwortung» im öffentlichen Diskurs. In den zwei Jahren vom Februar 1998 bis zum Februar 2000 gibt es in der Schweizer Mediendatenbank für «Eigenverantwortung» 1650 Treffer. Für dieselbe Periode zehn Jahre später sind es bereits 3950 Treffer. Noch einmal zehn Jahre später, von 2018 bis 2020, steht der Zähler bei 6500. Und dann kommt Corona, und es gibt kein Halten mehr: Für den Zeitraum von Februar 2020 bis Februar 2022 kommt die Mediendatenbank auf rund 22’300 Treffer. Die «Eigenverantwortung» explodiert.
Es liegt hier also eine sehr frappierende Schweizer Eigenheit vor, und man wird davon ausgehen dürfen, dass sie keine blosse Frage des Sprachgebrauches ist. Schliesslich rührt der Begriff der Eigenverantwortung an die ideologischen Grundfesten der politischen Debatte. Er ist eines der wichtigsten Schlagworte, mit denen eine bestimmte Gesinnung markiert wird, so wie etwa auch mit dem Slogan «freie Wirtschaft» und «Kostenwahrheit» oder, im politischen Gegenlager, mit «Solidarität» und «Gerechtigkeit».
In dieser Funktion bezeichnet Eigenverantwortung eine rechte, sei es eine konservative, sei es eine liberale politische Position. Sie steht für eine Haltung in der permanenten Auseinandersetzung, wie weit der Staat durch Umverteilung für das materielle Wohlergehen bedürftiger Bürger zuständig sein soll und wie weit dieses der Zuständigkeit der Betroffenen überlassen bleiben muss. Sie signalisiert zudem, dass in allen Lebensbereichen die freiwillige individuelle Gestaltungsmacht der gesetzlichen Regulierung vorzuziehen sei.
Aber der Begriff der Eigenverantwortung steht nicht nur für ein Grundbekenntnis zu «rechten» Politikrezepten, er leistet etwas Grundlegenderes.
Er artikuliert eine bestimmte Wertehaltung: Dass jeder und jede ihres eigenen Schicksals Meister sei; dass in freie Selbstentfaltung möglichst nicht eingegriffen werden soll; dass deshalb aber auch jede und jeder für die Folgen seiner individuellen Entscheide, Leistungen und Lebensgestaltung die Konsequenzen zu tragen habe. Das Prinzip der Eigenverantwortung ist die Grundlage eines Ethos, das über simple Positionsmarkierungen im politischen Links-rechts-Spektrum hinausgeht.
Beschreibt dieses Ethos inzwischen so etwas wie einen diffusen gesamtgesellschaftlichen Konsens? Ist das der Grund, weshalb Eigenverantwortung heute, wenn die Nation in eine Jahrhundertnotlage gerät, plötzlich auch eine parteienübergreifende Appellfunktion erfüllen kann? Es versteht sich nicht von selbst, dass ein sozialdemokratischer Gesundheitsminister mit ihrer unablässigen Beschwörung zum beliebtesten Politiker des Landes wird. Jedenfalls stellt es eine politsemantische Abnormität dar, wenn ausgerechnet ein Schlagwort, das als einer der gängigsten politischen Kampfbegriffe gelten kann, in einer Krise völlig problemlos zum Banner wird, hinter dem die ganze Nation sich scharen soll. Ist Eigenverantwortung inzwischen der Grundwert, den wir de facto alle teilen, auch wenn es in der Hitze des politischen Tagesgeschäfts normalerweise nicht manifest wird?
Diese Frage stellt sich umso dringlicher, als der inflationäre helvetische Gebrauch des Wortes zwar eine Ausnahmeerscheinung darstellt, das Konzept der Eigenverantwortung aber nicht nur in der Schweiz, sondern in allen westlichen Demokratien über die letzten dreissig, vierzig Jahre massiv an Terrain gewonnen hat.
Im Englischen gibt es für Eigenverantwortung zwar kein eigenes Substantiv, aber der Sinn, wie der Begriff der responsibility verwendet wird, hat sich über die letzten Jahrzehnte grundlegend verändert. Immer häufiger bezeichnet responsibility nicht mehr die Verantwortung, die wir für andere, sondern die Verantwortung, die wir für uns selber übernehmen. Nicht selten wird sie dann zur personal responsibility. Mit dem Richtungssinn ändert sich ganz grundlegend die Bedeutung – nur das Wort bleibt dasselbe.
Etwas Ähnliches lässt sich in anderen Kulturräumen beobachten, etwa in der frankofonen Welt, wo responsabilité immer häufiger im Sinne der responsabilité individuelle verstanden wird – wobei individuelle Verantwortung dann so viel besagt wie Eigenverantwortung. Etwas Grundsätzliches ist ins Rutschen gekommen.
Die Kultur der Eigenverantwortung
Auf ganz besondere Weise dominiert das Ethos der Eigenverantwortung zwar die Schweizer Debatte; da der Siegeszug der neuen responsibility jedoch ein globales Phänomen ist, kommt die wohl profundeste Analyse, die man heute zu dem Thema lesen kann, aus den USA.
Es handelt sich um das bisher nur auf Englisch erschienene «The Age of Responsibility» von Yascha Mounk, das 2017 bei der Harvard University Press publiziert wurde und dessen Titel man mit «Das Zeitalter der Eigenverantwortung» übersetzen kann. In gewisser Weise ist es eines der erhellendsten Bücher für das Verständnis des heutigen politischen Diskurses in der Schweiz – obwohl die Schweiz darin kein einziges Mal erwähnt wird.
Mounk entwickelt eine Analyse der ideologischen Umwälzungen, die sich in den westlichen Demokratien seit dem Ende des Kalten Krieges vollzogen haben – während jener Periode, die in der Regel unter den Stichworten «Globalisierung» oder «Neoliberalismus» abgehandelt wird. Er schlägt jedoch einen anderen Zugang vor. Im Zentrum der Entwicklung stehen aus seiner Sicht nicht nur neue sozialstaatliche und wirtschaftspolitische Präferenzen – zum Beispiel eben die «neoliberale Agenda» –, sondern eine Wertehaltung, die sich grundsätzlich gewandelt hat: das Ethos der Eigenverantwortung, das eine immer umfassendere gesamtgesellschaftliche Konsensfähigkeit erlangt und unsere Epoche prägt. Und, so muss man aus helvetischer Perspektive wohl hinzufügen, immer expliziter zum Siegel des Schweizer Politikverständnisses zu werden scheint.
Ermöglicht wurde der Siegeszug der Eigenverantwortung gemäss Yascha Mounk, weil ihre Grundwerte inzwischen sämtliche politischen Lager hinter sich scharen. Am deutlichsten zeigt sich das wohl dort, wo man es nicht erwarten würde, jedenfalls nicht von Vertreterinnen des linken Lagers: in der Sozialpolitik.
Die Rechte versucht im Namen der Eigenverantwortung den Sozialstaat zu verkleinern und die Umverteilung zu begrenzen. Immer stärker hat sie seit den Achtzigerjahren dabei auf den Appell der Eigenverantwortung gesetzt. «Es ist Zeit, dass das amerikanische Volk dem Grundsatz wieder Geltung verschafft, dass jedes Individuum verantwortlich für sein Handeln ist», sagte Ronald Reagan in einer seiner berühmtesten Reden.
Die Linke, die dem Rückbau des Sozialstaates defensiv gegenübersteht, verfolgte im Prinzip eine diametral entgegengesetzte Agenda. Allerdings hat der Sozialliberalismus des sogenannten dritten Weges von Clinton, Blair oder Schröder in den Neunziger- und Nullerjahren genau durch das Bekenntnis zur Eigenverantwortung seine Mehrheitsfähigkeit gefunden. Die Sozialhilfereform, die das wichtigste Projekt der ersten Clinton-Präsidentschaft war, trug den Begriff der personal responsibility sogar im Titel. «Eine Formel [die Eigenverantwortung], die ihr Leben als politisches Schlagwort begonnen hat, ist nach und nach zu einem kulturellen Phänomen geworden», sagt Mounk. Die offensive Rhetorik des dritten Weges ist heute zwar Geschichte beziehungsweise findet ihren Widerhall nicht mehr in der traditionellen Sozialdemokratie, sondern in einer neuen progressiven Mitte, die in Frankreich etwa von Emmanuel Macron oder in der Schweiz von der GLP repräsentiert wird. Geblieben jedoch ist die Kultur der Eigenverantwortung.
Die Strategie, die sozial Schwachen davor zu schützen, für ihre Notlage selber verantwortlich gemacht zu werden, besteht deshalb nicht mehr darin, dass die Linke das Prinzip der Eigenverantwortung im Grundsatz in Zweifel zieht. Stattdessen versucht sie, für spezifische Gruppen die Schwelle zu erhöhen, die genommen werden muss, damit Empfängerinnen von staatlicher Hilfe für ihre Lage selber verantwortlich gemacht werden können. «Die moralische Prämisse, dass die Verantwortung eines Individuums für seine Situation seinen Anspruch auf Hilfe untergräbt, wird heute weitgehend geteilt», schreibt Mounk. «Viele linksgerichtete Politiker und viele dem Egalitarismus verpflichtete politische Philosophen haben sich deshalb mit dem Zeitalter der Eigenverantwortung arrangiert, indem sie die Anforderungen erhöht haben, die erfüllt sein müssen, damit wir jemandem die Verantwortung für seine Handlungen oder seine Lebenslage zuschreiben können.»
Die Linke sagt heute im Grunde nicht mehr: Wir wollen sozialen Ausgleich und es ist letztlich irrelevant und ohnehin schwer messbar, inwieweit die Unterprivilegierten an ihrer Misere selber schuld sind. Stattdessen bestreiten die Vorkämpfer des sozialen Ausgleichs, dass Bürgerinnen, die Unterstützung bekommen sollen, ihre Notlage selber verschuldet haben. Zu ihrer Verteidigung muss heute auf dem Opferstatus von Bedürftigen insistiert werden. Letztlich haben in dieser Logik nur noch Opfer – das heisst Menschen, die für ihr Unglück selber nicht verantwortlich gemacht werden können – Anspruch auf gesellschaftliche Solidarität.
Das ist ein einschneidender Paradigmenwechsel. Der traditionelle Emanzipationsdiskurs vermittelte der Unterschicht: Ihr seid fähig, aber ihr werdet ausgebeutet. Die heutige Linke hingegen vermittelt mindestens implizit die Botschaft: Ihr seid unfähig, habt deshalb aber Anspruch auf Hilfe.
Mehr und mehr liegt der Preis für die Solidarität mit den sozial Schwachen darin, dass man ihnen de facto die Handlungsfähigkeit (agency) absprechen muss. Natürlich ist es die unbestrittene Kernambition von linker Politik, ganz besonders von jüngeren identitätspolitischen Bewegungen, Benachteiligte zu ermächtigen, ihnen nicht nur Hilfe zukommen zu lassen, sondern auch ihre Verantwortlichkeit anzuerkennen, zu fördern, zu betonen. Empowerment ist das oberste Ziel – wird aber im Rahmen der Kultur der Eigenverantwortung ein sehr widersprüchliches Unterfangen. Wer für seine Notlage selber verantwortlich ist, kann Ansprüche eigentlich nicht mehr geltend machen.
Es ist stattdessen der Rechtspopulismus, der mindestens gewissen Teilen der Unterschicht die Botschaft vermittelt: Ihr wärt eures Schicksals eigene Herren, aber ihr werdet um eure Macht betrogen. Wir erkennen eure Fähigkeiten vorbehaltlos an, wir verhelfen euch zu neuer Grösse. Und der mit dieser Ansage die traditionelle Linke erfolgreich in Bedrängnis bringt.
So weit die politische Wirkungsmacht des neuen Ideals der Eigenverantwortung. Woher aber kommt eigentlich der Siegeszug der Idee, das wichtigste gesellschaftliche Organisationsprinzip bestehe darin, dass jeder für sein eigenes Schicksal geradesteht? Blenden wir kurz zurück.
Schluss mit den Opfern
Verantwortung war schon immer ein zentraler Begriff der politischen Debatte, aber in den Achtzigerjahren begann er seinen Sinn zu ändern. Interessanterweise war Verantwortung als «Verantwortung für meine Mitbürgerinnen» oder als «Verantwortung als Pflicht» ein wichtiger Bestandteil der Mobilisierungsrhetorik im Kalten Krieg. Es wurde ständig daran appelliert, dass jeder einzelne Bürger Verantwortung für die Abwehr der totalitären Gefahr, für die Verteidigung der Freiheit und damit für das Wohlergehen der Gemeinschaft zu übernehmen habe.
«Freiheit ist nie mehr als eine Generation von der Auslöschung entfernt», warnte etwa Ronald Reagan als kalifornischer Gouverneur in den Sechzigerjahren. Das konnte nur bedeuten: Alle waren gemeinsam dafür verantwortlich, die Freiheit zu verteidigen.
Der Kalte Krieg war ein permanenter kollektiver Solidaritätseffort – zum Schutz der individuellen Freiheit. Es gab eine kollektive moralische Verpflichtung, die nachzuvollziehen uns heute schwerfallen mag – auch wenn wir aktuell gerade eine mächtige, (fast) alle Parteien übergreifende Welle der Solidarität mit der Ukraine erleben, die ein längst verschüttet geglaubtes Mobilisierungspotenzial aus den Hochzeiten des Kalten Krieges zu aktivieren scheint. Plötzlich ist wieder Opfermut gefragt, Verantwortung nicht für uns selbst, sondern für andere, für die Freiheit, die Demokratie, bedrohte Bürgerinnen aus Osteuropa. Nicht umsonst erleben wir diese beispiellose, den halben Globus umspannende Mobilisierung als Rückkehr in den Kalten Krieg.
«Wofür ich mich einsetze, ist eine freie und verantwortungsbewusste Gesellschaft», sagte in den Achtzigerjahren etwa auch Englands Premierministerin Margaret Thatcher. Auch aus ihrem Verantwortungsbegriff spricht noch das Pflichtbewusstsein der Kalten Kriegerinnen. Zu Zeiten der Systemkonkurrenz zwischen Kommunismus und Kapitalismus konnotierte politische Verantwortung immer auch ein Pflichtbewusstsein und eine Opferbereitschaft im Dienst der Demokratie.
Deutlich anders klang der dominierende Begriff der Verantwortung erst in den Neunzigerjahren. Er entwickelte seine Appellfunktion nicht mehr im Zusammenhang des internationalen Kräftemessens zwischen den Blöcken, sondern wurde zu einem Kampfbegriff der Innen- und Sozialpolitik. Und er wurde sowohl von der Rechten als auch von der Linken in einem völlig neuen Sinn gebraucht.
Der bereits erwähnte Tony Blair sagte um die Jahrtausendwende: «Was den Sozialstaat betrifft, so hat die Rechte soziale Spannungen und chronische Arbeitslosigkeit zu lange wachsen lassen. Die Linke setzte sich zwar ein für gesellschaftliche Rechte, war aber viel zu schwach, was die Verantwortung betrifft.» Mit Verantwortung ist hier offensichtlich etwas Neues gemeint: die Eigenverantwortung, die Sozialhilfeempfänger für ihre eigene Situation übernehmen müssen.
Bill Clinton sagte 1993 in seiner ersten Rede als amerikanischer Präsident: «Wir müssen tun, was Amerika am besten tut: allen bessere Chancen bieten und von allen mehr Verantwortung verlangen.» Auch hier ist nicht die Rede von klassischer Verantwortung für die Gemeinschaft. Gemeint ist nur noch die Eigenverantwortung.
Dasselbe Wort – das Englische responsibility – hat es geschafft, innerhalb nur einer Generation beinahe in sein Gegenteil umzuschlagen. Es stand für die moralische Pflicht, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, und wurde zur Erwartung, dass jeder primär für sein eigenes Handeln geradesteht. Es verwies auf die grosse ideelle Konfrontation zwischen den ideologischen Blöcken – und wurde zum schlagenden Argument einer rein innenpolitischen Auseinandersetzung um Sozialhilfe und Umverteilung.
Der deutsche Kanzler Gerhard Schröder schliesslich berief sich in seiner Neujahrsansprache zum Jahr 2003, mitten in der Polemik um die Hartz-IV-Reformen, ganz explizit auf die Eigenverantwortung. Obschon er den Begriff, der in Deutschland sehr viel weniger benutzt wird, wohl zur Abfederung mit «Verantwortung» kombinierte: «Wir werden dabei in jeder Hinsicht ein Mehr an Verantwortung brauchen: mehr Eigenverantwortung jedes Einzelnen und mehr gemeinsame Verantwortung für die Chancen unserer Kinder.»
Universelle Haftbarkeit
Was hat sich verändert? Heute sind wir im Namen der Verantwortung der Gemeinschaft keine Opfer mehr schuldig. Stattdessen schulden wir für unser Handeln Rechenschaft. Das stellt eine gesellschaftliche Veränderung dar, deren Reichweite gar nicht überschätzt werden kann.
Das Ethos der Eigenverantwortung bejaht persönliche Freiheit – knüpft sie aber an Haftbarkeit. Ich bin frei zu tun, was ich will, solange ich dafür die Folgen auf mich nehme. Eigenverantwortung bedeutet: Es wird abgerechnet. Das zeigte sich exemplarisch auch in der Schweizer Eigenverantwortungs-Debatte aus Anlass der Pandemie – wenn schon nicht in der realen Corona-Politik, so doch in der Debatte.
Gerhard Schwarz, der Grand Old Man des Schweizer Wirtschaftsliberalismus, sah sich provoziert durch Lukas Bärfuss’ scharfe Kritik an der pandemischen Eigenverantwortungsrhetorik der Schweizer Regierung. Seine Entgegnung auf ein Bärfuss-Interview lässt sich auf einen Kerngedanken reduzieren: Eigenverantwortung sei nicht unethisch, im Gegenteil. Sie beruhe auf dem moralischen Grundsatz, dass alle Bürgerinnen für ihre freien Handlungen haften. «Eigenverantwortung, die die Haftung einschliesst», sei auch in der Pandemie eine wertvolle moralische Orientierungshilfe.
Die zentrale Rolle von Haftbarkeit führt allerdings dazu, dass eine Politik, die sich auf Freiheitlichkeit im Sinne der Eigenverantwortung beruft, mit einem ständigen Dilemma konfrontiert ist. Sie hat einen liberalen, vielleicht sogar libertären Grundaffekt, was bedeutet, dass sie alle Akteurinnen sich möglichst ungehindert entfalten lassen will. Soweit diese Freiheitlichkeit an authentische Eigenverantwortung gebunden sein soll, müssen aber die Voraussetzungen für Haftbarkeit geschaffen werden. Einerseits soll der Spielraum des Handelns mit maximaler Grosszügigkeit bemessen werden, andererseits müssen die Handlungsfolgen zugerechnet werden können. Die Eigenverantwortung, die im Namen der Freiheit propagiert wird, hat deshalb paradoxerweise eine Neigung, zu engmaschiger Überwachung zu führen.
Das Politikfeld, das am tiefsten von diesem Dilemma geprägt wird, ist wiederum die Sozialpolitik. In den meisten westlichen Demokratien sind die Sozialsysteme seit den Achtzigerjahren permanenten Reformen und Veränderungen unterworfen worden – was allerdings weniger zu einem massiven Abbau (auch wenn das häufig das erklärte Ziel gewesen ist) als zum ständigen Ausbau der Rechenschaftspflichten der Empfänger sozialer Hilfeleistungen führte. Eine reichhaltige soziologische Literatur hat diese in allen Ländern feststellbare Transformierung des Sozialstaates beschrieben.
Wer staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen will – sei es Arbeitslosengeld, eine Invalidenrente oder Sozialhilfe –, muss immer aufwendiger unter Beweis stellen, dass er alles versucht hat, um sich selber zu helfen. Mehr und mehr beruhen die sozialen Sicherungssysteme auf dem Grundsatz, dass Unterstützung nur da zulässig ist, wo der normative Regelfall – nämlich dass die Betroffenen eigenverantwortlich eine Lösung finden – mit Gewissheit ausgeschlossen werden kann.
Gerade in der Schweiz sind diese Entwicklungen offensichtlich – man denke nur an die in die Neunzigerjahre zurückreichende Reform der Arbeitslosenversicherung, die ganz auf «Aktivierung» ausgerichteten IV-Reformen, welche die Rentenbezüger unter ständig wachsenden Evaluierungs- und Rechtfertigungsdruck setzen; oder an die umstrittenen Gesetzesreformen zur immer invasiveren Überwachung von Sozialhilfeempfängerinnen. Es müssen immer bessere und solidere Gründe geltend gemacht werden können, weshalb eine Bürgerin für die Notlage, in der sie sich befindet, nicht selber zur Rechenschaft gezogen werden kann.
Der Gegensatz zwischen libertärer Grundneigung und Ethos der Haftbarkeit ist ein nur schwer zu entschärfender Widerspruch. In der Regel wird er mit einer Differenzierung nach Zielgruppe aufgefangen. Sozialhilfeempfänger sollen haftbar sein, Leistungsträgerinnen hingegen sollen Ellenbogenfreiheit haben. Erstere werden einem ständig ausgebauten Überwachungsregime unterworfen, bei Letzteren begnügt man sich häufig mit Appellen an ein freiwilliges Verantwortungsbewusstsein; zum Beispiel die sehr häufig lancierten und kaum je gehörten Appelle, Spitzensaläre strikt von der Performance abhängig zu machen.
Das führt dazu, dass nicht nur die Linke, sondern auch die Rechte durch die gesellschaftliche Geltungsmacht von Eigenverantwortung in schwer zu lösende Widersprüche geführt wird. Sozialethische Prinzipien müssen universell gelten: Man kann nicht die Sozialhilfeempfängerinnen auf ihre Haftung verpflichten und dem Wirtschaftskapitän einen Freipass erteilen beziehungsweise den einen überwachen und vom anderen bloss freiwillige Verantwortlichkeit einfordern.
Die Rechte bekennt sich mit der Eigenverantwortung zu einem universellen Ethos der Haftbarkeit – hat aber die Tendenz, ausgerechnet die Eliten, die doch beispielgebend sein sollten, davon auszunehmen.
Vom Nutzen zum Vertrag
Dieses Prinzip der Haftbarkeit geht zudem einher mit einer zweiten, nicht minder fundamentalen Verschiebung: der «Kontraktualisierung». Das Paradigma des Kontrakts, des Vertrags wird immer wichtiger für unsere Auffassung von sozialen Beziehungen. Wenn Haftbarkeit das regulative Prinzip sein soll, auf dessen Basis die Gesellschaft organisiert ist, wird der Vertrag – oder mindestens die informelle Verhaltensanweisung – fast zwangsläufig zum Modell von gesellschaftlichen Bindungen. Haftung beruht immer auf einem expliziten oder impliziten Vertrag. Sie kann nur entstehen, wo der Handelnde so etwas wie eine Garantie abgibt.
In Wirklichkeit bestehen Gesellschaften zwar aus einem komplexen Gewebe sozialer Bindungen unterschiedlichster Natur, zum Beispiel aus Zugehörigkeits- oder eben Verantwortungsgefühlen. Diese werden aber mehr und mehr überlagert vom Vertrags-Paradigma: Heutige Gesellschaften orientieren sich stark an der Vorstellung von Grundverträgen, die zu erfüllen wir in der Pflicht stehen. Und deren Nichterfüllung sanktionierbar ist.
Jedenfalls ist die Juridifizierung sämtlicher Lebensbereiche eine der gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen der letzten Jahrzehnte. Es geht dabei nicht nur um Verrechtlichung im eigentlichen Sinn, sondern darum, dass soziales Verhalten stärker regelgeleitet ist und auf Regelverstösse gescannt werden soll. Grundlage dafür können rechtliche Verpflichtungen oder auch blosse Sprachregelungen oder alle möglichen code of conducts sein. Es ist aktuell sehr beliebt, diese Entwicklung zu denunzieren – als Überregulierung oder auch als Überschiessen einer «politischen Korrektheit». Was jedoch kaum je thematisiert wird, ist die Verbindung, die diese Entwicklung zum Ideal der Eigenverantwortung unterhält. Um Haftbarkeit festlegen zu können, brauchen wir Regeln und Kriterien, die mit der Erweiterung der Freiheiten und Handlungsoptionen paradoxerweise immer umfassender und omnipräsenter werden.
Yascha Mounk analysiert diese Verschiebung zunächst anhand einer Diskussion der Entwicklung der politischen Philosophie in der angelsächsischen Welt. Bis in die Siebzigerjahre hinein hatten Theorien der guten Gesellschaft ein Fundament, das man im weitesten Sinn als utilitaristisch bezeichnen konnte. Es ging im Wesentlichen darum, die sozialen Verhältnisse so zu organisieren, dass es einer möglichst grossen Zahl von Menschen einen optimalen Nutzen bringt: Allen sollte es möglichst gut gehen. Man konnte sehr unterschiedlicher Meinung darüber sein, wie die Wohlfahrt tatsächlich zu maximieren sei – ob durch eine eher elitäre oder eine eher egalitäre soziale Struktur –, aber die grundsätzliche Zielsetzung war klar. Wichtig war nicht, wem gerechterweise was zusteht, sondern dass das Ergebnis für alle optimal wird.
Das ist eine ethische Haltung, die man «Konsequenzialismus» nennt. Wichtig sind die Folgen politischer Entscheide, wichtig ist das Resultat. Diese Haltung wurde in der angelsächsischen Welt jedoch definitiv infrage gestellt mit dem Siegeszug der politischen Philosophie von John Rawls.
Rawls, der 1971 sein enorm einflussreiches Hauptwerk «Eine Theorie der Gerechtigkeit» veröffentlichte, verfolgte eine Sozialphilosophie, die liberale und egalitäre Prinzipien versöhnen sollte. Er wollte eine Theorie der Gerechtigkeit schaffen, die durch einen Gesellschaftsvertrag begründet war. Der Grundgedanke lag darin, dass dieser Vertrag für alle Gesellschaftsmitglieder zustimmungsfähig sein muss, bevor sie wissen, wo in der Gesellschaft sie ihren Platz finden werden und mit welchen Talenten sie ausgestattet sind, um sich gegen andere zu behaupten. Was hinter dem «Schleier der Unwissenheit» von allen als gerecht anerkannt wird, muss auch gerecht sein.
Auf der Basis einer solchen Aushandlung können gemäss Rawls Institutionen geschaffen werden, die für einen fairen gesellschaftlichen Ausgleich sorgen. Ein zentrales Anliegen von Rawls bestand darin, den Gerechtigkeitsbegriff von den individuellen Tugenden zu lösen: Was den Individuen zusteht, sollte nicht nur durch ihre individuellen Fähigkeiten, also quasi von Natur aus, bestimmt sein, sondern als ethische und politische Frage aufgefasst werden. Der Gesellschaftsvertrag bei Rawls ist nicht naturgegeben: Die Gesellschaft muss ihn nach vernünftigen Verfahren aushandeln.
Diese Theorie eines politischen Vertrags ist jedoch gemäss Mounk sehr weitgehend kompatibel mit dem Ethos der Eigenverantwortung und sollte es sogar fördern: Schliesslich liegt es in der Verantwortung jedes Bürgers, ob er sich an die Abmachungen hält oder nicht. Aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich «legitime Erwartungen», deren Erfüllung oder Nichterfüllung über die Ansprüche jedes Bürgers entscheiden soll.
Was einer Bürgerin zusteht und was nicht, wird bei Rawls deshalb stark von ihrer individuellen Vorgeschichte bestimmt. Sozialphilosophien vom utilitaristischen Typ interessieren sich für sinnvolle Strukturen und optimale Ergebnisse, nicht für die individuellen Verdienst- und Sündenregister der Bürgerinnen. Bei Rawls jedoch geht es nicht primär um das möglichst optimale Resultat. Und obwohl er die Pflicht zum Schutz der Schwachen in seinen Grundprinzipien festschreibt, geht es auch nicht primär um sozialen Ausgleich. Es geht um «vertraglich» ausgehandelte Gerechtigkeit. Darum, dass alle ihr Los gemäss der Grundvereinbarung finden – und deshalb auch ganz zentral um die Frage, ob sie sich an diese Grundvereinbarung halten.
Etwas überspitzt formuliert: Gute Politik, auch in ihrer sozialliberalen Variante, besteht heute nicht mehr darin, den Menschen Wohlfahrt zu verschaffen. Sie besteht darin, die Menschen nach den richtigen Kriterien zur Rechenschaft zu ziehen. Die angelsächsische politische Philosophie hat im Anschluss an Rawls deshalb damit begonnen, wahnwitzig viel Energie darauf zu verwenden, solche Kriterien immer präziser zu definieren.
Glück oder Verdienst
Es ist eine komplexe Scholastik der Zurechnungstheorien entstanden. Wenn es so sein soll, dass mein gerechter Platz in der Gesellschaft davon abhängt, wie ich selber gehandelt habe, und wenn es keinen anderen Weg gibt, meine Handlungen zu beurteilen als danach, ob ich selber die volle Kontrolle über die Vorgänge hatte oder ob ich zum Beispiel einfach zum Opfer von unverschuldetem Pech geworden bin – dann muss man anfangen, sehr präzise zu unterscheiden zwischen Verdienst und blossem Glück. Genau das tut die angelsächsische Sozialphilosophie heute auch – unter dem Label des luck egalitarianism (Glücks-Egalitarismus), der sich im Anschluss an Rawls entwickelt hat und etwa von Ronald Dworkin ausgearbeitet wurde.
Der Grundgedanke besteht darin, dass Gleichheit im Prinzip unser Gerechtigkeitsideal sein sollte, dass Ungleichheit aber gerechtfertigt ist, solange man sie zurückführen kann auf Qualitäten wie Fleiss, Intelligenz sowie vor allem Willenskraft und Entscheidungsautonomie des Handelnden. Was aber, wenn jemand – aus Gründen, die sich seiner Kontrolle entziehen – ganz einfach Pech gehabt hat? Oder wie soll man es bewerten, wenn jemand, der unfähig und faul ist, durch glückliche Umstände plötzlich grossen Erfolg hat – viel grösseren als fähigere Mitbewerberinnen, denen der Zufall nicht in die Hände spielte?
Yascha Mounk zeichnet diese Debatten detailliert nach, nicht nur deshalb, weil er die entwickelten Argumente auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen will. Der Punkt ist vielmehr, dass diese Theorien der Gerechtigkeit nicht nur eine perfektionierte philosophische Basis liefern für das Ethos der Eigenverantwortung, sondern auch die gesellschaftliche Entwicklung widerspiegeln. Sie zeigen, wie ungeheuer aufgeladen und zentral das Problem der Zurechenbarkeit von Verantwortung geworden ist, wobei mit Verantwortung eben nie mehr die Fürsorgepflicht für andere, sondern die immer präziser ausgemittelte Verantwortung für das eigene Schicksal gemeint ist.
Eine positive Verantwortlichkeit
Es geht Mounk nicht darum, zu bestreiten, dass der Begriff der Verantwortung ein absolut zentrales Konzept für die politische Philosophie darstellt. Es ist auch nicht das Ziel, Verantwortlichkeit als solche in Zweifel zu ziehen, obwohl die Frage, ob Individuen für ihr Handeln überhaupt haftbar gemacht werden können, so alt ist wie die Debatten über Willensfreiheit. Politische Gemeinschaften lassen sich nur dann sinnvoll organisieren, wenn all ihren Mitgliedern zugestanden wird, dass sie Verantwortung tragen können und tragen müssen. Die Frage sollte jedoch sein, wie wir zu einem positiven Begriff von Verantwortung kommen. Der Verantwortungsbegriff, welcher der Eigenverantwortung zugrunde liegt, ist einseitig und reduktionistisch.
Erstens verhindert der Fokus auf Eigenverantwortung die adäquate Valorisierung der Verantwortung für andere. Es ist ein fundamentales menschliches Bedürfnis, für sein eigenes Handeln Verantwortung zu übernehmen, ein soziales Ethos, das darauf aufbaut, macht an sich nichts falsch. Wir definieren uns aber nicht weniger durch die Verantwortlichkeit, die wir gegenüber anderen empfinden. Diese basale Form der Solidarität wird vom Eigenverantwortungsdiskurs relativiert.
Zweitens sollte Sozialpolitik primär kein Strafsystem darstellen, sondern politisch gewollte Ziele der allgemeinen Wohlfahrt verfolgen. Die Hauptaufgabe des Staates sollte es nicht sein, die sozial Schwachen zu überwachen, sondern ihnen zu helfen und sie zum Handeln zu ermächtigen.
Zwar mag es durchaus sinnvoll sein, Anreize zu schaffen, damit zum Beispiel Empfänger von Arbeitslosengeld sich auch wirklich bemühen, wieder eine Arbeit zu finden. Es mag häufig aber auch viel zielführender sein, persönliches Versagen nicht zu sanktionieren und Anreize nicht über Strafmechanismen zu setzen.
Schliesslich und endlich: Es sollte das Ziel der Gesellschaft sein, den Hilfsbedürftigen die Handlungsfähigkeit nicht abzusprechen. Der Opferstatus darf nicht die einzige Legitimation für soziale Absicherung und als sinnvoll anerkannte Umverteilung sein. Ganz im Gegenteil: «Ein positives Konzept von Verantwortung könnte den begrifflichen Spielraum so rekonfigurieren, dass nicht mehr die Bestrafung, sondern das Empowerment im Zentrum steht», sagt Yascha Mounk. Solange die Eigenverantwortung den Diskurs beherrscht, wird dieses Vorhaben unmöglich bleiben.
Freiheit als Haftbarkeit ist ein hartes ethisches Regime – vielleicht das härteste, das denkbar ist. Nicht nur deshalb, weil Menschen an ihrem Potenzial und nicht an ihrem Sündenregister gemessen werden sollten. Sondern auch darum, weil die Frage, wie unsere Freiheit vereinbar ist mit unserer Hoffnung auf Solidarität – oder um es etwas altmodischer auszudrücken: mit unserer Hoffnung auf Gnade –, schon eines der gravierendsten Probleme der abendländischen Geschichte und der christlichen Theologie gewesen ist.
Wie lässt sich die Willensfreiheit und damit die Möglichkeit zur Sünde und zum Bösen vereinen mit der göttlichen Allmacht? Dieser eigentlich unlösbare Grundwiderspruch beherrschte die theologischen Kontroversen – und wurde entschärft durch die göttliche Gnade. Trotz seiner Allmacht gewährt der christliche Gott den Menschen die Freiheit, sich selber zu verdammen – aber er kann in seiner Gnade die Sünde auch vergeben. Nichts ist möglich – beziehungsweise alles ist von Gott schon festgelegt worden –, aber alles kann verziehen werden.
Unsere säkularisierte Welt, so scheint es, hat für Gnade jedoch keine Verwendung mehr. Das theologische Erlösungsversprechen macht einem hartem Realismus Platz. Und deshalb wird nun alles vom Kopf auf die Füsse gestellt. Es gibt keine göttliche Allmacht und keinen grossen Plan mehr. Für uns Erdenbürgerinnen heisst das dann aber auch: Alles kann möglich sein – aber nichts wird verziehen. Die Eigenverantwortung ist letztlich ein erdrückendes Ethos der Gnadenlosigkeit. Und wird erfolgreich verkauft als die letzte Utopie. Wir hätten Besseres verdient.