
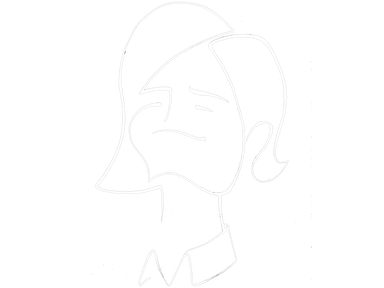
Warten auf Triage
In der Schweiz muss nun diskutiert werden, ob das Gesundheitssystem zusammenzubrechen droht. Warum diese Debatte verlogen ist.
Von Daniel Binswanger, 11.12.2021
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Es wird wieder ernst, verdammt ernst. Auch wenn das eine seltsame Aussage ist nach bald zwei Jahren Corona. Nach über 35’000 Hospitalisierungen, über 11’500 Toten. Aber der Stimmungsumschwung ist mit Händen zu greifen.
Wir sind wieder an dem Punkt: Die Drohung der «Triage» steht im Raum, die Angstvokabel dieser Pandemie. Wir sind an dem Punkt, an dem die Furcht vor einer unmittelbar bevorstehenden Überlastung des Gesundheitssystems die Gemüter niederdrückt, den Mediendiskurs beherrscht, nun endlich sogar die Politik zum Handeln veranlasst. Der Bundesrat hat gestern relativ stringente Massnahmen in Konsultation gegeben, 2G und potenziell auch darüber noch deutlich hinausgehende Einschränkungen werden kommen. Selbst Versammlungen im Privatbereich sind nicht mehr tabu.
Der Aktivismus beweist, wie bedrohlich die Lage geworden ist. Wird es an diesen Festtagen erneut zu einer massiven, unkontrollierten Welle von Todesfällen kommen? Zu mangelnden Beatmungsplätzen, Spitalkräften am Rande des Zusammenbruchs, Einzelschicksalen, über denen man den Daumen senkt, weil die Ressourcen längst erschöpft sind?
Die Schweizer Covid-Strategie besteht darin, ein möglichst liberales Massnahmenregime jeweils möglichst lange aufrechtzuerhalten – auch wenn bei einer Verschärfung der Lage dann erst sehr spät reagiert wird und ein hoher menschlicher Preis zu zahlen ist. Auch wenn es bedeutet, dass man mit den Hospitalisierungen ans obere Limit der Intensivbettenkapazitäten gehen muss. So war es letzten Winter, und auch diesen Winter ist es nicht anders. Solange die Menschen in einem Intensivbett sterben, so scheinen die Entscheidungsträger beschlossen zu haben, ist auch eine hohe Sterblichkeit in Kauf zu nehmen.
Nicht die Verwundbaren zu schützen, erscheint als die oberste Priorität, sondern sie medizinisch begleiten zu können, wenn es schiefgeht. Auf dieser Grundlage wird der Spielraum definiert, innerhalb dessen man das Massnahmenregime kalibriert und die Impfverweigerer gewähren lässt. Eine Überlastung der Intensivkapazitäten wäre gleich zweifach eine Niederlage: Sie bedeutet nicht nur sehr hohe Todeszahlen, sondern auch das Entgleisen der offiziellen Strategie.
Es ist deshalb begrüssenswert, dass jetzt heftig und ohne Tabus über die sich ankündigende Katastrophe diskutiert wird. Das Schweizer Fernsehen strahlt Direktschaltungen in die Intensivstationen aus, Ärzte in Schutzmontur, den Tränen nahe, warnen vor der kommenden oder schon eintretenden Katastrophe. Das ist ein markanter Unterschied zum letzten Winter, wo die Medien sich dem grossen Sterben hinter den Spitalmauern nur mit einer gewissen Zurückhaltung näherten. Das grosse Aufwachen kam erst mit den Gedenklichteraktionen der Corona-Mahnwache und den vorweihnachtlichen Pressekonferenzen von ein paar couragierten Spitaldirektoren. Jetzt hingegen gibt es eine Arena über Triage. Man will den Realitäten ins Gesicht blicken.
Das ist ein Fortschritt gegenüber der letztjährigen Adventszeit – und dennoch erscheint es sehr irritierend. Der öffentliche Diskurs ist alerter geworden – aber eine fundamentale Pervertiertheit, eine ideologische Verzerrung der Pandemieproblematik wird durch diesen reality check nicht korrigiert. Im Gegenteil: Er wird noch einmal gesteigert.
Das liegt nicht nur daran, dass auch in diesem Jahr das Aufwachen viel zu spät erfolgt. Die Diskussionen um Impfobligatorium und Triage werden von sehr begrenztem Nutzen bleiben, wenn sie keinen Beitrag mehr dazu leisten, dass es zur Triage gar nicht kommt. Es liegt vor allem daran, dass die Triage-Diskussion zwar eine drohende Realität beschreibt, das Grundproblem aber völlig unangemessen artikuliert.
Was heisst Triage? Der Begriff stammt bekanntlich aus der Kriegsmedizin, und beschreibt die Techniken, die auf dem Schlachtfeld angewendet werden, wenn die medizinischen Ressourcen begrenzt sind und die Zahl der Verwundeten blitzartig in die Höhe schnellt, um möglichst viele Leben zu retten, indem die Mittel möglichst effizient eingesetzt werden. Das heisst, dass die Ressourcen konzentriert werden auf die Verwundeten, die einerseits eine Versorgung akut benötigen, andererseits aber auch eine gute Prognose haben, zu überleben, wenn sie diese Versorgung bekommen. Verwundete mit schlechten Überlebenschancen hingegen werden ihrem Schicksal überlassen, damit ja nicht knappe Ressourcen an hoffnungslose Fälle verschwendet werden. Die Massenheere der napoleonischen Kriege machten die Triage zum ersten Mal zu einer kodifizierten Technik. Sie wurde erfolgreich eingesetzt, um eine maximale Zahl an Soldaten zu retten.
Natürlich kann es nicht nur in Kriegs-, sondern eben auch in Pandemie- oder sonstigen Katastrophensituationen dazu kommen, dass kurzzeitig der medizinische Versorgungsbedarf viel höher ist als die zur Verfügung stehenden Mittel. Als Norditalien im letzten Frühjahr von Corona überrollt wurde, musste teilweise triagiert werden in den Spitälern. Es gab keine Möglichkeit, diesem Zwang zu entkommen.
Genau hier jedoch liegt der Unterschied zur heutigen Lage in der Schweiz. Wir bereiten uns zwar darauf vor, zu triagieren – man weiss schon gar nicht mehr recht, ob die zahlreichen Medienbeiträge dagegen ankämpfen oder uns vielmehr darauf einstimmen sollen. Aber wir handeln nicht unter existenziellem Zwang. Wir haben die Wahl – oder hätten sie jedenfalls gehabt. Wir sind nicht im Zustand der Generalmobilmachung, wir könnten noch viel, viel grössere Kräfte aufbieten. Aber wir tun es nicht: Stell dir vor, es ist gar nicht Krieg – und wir triagieren trotzdem.
Zur Triage gehört die Zwangssituation. Sie allein kann eine moralische Rechtfertigung liefern dafür, aus einer verzweifelten Lage das Beste zu machen, indem man Menschen, die man eigentlich retten könnte, sterben lässt, um anderen zu helfen. Eine erwartete Triagesituation jedoch ist ein Widerspruch in sich – und ein moralischer Skandal. Wenn wir in der Schweiz schon in Kürze in genau diese Situation hineingeraten, dann nur deshalb, weil wir es nicht anders wollten. Weil wir es vorgezogen haben, die Massnahmen nicht zu ergreifen, mit denen sie hätte verhindert werden können. Weil es wichtiger war, Clubs und Restaurants offen zu lassen, kein Homeoffice-Obligatorium vorzuschreiben, in den Schulen trotz allem nicht zu testen.
Die Debatten über Triage sind wichtig, weil sie vor der Katastrophe warnen. Aber sie sind zugleich der Ausdruck einer unerträglichen Selbstapologetik: Sie suggerieren eine Unausweichlichkeit, die nie existiert hat.
Solche Realitätsverzerrungen haben von Anbeginn den Schweizer Covid-Diskurs bestimmt – mit gravierenden Effekten. Das Hauptbeispiel ist der unsinnige Begriff der «Eigenverantwortung», der zum Mantra des offiziellen Covid-Diskurses geworden ist. Jedes Vorschulkind begreift, dass er unbrauchbar ist, um die realen Dilemmata der Epidemiebekämpfung zu erfassen. Im Umgang mit einer Ansteckungskrankheit kann per definitionem nicht die Eigenverantwortung im Zentrum stehen, weil unser Handeln nicht nur uns selber, sondern stets auch unsere Umgebung betrifft. Es geht immer darum, dass jede und jeder für alle Mitmenschen, die er oder sie anstecken könnten, ebenfalls eine minimale Verantwortung übernehmen muss.
Was man in der Schweizer Debatte mit grossem Pathos «Eigenverantwortung» nennt, bezeichnet in der Regel lediglich die Freiwilligkeit der Massnahmen. Der Staat will so weit als möglich keinen Zwang auferlegen, also viele Covid-Vorsichtsmassnahmen nicht gesetzlich vorschreiben, sondern es den Bürgerinnen überlassen, sich freiwillig vernünftig zu verhalten. Freiwillige Verantwortung, die nicht erzwungen ist, und Eigenverantwortung, die nur mich betrifft, sind aber offensichtlich nicht dasselbe.
Die Begriffsverwirrung wird veranstaltet, um die Weigerung, überhaupt Verantwortung zu übernehmen, moralisch zu legitimieren. Was nur mich selber betrifft, darf ich jederzeit unterlassen, solange ich die Konsequenzen trage. Was jedoch meinen Nächsten in Lebensgefahr bringen kann, sollte ich auch dann vermeiden, wenn ich gesetzlich dazu nicht gezwungen bin. Schon «pandemische Eigenverantwortung» ist eine begriffliche Absurdität. Mit der Debatte über «erwartete Triage» wird der finstere Zynismus der helvetischen Selbstapologie nun nochmals einen Gang hochgeschaltet. Schaut her, wie fürchterlich! Aber es ist leider, leider eine Zwangssituation, an der wir nichts ändern können. So lautet die Botschaft. Sie müsste lauten: an der wir schlicht nichts ändern wollen.
Diese argumentativen Verzerrungen ziehen sich durch die ganze Debatte und werden immer krasser. Sie führen zum Beispiel dazu, dass unsere Nationalratspräsidentin die Covid-Impfung eine «Privatsache» nennt. Man kann sich vielleicht auf den Standpunkt stellen – auch wenn ich nicht wüsste, mit welchen Argumenten – , dass es wichtiger ist, dem Einzelnen den Impfentscheid zu überlassen, als die Gemeinschaft zu schützen. Die Behauptung jedoch, es sei meine Privatangelegenheit, wenn ich für andere Menschen ein Ansteckungsrisiko bin, ist offensichtlich grotesk.
Die Selbstapologetik zeigt sich auch in der verblüffenden Einseitigkeit der ethischen Bedenken, die nun allenthalben ins Spiel gebracht werden. Andrea Büchler, Präsidentin der nationalen Ethikkommission, spricht sich ganz entschieden gegen ein Impfobligatorium aus, und zwar im Namen der «Selbstbestimmung über den eigenen Körper». Es ist unbestreitbar, dass diese Selbstbestimmung ein hohes Gut ist. Aber wie wird es abgewogen gegen den Schutz der Allgemeinheit?
Grosses Aufheben wird davon gemacht, dass freie Bürger über medizinische Eingriffe jederzeit frei entscheiden können müssen und dass die unter gesetzlichem Zwang zustande kommende Verabreichung einer Impfdosis einen Übergriff darstellen würde. Dem ist nicht zu widersprechen. Aber wie ist das abzuwägen gegen den Übergriff, an Sauerstoffmangel zu ersticken oder wochenlang an einer Beatmungsmaschine zu hängen? Der Tod und das Leid in den Spitälern scheinen nicht schwer zu wiegen neben der medizinischen Selbstbestimmung der Bürgerinnen. Sie ist offensichtlich unantastbar.
Wir reden von Eigenverantwortung, aber wir meinen unseren Egoismus. Wir reden von Triage, aber wir legitimieren unsere Passivität. Was ist vom moralischen Zustand eines Landes zu halten, das zur Rechtfertigung seiner Interventionsunlust eine Notlage heraufbeschwören muss, wie man sie aus Kriegen kennt? Das Problem liegt nicht darin, dass wir keine Wahl hätten. Es liegt darin, dass die Politik sich ein weiteres Mal als führungsschwach und zögerlich erweist, dass ihr der Preis für wirkungsvolle Massnahmen zu hoch ist. Und dass die Bürger schlicht zu träge und zu egoistisch sind, um die Schwachen zu schützen und dieser Pandemie den Kampf anzusagen. Das wäre unsere gemeinsame Verantwortung.
Illustration: Alex Solman