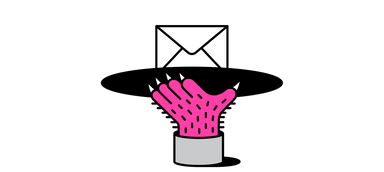
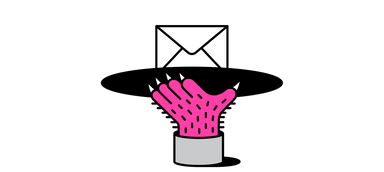
Kritik an Cassis’ Wortwahl zu Ukraine, die Linke greift die nächste Steuersenkung an – und eine Ohrfeige für Mütter im Parlament
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (186).
Von Dennis Bühler, Priscilla Imboden und Cinzia Venafro, 07.04.2022
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Sechs Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine steht Ignazio Cassis stark in der Kritik. Der Grund: Der Bundespräsident wähle zu vorsichtige Worte für das Massaker in Butscha, einem Vorort von Kiew.
Am Sonntagabend hatte sein Departement in einer Stellungnahme auf Twitter von «Geschehnissen» gesprochen, sowie «alle Seiten» aufgefordert, das «humanitäre Völkerrecht strikte einzuhalten und die Zivilbevölkerung zu schützen». Empörte Reaktionen folgten umgehend. Cassis rechtfertigte sich am Montag in einem Interview: «Ganz sicher gab es eine krasse Verletzung des humanitären Völkerrechts.» Ob aber Kriegsverbrechen vorlägen, sei ein rechtlicher Entscheid. Das müssten die Gerichte klären.
Cassis musste sich wegen seiner Äusserungen in der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats erklären – und Jakob Kellenberger, der ehemalige Spitzendiplomat und frühere Präsident des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK), bezeichnete Cassis’ Verhalten als «Wischiwaschi-Politik».
Während Cassis also am Montag noch erklärte, dass Kriegsverbrechen «kein Wort der Politik» sei, bewies seine Partei- und Bundesratskollegin Karin Keller-Sutter tags darauf genau das Gegenteil: «Zivilisten zu töten, ist ein Kriegsverbrechen», sagte die Justizministerin in die Fernsehkameras: Die Bilder aus Butscha würden nahelegen, «dass es sich um Kriegsverbrechen handeln könnte».
Gestern Mittwoch dann traf sich die Regierung nicht nur zur ordentlichen Bundesratssitzung – sondern schloss die Türen hinter sich für eine Klausur zu «spezifischen Aspekten der Ukraine». Dabei tauschte sich der Bundesrat über die Neutralität aus. Entschieden wurde nichts.
Interessant gewesen sein dürften die Diskussionen über einen Input von Guy Parmelin. Der SVP-Bundesrat, dessen Departement hauptsächlich für die Bewilligung von Waffenausfuhren zuständig ist, wollte gemäss «Tages-Anzeiger» über «Kriegsmaterialexporte nach Europa unter Berücksichtigung der Neutralität» sprechen. In einer Informationsnotiz sei Parmelin aber zum Schluss gekommen, dass es derzeit keinen grösseren Handlungsbedarf gebe.
Parmelin muss sich derweil gegen Vorwürfe wehren, er sei bei der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland zu passiv. Die SP hat eine Aufsichtsbeschwerde gegen sein Departement eingereicht: Dieses solle die Sanktionen «umfassend und zeitnah» umsetzen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft solle enger mit den Kantonen zusammenarbeiten und eine Taskforce einsetzen.
In der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats wiederum führte der Verlauf des Kriegs in der Ukraine diese Woche zu einem bemerkenswert knappen Abstimmungsresultat: Die Kommission sprach sich mit 13 zu 12 Stimmen gegen einen Handelsstopp mit russischem Gas aus. Noch vor wenigen Wochen wäre ein solches Vorhaben chancenlos gewesen. Der nahe Krieg hat augenscheinlich Auswirkungen auf die ideologischen Überzeugungen von manchen Aussenpolitikerinnen.
Und damit zum Briefing aus Bern
Parteien: GLP und Grüne wollen in den Bundesrat, die SVP macht ein Angebot – und Regula Rytz tritt zurück
Worum es geht: Noch dauert es 20 Monate bis zu den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats. Doch schon heute werden Forderungen gestellt, wird provoziert und gezündelt.
Warum Sie das wissen müssen: Bei den Parlamentswahlen 2019 waren die Grünen und die Grünliberalen die grossen Sieger – und seither geht der Höhenflug für beide Parteien auf kantonaler Ebene weiter (wo sie in den letzten zweieinhalb Jahren auf ein gewichtetes Plus von 2,7 respektive 2,9 Prozentpunkten kommen). Für GLP-Präsident Jürg Grossen wird eine Abkehr von der Zauberformel damit eine «ernsthafte Option». Konkret: Künftig soll nur noch die wählerstärkste SVP zwei Bundesräte stellen, die restlichen fünf Sitze sollen an SP, FDP, CVP, Grüne und Grünliberale gehen. Auch die Grünen stellen Ansprüche: «Selbstverständlich gehören die Grünen in den Bundesrat», sagt die ehemalige Präsidentin Regula Rytz. «Sie haben die Stärke und die Bedeutung einer Regierungspartei.» Selbst steht die 60-jährige Bernerin, die mit ihrer Kandidatur als Bundesrätin im Dezember 2019 scheiterte, nicht mehr zur Verfügung: Sie tritt im Mai aus dem Nationalrat zurück und übernimmt das Präsidium der Entwicklungsorganisation Helvetas. Auch die SVP nimmt bereits die Bundesratswahlen 2023 in den Blick – und macht der SP ein unmoralisches Angebot. Wenn Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga im laufenden Jahr zurücktrete, sei die SVP bereit, sie mit einer Sozialdemokratin zu ersetzen, sagte Fraktionschef Thomas Aeschi. Wenig überraschend will sich die SP nicht unter Druck setzen lassen.
Wie es weitergeht: Das eidgenössische Parlament wird am 22. Oktober 2023 neu gewählt, allfällige zweite Wahlgänge für die Ständeratssitze finden vier oder fünf Wochen später statt. Am 13. Dezember 2023 wählen dann 246 Parlamentarier sieben Bundesrätinnen – aus welchen Parteien auch immer.
Medienförderung: Kommission will Teile des Pakets retten
Worum es geht: Die für Medienpolitik zuständige Kommission des Nationalrats will die in den Parlamentsdebatten unbestrittenen Teile des kürzlich gescheiterten Förderpakets neu auflegen. Unterstützen will sie insbesondere die Nachrichtenagentur Keystone-SDA, den für medienethische Fragen zuständigen Presserat sowie Aus- und Weiterbildungsinstitutionen wie die Journalistenschule MAZ – alle drei Organisationen haben finanzielle Schwierigkeiten. Ganz knapp hat sich die Kommission zudem dafür ausgesprochen, wegen der Pandemie auch 2022 zusätzliche Gelder an Printmedien auszuschütten; profitieren sollen nur Unternehmen, die keine Dividenden auszahlen.
Warum Sie das wissen müssen: Seit dem Nein der Stimmbevölkerung am 13. Februar ist in der Medienpolitik vieles ungewiss. Klarheit herrscht dank der am Wochenende publizierten Vox-Analyse jedoch über den Hauptgrund für die damalige Ablehnung: Die meisten Nein-Stimmenden erklärten ihren Entscheid damit, dass das Medienpaket zu einer ungerechten Verteilung der Gelder geführt hätte. Konkret: dass die grossen Medienkonzerne zu viel erhalten hätten. Tatsächlich wäre ein beträchtlicher Teil der Fördergelder an die TX Group, an CH Media und die NZZ gegangen, die in den letzten Wochen allesamt sehr hohe Gewinne für das zurückliegende Jahr auswiesen. Während dieser Befund nicht überrascht, weil die Grosskonzerne im Abstimmungskampf im Fokus standen, ist eine andere Erkenntnis der Vox-Analyse erstaunlich: Ausgerechnet in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen – die immer wieder als News-depriviert bezeichnet wird – erreichte das Medienpaket eine Mehrheit.
Wie es weitergeht: In den nächsten Wochen beginnen die SVP, der Gewerbeverband und die Jungfreisinnigen mit dem Sammeln von Unterschriften für ihre Volksinitiative «200 Franken sind genug», mit der sie die Radio- und Fernsehgebühren markant senken möchten. Den Befürwortern einer starken SRG sollte die Vox-Analyse zu denken geben: Denn obwohl das gebührenfinanzierte Medienunternehmen vom Förderpaket gar nicht betroffen gewesen wäre, erklärt kein anderer Faktor den individuellen Abstimmungsentscheid besser als die jeweilige Einstellung gegenüber der SRG. «Wer der SRG mindestens hohes Vertrauen schenkt, hat mehrheitlich Ja gestimmt», heisst es in der Analyse. Wer ihr jedoch nicht vertraue, habe klar Nein gestimmt.
Referendum gegen Abschaffung der Verrechnungssteuer eingereicht
Worum es geht: Ein linkes Komitee will an das erfolgreiche Referendum gegen die Abschaffung der Stempelsteuer anknüpfen: SP, Gewerkschaften und Grüne haben ihr Referendum gegen die teilweise Abschaffung der Verrechnungssteuer eingereicht. Im Dezember hatte das Parlament die Reform beschlossen. Es will damit den Finanzplatz stärken und das Geschäft mit der Fremdkapitalfinanzierung wieder in die Schweiz holen. Das Referendumskomitee sieht darin einen «Freipass zur Steuerkriminalität für Vermögende aus dem In- und Ausland.»
Warum Sie das wissen müssen: Die Verrechnungssteuer soll garantieren, dass es nicht zur Steuerhinterziehung kommt. Sie beträgt 35 Prozent und wird auf Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden, Lottogewinne, und Versicherungserträge erhoben. Sobald die Kapitalerträge in der Steuererklärung deklariert werden, wird der Betrag zurückerstattet. Ziel ist, dass Personen und Unternehmen ihr gesamtes Vermögen deklarieren. Mit der aktuellen Vorlage soll nur die Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen abgeschafft werden, nicht aber auf Bankkontozinsen und Dividenden. Der Bund rechnet mit einmaligen Steuerausfällen im Umfang von einer Milliarde Franken, längerfristig mit 170 Millionen Franken pro Jahr. Diese würden durch die erhoffte Belebung des Finanzmarktes kompensiert, erklärt der Bundesrat. Die Gegner der Vorlage bezweifeln das. Zudem weisen sie darauf hin, dass die prognostizierten Mindereinnahmen auf dem aktuellen Tiefzinsniveau beruhen. Berechnungen mit höheren Zinsen ergeben Steuerausfälle von 600 bis 800 Millionen Franken pro Jahr.
Wie es weitergeht: Die Bundeskanzlei muss nun die Unterschriften prüfen. Voraussichtlich diesen Herbst kommt die Vorlage an die Urne.
GLP-Nationalrätin muss Mutterschaftsgeld zurückzahlen
Worum es geht: Die grünliberale Nationalrätin Kathrin Bertschy hat vor Bundesgericht verloren. Sie muss das Mutterschaftstaggeld zurückzahlen, das sie nach der Geburt ihrer Tochter 2018 von der Ausgleichskasse erhalten hat. Grund: Bertschy nahm während der Märzsession 2019 an Parlamentssitzungen teil und erhielt dafür die volle Entschädigung als Parlamentarierin.
Warum Sie das wissen müssen: Der Fall Bertschy steht stellvertretend für die Frage, inwiefern Politikerinnen nach der Geburt eines Kindes ihre politischen Rechte wahrnehmen können. In den Augen des Bundesgerichts hatte Bertschy mit der Wiederaufnahme ihrer Parlamentstätigkeit den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung verloren. Sie hatte verlangt, dass ihr Anspruch auf Taggelder für ihre privatwirtschaftliche Tätigkeit nach der Session Ende März 2019 wieder auflebe. Es sei diskriminierend, dass Mütter ihren Urlaub am Stück nehmen müssten, während Väter die Taggelder tage- oder wochenweise beziehen dürfen. Das Bundesgericht verneinte auch diesen Punkt: Der Gesetzgeber habe den Anspruch der Mutter viel umfassender ausgestattet, um ihr die nötige Zeit einzuräumen, um sich in den ersten Monaten am Stück intensiv um ihr Neugeborenes kümmern zu können. In der Vergangenheit hatte Bertschy als Co-Präsidentin der Frauendachorganisation Alliance F mehrfach Diskriminierungen in der Rechtsprechung angeprangert. In ihrem eigenen Fall sieht sie sich «als Bürgerin faktisch entmündigt» und erkennt darin ein «Politikverbot».
Wie es weitergeht: Im Parlament sind mehrere Standesinitiativen hängig, die verlangen, dass Frauen ihre politischen Mandate während des Mutterschaftsurlaubs wahrnehmen können, ohne den Anspruch auf Entschädigung zu verlieren. Die erste Hürde in den vorberatenden Kommissionen haben drei davon bereits genommen. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist in Vorbereitung.
Anzeige der Woche
Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK) zeigt ihren Kollegen Roger Köppel wegen mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung an: Mit 14 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen ist sie der Meinung, der SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger habe in einer seiner Videokolumnen vor zwei Wochen Interna der Kommissionssitzung verraten. Konkret hatte er im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland – die er ablehnt – den Inhalt eines Dokuments aus den APK-Unterlagen veröffentlicht. Zudem beschäftigt sich auch die Bundesanwaltschaft mit Köppel: Man treffe «die nötigen Abklärungen, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt», erklärt die Behörde. Damit sie überhaupt gegen Köppel vorgehen kann, müsste zuerst seine Immunität aufgehoben werden. Und darüber entscheiden die Immunitätskommission des Nationalrates und die Rechtskommission des Ständerates. Sollte sie sich für eine Aufhebung aussprechen und der SVP-Politiker anschliessend für schuldig befunden werden, könnte er eine Geldstrafe oder im Extremfall sogar Gefängnis kassieren. Die Höchststrafe liegt bei drei Jahren. Der gesprächige Politiker, für den die Unschuldsvermutung gilt, könnte in diesem Fall wohl in aller Ruhe aus dem Nähkästchen respektive der Kiste plaudern. Hinter Gittern passiert bestimmt so einiges, was Köppel in seinem Blatt verbraten könnte.
Illustration: Till Lauer