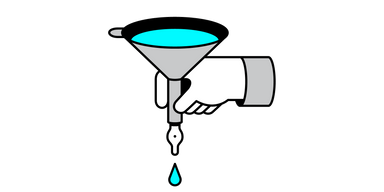
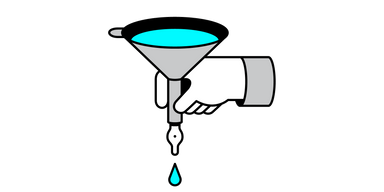
US-Truppen verlassen Afghanistan, Iran beschuldigt Israel der Sabotage und Japan will verstrahltes Wasser ins Meer leiten
Woche 15/2021 – das Nachrichtenbriefing und die Corona-Lage aus der Republik-Redaktion.
Von Reto Aschwanden, Ronja Beck, Anja Conzett, Oliver Fuchs, Marie-José Kolly und Cinzia Venafro, 16.04.2021
Keine Lust auf «Breaking News» im Minutentakt? Jeden Freitag trennen wir für Sie das Wichtige vom Nichtigen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie das wöchentliche Nachrichtenbriefing der Republik!
Die USA überlassen Afghanistan sich selbst
Darum geht es: Präsident Joe Biden hat am Mittwoch offiziell erklärt, die US-Truppen bis zum 11. September aus Afghanistan abzuziehen. Am selben Tag verständigten sich auch die Aussen- und Verteidigungsminister der Nato auf den Abzug ihrer Truppen aus dem Land. Er soll am 1. Mai starten und innert einiger Monate abgeschlossen sein. Derzeit befinden sich noch knapp 10’000 Nato-Soldaten in Afghanistan.
Warum das wichtig ist: Schon Obama und Trump wollten die US-Militärpräsenz in Afghanistan beenden – Biden tut es nun. Dass der Abzug bis zum 11. September vollzogen sein soll, ist kein Zufall, waren doch die Terroranschläge vor 20 Jahren der Auslöser für den Einmarsch. Nun endet der längste Krieg der USA: 2400 US-Soldaten verloren ihr Leben, gekostet hat der Einsatz allein die Amerikaner 2,3 Billionen Dollar. Am Ziel, durch nation building aus Afghanistan ein demokratisches und stabiles Land zu machen, sind die USA und ihre Alliierten gescheitert. Dem Land drohen neue Kämpfe, denn es ist zweifelhaft, ob es der Regierung gelingen wird, die Taliban, die etwa ein Fünftel des Landes kontrollieren, in Schach zu halten. Ein Uno-Bericht zeigte diese Woche auf, dass es im ersten Quartal 2021 deutlich mehr Gewalt gegen Zivilistinnen gab. Namentlich Frauen und Kinder wurden im Vergleich zur Vorjahresperiode öfter verletzt oder getötet.
Was als Nächstes geschieht: In manchen Gegenden von Afghanistan stellen sich die Menschen auf einen neuen Krieg ein. Zwar laufen Verhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung, doch die kommen kaum vom Fleck. Die demokratischen Errungenschaften der letzten Jahre stehen unter Druck, befürchtet werden vor allem Rückschritte bei den Frauenrechten.
Iran beschuldigt Israel der Sabotage einer Atomanlage
Darum geht es: In der iranischen Atomanlage Natanz hat sich ein Zwischenfall ereignet, der die Urananreicherung des Landes um mehrere Monate zurückwerfen könnte. Teheran geht davon aus, dass es sich um eine gezielte Sabotage – einen «Terrorakt» – des israelischen Geheimdiensts Mossad handelt. Israel sieht in der nuklearen Aufrüstung des Irans eine Bedrohung der eigenen Sicherheit und wird auch als Urheber anderer Angriffe auf das iranische Atomprogramm verdächtigt. Die israelische Regierung hat die aktuellen Vorwürfe weder dementiert noch bestätigt.
Warum das wichtig ist: In Wien finden derzeit Gespräche zur Erneuerung des Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015 statt. Massgeblich geht es dabei um einen möglichen Wiederbeitritt der USA. Unter Präsident Donald Trump traten die Vereinigten Staaten 2018 aus dem Abkommen aus und verhängten Sanktionen gegen den Iran. Seither verstösst der Iran immer wieder gegen das Abkommen mit den verbleibenden Partnern Russland, China, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien – und verlangt, dass zur Wiedereinhaltung zunächst die Sanktionen aufgehoben werden müssten. Mutmasslich soll Israel mit der Sabotage versucht haben, die Verhandlungsposition des Irans zu schwächen, was Fragen zur Rolle der USA bei den Vorfällen in Natanz aufwirft. Die Regierung Bidens hat sich bislang zurückhaltend geäussert, hielt am Montag aber fest, die USA seien «in keiner Weise involviert» gewesen.
Was als Nächstes geschieht: Die Vorfälle in Natanz haben den Gegnern des Atomabkommens im Iran Aufwind gegeben. Die iranische Regierung führte trotz wachsender Proteste im eigenen Land am Donnerstag die Verhandlungen in Wien weiter. Gleichzeitig hat der Iran eine Anreicherung von Uran auf 60 Prozent angekündigt. Das Atomabkommen erlaubt jedoch lediglich eine Anreicherung auf 3,67 Prozent. Irans Ankündigung sorgt bei den Abkommenspartnern Grossbritannien, Deutschland und Frankreich für grosses Unbehagen. Es handle sich dabei um eine ernste Entwicklung, «da die Herstellung von hoch angereichertem Uran einen wichtigen Schritt zur Produktion einer Nuklearwaffe darstellt», schreiben die drei Staaten in einer gemeinsamen Erklärung.
Japan will verstrahltes Wasser ins Meer leiten
Darum geht es: Japan will mehr als 1,2 Millionen Tonnen Wasser aus dem Atomreaktor Fukushima in den Ozean ablassen. Regierungschef Yoshihide Suga betont, das Niveau radioaktiver Substanzen liege deutlich unterhalb der Grenzwerte. Das Wasser wurde umfangreich gefiltert, trotzdem bleibt das Isotop Tritium zurück, das für Menschen in hoher Konzentration schädlich ist. Japans Nachbarländer protestieren heftig: Das südkoreanische Aussendepartement bestellt den japanischen Botschafter ein und auch aus China kommt scharfe Kritik: «Dieses Vorgehen ist äusserst unverantwortlich und wird der internationalen öffentlichen Gesundheit und Sicherheit ernsthaft schaden.»
Warum das wichtig ist: Seit Jahren schwelt ein Streit um das Wasser, das zur Kühlung der Atomanlage nach der Kernschmelze 2011 verwendet wurde. Die japanische Regierung und die Betreibergesellschaft des Atomkraftwerks stellen sich auf den Standpunkt, dass ab 2022 kein Platz mehr für die mehr als 100 Silos voll mit kontaminiertem Wasser sei. Daher müsse es gereinigt und entsorgt werden. Umweltorganisationen wie Greenpeace versuchen das zu verhindern. Sie fordern, dass das Wasser weiterhin an Land gelagert wird, bis eine neue Technologie erfunden wurde, die es auch wirklich reinigt. Die Organisation «Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges» warnt ebenfalls, das Entsorgen des Wassers sei ein «Horrorszenario»: Tritium werde von Fischen, Meeresfrüchten und Algen aufgenommen – und finde so den Weg auf den Teller des Menschen.
Was als Nächstes geschieht: Unter Wissenschaftlern ist ein Streit entbrannt, inwiefern künftig noch Meeresfrüchte aus der Zone um Fukushima gegessen werden sollten. Die Internationale Atomenergiebehörde hat das Ablassen des Wassers gebilligt. Es sei «eine wichtige Etappe» beim Rückbau des Atomkraftwerks.
Was will Putin mit dem Truppenaufmarsch?
Darum geht es: Nach dem Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine nehmen die Spannungen zwischen Russland und der Nato zu. Jens Stoltenberg, Generalsekretär des Militärbündnisses, forderte Moskau auf, diese Provokation sofort zu stoppen.
Warum das wichtig ist: Was Russland mit der Drohkulisse bezweckt, ist unklar. Offiziell herrscht in den umkämpften Gebieten in der Ukraine ein brüchiger Waffenstillstand. Russland bezeichnet die Truppenverschiebungen als Reaktion auf die erwartete Ankunft von US-Kriegsschiffen im Schwarzen Meer. Manche Beobachterinnen vermuten, dass Russland und die USA mit gegenseitigen Muskelspielen testen wollen, wie die andere Seite reagiert. Andere hingegen sehen eine reale Gefahr eines neuen Krieges in der Ukraine.
Was als Nächstes geschieht: US-Präsident Biden hat Kreml-Chef Putin ein Gipfeltreffen in einem Drittland vorgeschlagen. Im Herbst stehen in Russland Wahlen an, weshalb spekuliert wird, dass Putin versuchen könnte, seine schlechten Umfragewerte aufzupolieren, indem er sich mit einem Einmarsch in der Ukraine als starker Mann inszeniert. Der Westen wird sich hüten, bei einer weiteren Eskalation auf Seiten der Ukraine, die gerne der Nato beitreten würde, militärisch einzugreifen. Stattdessen wollen Länder wie die USA vermehrt Waffen liefern.
Der Corona-Lagebericht
Am Mittwoch hat der Schweizer Bundesrat die eigenen Kriterien kurzerhand verworfen – und deutlich rascher deutlich mehr gelockert, als angesichts der Lage erwartet worden war. Ab Montag dürfen Restaurants draussen Gäste bedienen, Fitnesscenter, Kinos und Sporthallen gehen auf, und bei Veranstaltungen dürfen sich wieder bis zu 50 Menschen im selben Raum aufhalten.
Davon kann man halten, was man will. Ein «moderater Öffnungsschritt», wie es der Bundesrat nannte, ist es aber nicht. Obwohl sich alle wichtigen Kennzahlen seit Ostern verschlechtert haben, erlaubt die Regierung nun auch vergleichsweise riskante Aktivitäten in Innenräumen – etwa das Singen. Ein Grossteil der Bevölkerung ist noch nicht geimpft – und das wird auch noch mindestens einige Wochen so bleiben. Es sind also noch zu wenige immun, um eine Eskalation wie im vergangenen Oktober auszuschliessen. Im Schnitt werden derzeit jeden Tag 2200 Menschen positiv getestet, das sind etwa 600 mehr als in der Vorwoche.
Neuanstieg der Fälle nach Ostern
Positiv getestete Personen: gleitender Mittelwert über 7 Tage
Die Daten nach dem 12. April sind vermutlich noch unvollständig, deshalb haben wir sie nicht berücksichtigt. Stand: 15. April 2021. Quelle: Bundesamt für Gesundheit
Die Spitaleinweisungen steigen weiter an – und ebenso die Zahl der Überweisungen von Covid-19-Erkrankten auf die Intensivstation. Dass diese Patientinnen nun tendenziell jünger werden, hat paradoxerweise den Effekt, dass die Bettenkapazitäten schneller knapp werden könnten als in früheren Wellen. Denn anstatt am Virus relativ rasch zu sterben, sind diese Patienten häufiger über Wochen und Monate schwerstkrank.
Immer mehr Menschen mit Covid-19 im Spital
Spitaleinweisungen: gleitender Mittelwert über 7 Tage
Die Daten nach dem 8. April sind vermutlich noch unvollständig, deshalb haben wir sie nicht berücksichtigt. Stand: 15. April 2021. Quelle: Bundesamt für Gesundheit
Im Vergleich zur Bevölkerungszahl liegen Deutschland und die Schweiz bei den neuen Ansteckungen zwar ungefähr gleichauf. Trotzdem scheint die Lage im Norden vielerorts noch deutlich angespannter. Die Uniklinik in Köln steht beispielsweise kurz vor Einführung der Triage. In anderen Teilen des Landes kommen die Spitäler aber offenbar noch gut klar. Der Gesundheitsminister gab sich am Donnerstag jedenfalls besorgt, dass «die Lage täglich kritischer» werde. Derzeit laufen die Vorbereitungen für landesweit einheitliche Verschärfungen, etwa abendliche Ausgangssperren.
In Italien und Österreich scheinen die vor Ostern erlassenen Massnahmen einen Effekt zu haben. Im Vergleich zur Bevölkerungszahl sind die neuen Ansteckungen jetzt auch in diesen beiden Ländern mit der Schweiz und Deutschland etwa vergleichbar. Ganz anders leider in Frankreich, dort wachsen die Zahlen bisher weiter an. Es ist nun das vierte Land in Europa, in dem 100’000 an Covid-19 gestorben sind – neben Grossbritannien, Italien und Russland.
Zum Schluss: Facebooks Bitchefight
Bitche ist ein französischer Ort mit 5000 Einwohnerinnen im Département Moselle unweit der deutschen Grenze. Weil das heute dazugehört, richtete sich Bitche eine Seite auf Facebook ein. Doch dann funkte der Algorithmus dazwischen, weil er den Namen als anstössig interpretierte: Am 19. März verschwand die Seite von der Plattform. Die Bitchois – oder zu Deutsch: Bitscher – intervenierten, liefen damit aber ebenso ins Leere wie viele andere Nutzerinnen, die mit einem Anliegen an Facebook herantreten. Erst als Medien über die Sperrung berichteten, wurde die Seite wieder aufgeschaltet, und der Frankreich-Chef von Facebook entschuldigte sich persönlich bei Bürgermeister Benoît Kieffer. Dieser zeigte sich generös und lud den obersten Verantwortlichen von Facebook France und auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg in sein Dorf ein. Bei dieser Gelegenheit, so Kieffer, könnte man gemeinsam das Andenken jener US-Soldaten ehren, die das Dorf im Zweiten Weltkrieg befreiten und sich fortan stolz «the sons of Bitche» nannten.
Was sonst noch wichtig war
Schweiz: Interne Mails, die der WOZ zugespielt wurden, wecken den Verdacht, dass sich die Richter der Prozesse gegen Teilnehmer der «Basel-nazifrei»-Proteste abgesprochen haben. Die Verfahren sorgten schweizweit für Aufsehen, weil die Strafen ausserordentlich hoch ausfielen.
Österreich: Gesundheitsminister Rudolf Anschober tritt zurück. Nachdem er schon zweimal einen Kreislaufkollaps erlitten habe, wolle er sich «nicht kaputtmachen». In seiner Rücktrittsrede beklagte er die zunehmende Aggressivität aus Teilen der Bevölkerung und erklärte, er habe sich «sehr oft sehr alleine gefühlt».
Deutschland I: Das Präsidium der CDU will Armin Laschet als Kanzlerkandidaten. Sein Konkurrent Markus Söder von der CSU gibt aber nicht auf. Am Dienstag konnte er bei einer Aussprache der Bundestagsfraktion der Union punkten.
Deutschland II: Das Berliner Gesetz zur Mietenbegrenzung verstösst gemäss einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen das Grundgesetz und ist damit nichtig. Mit dem «Mietendeckel» wollte die Stadt die stetig steigenden Wohnungspreise bekämpfen.
Dänemark: Die Regierung hat das Aufenthaltsrecht für mindestens 189 Geflüchtete aus Syrien nicht verlängert. Dänemark ist das erste europäische Land, das gewisse Gegenden in Syrien als sicher genug für eine Rückkehr betrachtet.
Grossbritannien: Prinz Philipp ist tot. Der Ehemann von Queen Elisabeth II. verstarb zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Er war bekannt für seine Loyalität gegenüber seiner Frau und seinen Hang zu chauvinistischen Sprüchen.
Ecuador: Der konservative Ex-Banker Guillermo Lasso hat die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der linke Gegenkandidat Andrés Arauz gestand seine Niederlage ein. Der neue Präsident verfügt über keine Mehrheit im Parlament und ist mit einer tiefen Wirtschaftskrise konfrontiert.
USA I: Die Biden-Administration verhängt neue Sanktionen gegen Russland und weist Diplomaten aus. Grund: Die US-Behörden machen nun offiziell den russischen Geheimdienst SWR für die «Solarwinds»-Hacking-Attacke letztes Jahr verantwortlich. Zudem sind die Sanktionen eine Reaktion auf die russischen Einmischungen in die US-Wahlen 2020.
USA II: Der Anlagebetrüger Bernie Madoff ist 82-jährig im Gefängnis in North Carolina gestorben. Er sass seit 2009 eine 150-jährige Haftstrafe ab, weil er mit einem gigantischen Schneeballsystem Investoren um Dutzende von Milliarden Dollar gebracht hatte.
China: Die Onlineplattform Alibaba muss wegen Verstössen gegen das Wettbewerbsgesetz eine rekordhohe Busse von umgerechnet über 2 Milliarden Franken bezahlen. Erst im Herbst war einer Tochterfirma von Alibaba der Börsengang verweigert worden.
Die Top-Storys
Leben und Sterben eines Vierfachmörders Am 16. April vor 35 Jahren erschiesst der Chef der Zürcher Baupolizei vier seiner Mitarbeiter und flieht. Es ist einer der grossen Kriminalfälle in der Schweizer Geschichte. Der «Tages-Anzeiger» rekapituliert, unter anderem gestützt auf bisher unveröffentlichte Dokumente, in vier Teilen das Leben des Vierfachmörders Günther Tschanun.
Vom Opfer zum Blender Als Enkel von Rudolf Höss, dem KZ-Kommandanten von Auschwitz, wurde Rainer Höss weltbekannt. Wie jüngst publik wurde, nutzte er seine Bekanntheit, um Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Auch der Autor Sacha Batthyany von der «NZZ am Sonntag» liess sich von Rainer Höss täuschen. Er geht der Frage nach, warum Menschen zu Blendern werden und wie sie jahrelang damit durchkommen.
Hass ohne Boden Manchmal sind es Worte, immer häufiger Schläge: Menschen, die der LGBTQ+-Community angehören, sind in der Schweiz oftmals Hass ausgesetzt. Eine statistische Erfassung homophober Attacken fehlt bis heute. In einer Dokumentation des SRF erzählen Betroffene von einem Leben in Furcht und dem ermüdenden Kampf gegen die Diskriminierung.
Illustration: Till Lauer