
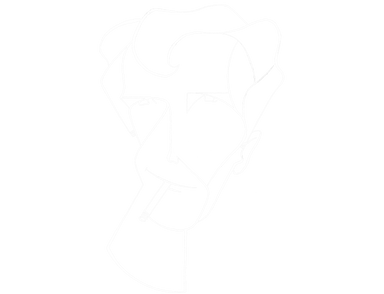
Der, der du niemals sein wirst
Das Umweltproblem
Die ADHS-Kolumne, Folge 7 – Wie Sie so elegant wie möglich auf einem fremden Planeten überleben.
Von Constantin Seibt, 11.06.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Wir hatten ein paar Wochen eine Affäre, als es ernst wurde.
Sie ging ins Bad und blieb ein paar Minuten. Dann kam sie wieder heraus, den Schwangerschaftstest in der Hand. Sie blickte mich länger forschend an, lächelte und sagte: «Negativ.»
Ich war zu meiner Überraschung enttäuscht.
«Schade», sagte ich. «Wir hätten ein hübsches Kind bekommen.»
«Vergiss es. Das wäre keine gute Idee.»
«Warum nicht?», fragte ich.
«Du bist doch nicht lebensfähig», sagte sie und küsste mich auf den Mund.
Ihre Begründung verblüffte mich. Immerhin war ich damals knapp über 30 Jahre alt. Und hatte jeden einzelnen Tag davon überlebt.
Zugegeben, ich verdiente als freier Reporter weniger als eine Putzfrau. Aber ich war überzeugt, dass ich, sobald es zählte, einen ziemlich guten Job finden würde. Und machen würde.
Doch der Zweifel an meiner Überlebenstüchtigkeit war in meiner Jugend verblüffend verbreitet – und ist bis heute nicht gänzlich verschwunden. Wahrscheinlich endet er erst bei meinem Begräbnis.
Der falsche Planet
Damals dachte ich nur, dass sie sich irrte.
Einige Zeit später fiel mir auf, dass Affären oft überraschend wenig mit Intimität zu tun haben. Man ist viel zu sehr beschäftigt, das Spiel zu spielen, um hinzusehen. Miteinander zu schlafen, ist eine erstaunlich gute Möglichkeit, attraktive Menschen nicht kennenzulernen.
Heute, noch viel später, muss ich zugeben: Sie hatte Instinkt. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite.
Die Statistiken sprechen eine klare Sprache. ADHS ist eine hervorragende Voraussetzung, sein Leben zu vermasseln. Man hat eine deutlich erhöhte Neigung zu: Scheidungen, Alkoholismus, Unfällen, Entlassungen, Studienabbruch, Suizid, Depressionen, Drogen, Kriminalität, Bankrotten, Kindern und Firmengründungen.
Der Grund ist nicht zuletzt, dass – egal, welche Religion in unserem Pass steht – wir jeden Morgen nach dem Öffnen der Haustür einen protestantischen Planeten betreten. Einen Planeten, in dem Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und das Aushalten von Langeweile entscheidende Voraussetzung für Erfolg sind – im Beruf, aber auch in der Liebe. (Spätestens, wenn ein Kind kommt und das Leben sich in Organisation verwandelt.) Wer diese Regeln bricht, gilt nicht nur in der Praxis als unbrauchbar, sondern auch als moralisch angeschlagen.
Dass technisch gesehen der Ärger mit ADHS keine Frage des Willens ist, zählt nicht. Klar, es ist hübsch zu wissen, dass nicht bewusste Entscheidungen dafür verantwortlich sind, dass Sie sich in regelmässig unregelmässigen Abständen wie ein Siebenjähriger verhalten. Sondern der Dopaminmangel in Ihrem Frontallappen.
Doch selbst wenn man die Diagnose hat, besteht der Ärger aus zu alltäglichem Unfug, um sich auf Neurologie berufen zu können: schon wieder einen Termin vergessen, einen Bus verpasst, irgendwelche Schlüssel verloren. Zu stupid. Zu banal. Es gibt keine Entschuldigung.
Kein Wunder, sympathisiert man mit seinen Anklägern. Es braucht eine Menge Nerven, regelmässig in die kalten Augen seiner Vorgesetzten, seiner Kollegen, der oder des Geliebten zu blicken. Und kurz darauf im Rasierspiegel in die eigenen kalten Augen.
Das ist eine der wichtigsten Ursachen für die obigen Statistiken: Sobald du mit der Welt zerfällst, zerfällst du mit dir selbst.
Was also tun?
Tricks
In den meisten ADHS-Ratgebern werden alle möglichen Strategien empfohlen, mit denen man sein Leben organisiert. Etwa:
Listen machen (für alles Mögliche – sobald man mitschreibt, merkt man es sich besser);
Agenden führen (je nach Präferenz auf Papier oder im Handy, mit gestelltem Alarm für jeden Unfug);
den täglichen Kram immer an der gleichen Stelle ablegen (wo er dann zur Überraschung aller gelegentlich liegt);
bei Terminen den Weg einberechnen (weil die Quantenphysiker das Beamen nicht erfunden haben);
Hilfskräfte organisieren: eine Putzfrau, eine Steuerberaterin, eine Psychologin. Wobei die wirkliche Lösung leider unbezahlbar ist – ein Butler. (Leopold Kohr, Träger des «Alternativen Nobelpreises», begründete das so: «Denn wer gibt dem Lord, der oft ein nachlässig gekleideter Mann in einem Sessel ist, die Würde? Der Butler!»);
etc.
Das alles ist schön und praktisch – nur fürchte ich, das reicht nicht. Denn letztlich konzentriert man sich so auf seine Defizite. Der Aufwand, Normalität zu simulieren, ist enorm – und trotzdem wird man von jedem neurotypischen Durchschnittsbegabten mühelos überholt.
So sinnvoll es ist, ein Minimum an Verlässlichkeit zu schaffen, man spielt immer ein Auswärtsspiel nach fremden Regeln. Sicher, ein korrekt absolvierter Tag ist Grund zum Stolz – aber das Gefühl dabei ist vor allem Erschöpfung.
Es ist der klassische Fehler, den viele Leute im Moment von Verwirrung und Kraftlosigkeit machen – egal, ob bei Texten, in Beziehungen oder in der Führung von Unternehmen. Man steckt seine Energie in das Ausbügeln der Schwächen.
Was leider heisst: Normalität ist und bleibt für Sie ein feindliches Gebiet. Sie werden das nie elegant hinkriegen. Sie sind schlicht nicht für diese Zivilisation geboren.
Es ist weit klüger, Territorien zu suchen, wo sich die Zivilisation noch nicht ausgebreitet hat. Wo die normalen, vernünftigen, gut erzogenen Leute zittern. Und wo Sie nach den eigenen Regeln spielen.
Um diese zu finden, braucht es doppelt Unverschämtheit: unverschämte Strategien. Und unverschämt Glück.
Mehr Chaos, weniger Ärger
Als Halbwüchsiger las ich – weiss der Teufel, warum – einen Band mit Essays des irischen Dramatikers George Bernard Shaw. Den Inhalt habe ich komplett vergessen, bis auf eine Karikatur. Sie liess mich einen langen Sommernachmittag von einer Militärkarriere träumen.
Ihr Titel war: «Wenn George Bernard Shaw Kommandant der Britischen Armee wäre».
Und sie sah so aus:
Ich war bezaubert. Aber vernünftigerweise verfolgte ich den Plan, Chef der Schweizer Armee zu werden, nicht weiter. Es wäre für beide nicht gut ausgegangen.
Aber mein Instinkt zeigte mir das Richtige.
Ich denke, es ist mit ADHS (oder Ähnlichem) das Geschickteste, die eigene Existenz wie folgt zu begreifen: als Umweltproblem.
Das deshalb, weil man eines hat. Und eines ist.
Wären alle so, gäbe es zwar mehr Chaos, aber weniger Ärger. Doch leider lebt man auf einem empörend gut organisierten Planeten. Und schafft durch die eigene Anwesenheit ein doppeltes Problem: Man löst bei seiner Umwelt Verzweiflung aus und verzweifelt daran.
Also noch mal: Was tun?
Dramaturgie mit beschädigtem Gehirn
Die Dramaturgie von ADHS funktioniert grob gesagt so:
Sie sind nur dann wach und tatkräftig, wenn Sie an einer Sache aufrichtig interessiert sind.
Wenn nicht, hat Ihre Konzentration unvorhersagbare Löcher. Egal, wie objektiv wichtig die Sache für Sie ist.
Sie sind leicht zu begeistern und leicht zu irritieren. Was heisst: Sie sind für sich selbst wie für alle anderen schwer voraussagbar.
Sie haben wenig Menschenkenntnis (nicht zuletzt von sich selbst), dafür eine reiche Erfahrung mit der eigenen und fremden Seltsamkeit.
Sie haben eher wenig Vertrauen – teils in die Welt, sicher von der Welt.
Nun: Mit dem Paket müssen Sie leben. Oder weit präziser gesagt: Mit dem Pfund müssen Sie wuchern.
Eine provisorische Strategie
Denn daraus ergibt sich eine klare Strategie:
1. Folge deinem Herzen
Das Widerlichste bei ADHS ist: wie oft man lügt. Grösstenteils sind es alberne Lügen, weil die Menge deiner Fuck-ups nicht zu erklären ist – sie klingen zu idiotisch für die Wahrheit. Passt du nicht auf, kommen tausend Ausreden.
Sie sind der Grund für einen Grossteil der Verachtung. Aber nicht die ganze Geschichte.
Denn die gleiche mentale Störung zwingt dich zu einem aufrichtigen Leben – weit aufrichtiger als das fast aller anderen Menschen. Schlicht deshalb, weil du die banalsten Dinge nicht auf die Reihe bringst, wenn dein Herz nicht dabei ist. Selbstbetrug wird konsequent bestraft. Glaubst du nur, dass dir etwas wichtig ist, verlierst du früher oder später die Konzentration. Und vermasselst es.
Auf den ersten Blick scheint es beneidenswert, dass diszipliniertere Menschen Dinge mit Vernunft durchziehen können. Aber oft ist es eine Falle. Eine der schlimmsten Tragödien ist, Gleichgültiges oder Widerwärtiges nur für den Erfolg durchzuziehen – und damit Erfolg zu haben. Dann wird man respektiert, bezahlt, geliebt für etwas, das man nie wollte.
Mit ADHS bleibt einem dieses Schicksal erspart. Man hat keine andere Chance als radikale Aufrichtigkeit. Denn man ist nur dort konkurrenzfähig, wo man liebt. Deshalb muss man den Job und die Menschen finden, die einen begeistern. Du brauchst, nur schon für die Alltagsroutine, einen Stern, um ihm zu folgen. Dann lebst du, zwar immer noch ruppig, aber auf der Höhe deiner Fähigkeiten.
Und es ist nur klug, wenn du ein grosses Herz bewahrst. Denn Zweifel blockieren dich. Je strahlender du deine Wohnung, deine Arbeit, deine Kolleginnen, deine Kinder und Partner siehst, desto reibungsloser funktionierst du.
Kurz: Um in der Öffentlichkeit ein halbwegs bürgerliches Leben zu führen, musst du im Geheimen ein ritterliches führen.
2. Wähle die Augen, die dich ansehen
Wenn ich mich frage, warum ich die Uni abbrach, glaube ich, dass die nüchternste Antwort ist: Ich hatte die falsche Strategie. Ich wählte Themen statt Professoren.
Es ist mir im Leben wenig gelungen, wenn nicht jemand an Bord war, dem ich mich verpflichtet fühlte. Diese Menschen, egal, ob Freundinnen, Lehrer, Chefinnen, Kollegen, hatten bei aller Verschiedenheit alle eines gemeinsam: Sie hatten die umwerfende Kühnheit, mir zu vertrauen.
Wie gesagt, mit ADHS ist Vertrauen eine seltene Ware. Und umso begehrenswerter ist sie – und umso weitere Wege bin ich gegangen, wenn man es mir gab.
Das ist keine einfache Sache – die andere Person muss dich lesen können. Und etwa wissen, was «in zehn Minuten» bedeutet: zehn Minuten, zwei Stunden, morgen oder nie. Sie muss einiges an Enttäuschungen wegstecken können. Sie muss die Zuversicht haben, dass sie am Ende mehr Spass als Ärger mit dir hat. Und sie muss dir die Gewissheit geben, dass das so ist.
Im Grunde konnten das nur zwei Typen Mensch: eher konservative, gelassene Menschen mit aufgeräumtem Kopf und Ruhe im Bauch. Oder Partner im Verbrechen – einfallsreiche, grossherzige, skrupellose Schurken und Schurkinnen wie ich.
Ihnen verdanke ich alles, was ich bin. Ich lernte Französischvokabeln für den Französischlehrer, weil dieser philosophische Monologe auf Deutsch hielt, sodass man ihn verstand. Ich lernte schreiben, als ein Kumpel mit mir einen Krimi schrieb: Es war grossartig, keine Kunst mehr zu schreiben, sondern nur noch einen Menschen beeindrucken zu müssen. Eine italienische Studentin, die unten in der Bäckerei arbeitete, erlöste mich in einer endlosen Nacht; seitdem habe ich einen Platz in der Welt. Dass ich die Schule überlebte, ist das Verdienst meines Banknachbarn, der sechs Jahre neben mir blutige Schlachtszenen in alle Hefte zeichnete. Dass ich im Journalismus landete, war die Schuld der Hartnäckigkeit eines grossherzigen, spastischen, furchtbar klugen, früh verstorbenen Redaktors. Und so weiter.
Ich habe entdeckt, dass ich allein nichts lerne, sondern nur, wenn mein Herz an jemandem hängt. Ökonomie etwa lernte ich in einem Sommer in der Kneipe von einem begeisterten Wirtschaftsredaktor. Oder ich wurde vor Blödheit bewahrt, als ich als Halbwüchsiger meiner Schauspieler-Tante in Berlin einen Monolog hielt, dass der Feminismus übertrieben sei, weil eigentlich die Frauen die Männer regierten etc. etc. Worauf meine Tante schweigend im Schatten eine ganze Zigarette rauchte, bevor sie sagte: «Das ist doch alles pubertär.» Worauf ich keines meiner Argumente je wieder äusserte.
Ich merkte auch, dass ich, sobald mein Herz an jemandem hängt, zu Dingen fähig bin, die ich mir nie zugetraut hätte: etwa Kochen, Putzen, Frühaufstehen. Deshalb, weil ich es für sie mache.
Ich weiss, früher töteten Ritter für die Dame ihres Herzens Heiden oder Drachen. Und ja, es ist absurd, mit dem gleichen Motiv die Abwaschmaschine einzuräumen. Aber sie einfach so einzuräumen, würde ich nie tun.
3. Mach ein Drama
Wahrscheinlich schaffte ich die Schule nicht zuletzt deshalb, weil meine Mutter sich für das ganze Unternehmen interessierte: die Lehrer, die Noten, die Hausaufgaben. Und es war empfehlenswert, gut zu sein. Gab ich nach, wurde mit mir gelernt.
Für den Drill bin ich bis heute dankbar: Ich bin sicher, ich hätte mir alle späteren Frechheiten und den Kleinkrieg gegen meine Lehrer ohne die solide Grundlage nicht leisten können.
Das Entscheidende aber war, dass ich dank meiner Mutter die Schule (bis kurz vor der Matur) für unglaublich bedeutend hielt: Ich lebte lange wie ein Börsentrader im Aktienkurs der Noten. Und später hielt ich den Erziehungsauftrag für unabwendbar, den ich mir für meine Lehrer gegeben hatte.
In der Tat war ich immer gut beraten, egal welche Pläne als entscheidend für den Lauf der Welt zu nehmen. Natürlich nehme ich offiziell die Dinge locker: Wen interessiert schon in hundert Jahren, ob ich diesen Artikel hier geschrieben habe oder nicht? Aber wehe, ich denke das wirklich. Passiert mir das, schreibe. ich. kein. Wort. mehr.
Eines der Paradoxe ist, dass ich zumindest die ersten 50 Jahre ein geradezu atemberaubend langweiliges Leben gelebt habe. Ich sass als Baby im Laufgitter, als Kind in der Schule, als Erwachsener in ein paar Cafés, Büros und Betten. Ende der Geschichte.
Als ich doch einmal für eine Reportage nach Japan flog, sah ich auf dem Bordbildschirm Indien, Vietnam, China, die Südsee und weinte. Es waren die Länder, über die ich als Kind so viel in Abenteuerromanen gelesen hatte. Und ich wusste, ich würde sie nie sehen.
Doch die Tränen trockneten. Denn eigentlich war mein Leben eine Kette von Abenteuern: Sobald ich die Haustür öffnete, lag dort Bangkok: bevölkert von exotischen Einheimischen mit seltsamen Ritualen und unklaren Absichten. Das, was anderen leichtfiel – Freunde zu finden, eine Freundin, einen Job, überhaupt herauszufinden, wie Gruppen funktionierten, die Wirtschaft, die Politik, eine Beziehung oder auch nur der eigene Kopf –, fiel mir schwer: In der Praxis waren es fast immer Siebenjahresprojekte.
So pendelte ich zwischen Jahren der Sehnsucht, gefolgt von Jahren des Glücks, wenn ich ein Ziel erreicht hatte. Und lebte dazwischen ein Fussballerleben: erst von Prüfung zu Prüfung, dann von Text zu Text. Je nach Resultat als Teil der Menschheit – oder ihr Gegenteil.
Natürlich, es ist albern, ein derartiges Drama um sein Leben zu machen. Und natürlich, es nervt. Und ja, mir ist ziemlich klar, dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin und dass der ganze Zirkus übertrieben ist.
Aber ihr könnt mich mal, ihr Protestanten. Es ist die einzige Art, wie ich funktioniere. Ich würde keinen Morgen unter die Dusche gehen, wenn es nicht ums Ganze ginge.
4. Low Budget
Eines der vielen grossartigsten Dinge, die meine Eltern taten, war: Meine ganze Schulkarriere bekam ich am wenigsten Taschengeld von der ganzen Klasse.
Das ruinierte mir zwar fürs Erste den Geschmacksinn. Denn in sieben Jahren Gymnasium ass ich mittags kein einziges Mal das Mensa-Menü für 5.20 Franken, sondern immer den Hotdog für 2.20 Franken. Der Senf dazu war gratis, ich nahm ihn gegen den Hunger.
Am Ende hatte ich ein Maturzeugnis und einen Gaumen mit der Oberfläche des Ledersofas vor den Aufenthaltsräumen.
Das war ein kleiner Preis. Denn mit der Differenz kaufte ich Taschenbücher, später auch Zigaretten, und hatte das Gefühl, das Geschäft des Jahrhunderts gemacht zu haben.
Ausserdem gewöhnte ich mich daran, low budget zu leben. Und wenig half mir später mehr weiter. Denn man wird immer in zwei Währungen bezahlt: Geld oder Freiheit. Ich hätte sehr vermögend sein müssen, um mir zwischen zwanzig und dreissig dieselbe Freiheit leisten zu können, die ich mir damals leistete.
Überhaupt glaube ich, dass Reduktion eine gute Wahl ist, wenn man einen leicht überbordenden Kopf hat. Nicht nur an Geld, sondern auch an Interessen. Mit vierzehn fasste ich den Plan für mein Leben: ein Buch schreiben und einmal mit einer Frau schlafen. Mit zweiundzwanzig hatte ich alles erreicht, was ich je wollte. Ich wusste, dass ich ab jetzt sterben könnte. Für die Zeit bis dahin machte ich einen neuen Plan: mehr von beidem. Es war eine gute Idee. Denn das Schreiben und die Liebe sind unendliche Spiele. Man kommt nie an ein Ende.
Daneben kümmerte mich zehn Jahre nichts: nicht meine Einrichtung, nicht meine Karriere, nicht das Essen und Trinken, nicht das Reisen, nichts. Je mehr einem egal ist, desto mehr konzentriert man sich aufs Wesentliche.
Ich hatte zusätzlich das Glück, dass mich kein seriöses Blatt anstellen wollte. Damals boomte der Journalismus. Überall war Geld: Magazinredaktoren flogen erste Klasse nach New York, interviewten einen Musiker, erholten sich eine Woche, flogen zurück, gaben das Tonband ins Sekretariat zum Abtippen und litten die nächsten drei Wochen am Feinschliff.
Was das anrichtete, merkte ich, als wir bei der Firmengründung erfahrene Berufsleute befragten. Eine davon war eine verdiente Journalistin. Sie war bei einem halben Dutzend Neugründungen dabei gewesen. Ich fragte, welches neue Projekt das Spannendste gewesen sei. Sie dachte kurz nach und sagte dann: «Das Beste war ‹Facts›. Das Heft war zwar nicht so toll, aber wir konnten Geld ausgeben wie Heu.»
Das war der Moment, in dem ich merkte, was viele unter Qualitätsjournalismus verstanden: viel Geld ausgeben.
Wenig hat mich besser auf meinen Beruf vorbereitet als eine Jugend in Armut.
Wobei ich das allerdings nie merkte. Ich hatte zwei ziemlich clevere Tricks.
Der erste: Ich hob am Monatsersten jeweils alles Geld ab, fühlte das Geldbündel in der Hosentasche und wusste: Ich bin reich. Am Monatsende konnte ich mir meist nur noch Spaghetti leisten, in bösen Monaten ohne Sauce. Aber das bereitete mir keine Sorgen: Am nächsten Monatsersten würde ich wieder reich sein. Ich war quasi nur Millionär im Exil.
Der zweite Trick: Gegen Neid schützte ich mich durch völlig übertriebene Vorstellungen von Reichtum. Die Beleuchtung meines Frühstückssaals würde dann etwa wie folgt aussehen: 300 halb nackte Tänzerinnen würden je ein ausgewachsenes Krokodil an der Kette halten, wobei die Zähne der Krokodile durch lupenreine Diamanten ersetzt worden waren, worin sich tausendfach das Licht brach, das der flambierte Elefant am Buffet warf … und im Laufe des Tages würde sich der Luxus langsam steigern.
Das funktionierte hervorragend. Ich konnte nie verstehen, wie jemand Marcel Ospel um seine 20-Zimmer-Villa in Wollerau beneiden konnte.
Natürlich hält man das nicht ein Leben lang durch. Lebt man zu zweit, spätestens mit Familie, steigen die Fixkosten dramatisch. Ausserdem kann man sich die Ignoranz seines halben Lebens nicht mehr leisten.
Dann braucht man einen komplexeren Plan. Aber davor gibt es wenig Cooleres als low budget.
5. Barbarengebiete
Wie gesagt: Die zivilisierte Welt ist nicht das Terrain für Sie. Sie sind und haben ein Umweltproblem.
Meine heutige Vermutung ist, dass ich weniger durch eigenes Verdienst ziemlich unbeschadet durch ein halbes Jahrhundert gekommen bin. Sondern weil immer wieder ein ausreichend unzivilisiertes Biotop offen stand.
Das erste sprach mit der Stimme meiner Mutter. Sie las mir und meinem Bruder vor: Dickens, Poe, Somerset Maugham. Ich versank in Abenteuerbüchern.
Bücher waren die richtige Welt für mich – gerade wegen ihrer Zwielichtigkeit: Sie waren gleichzeitig die Flucht vor dem Leben und seine Essenz, ein Abenteuer für Schüchterne, die legalisierte Ehe von Klarheit und Illusion.
Was mich mit zunehmendem Alter faszinierte, war, dass Literatur – genauer: Sprache überhaupt – nicht nur die genauestmögliche Beschreibung der Wirklichkeit liefert, sondern auch ihre schärfste Gegenwelt. Sie ist halb ihr Massanzug, halb ihr Räuber und Mörder. Sobald sie fertig ist, ersetzt die Beschreibung das Beschriebene. Dadurch verwandelt sich die Realität – egal, welche – in Fiktion. Nicht umsonst ist der Kern jeder guten Geschichte das Gegenteil von Alltag: das Unerhörte. Nicht umsonst warnten Pädagogen früher vor Büchern wie heute vor dem Handy.
Das kam mir entgegen: Ich brauchte eine Erklärung für und eine Waffe gegen die Wirklichkeit.
Zwar diente das Buch zunächst vor allem als Schutzschild gegen die Gesellschaft: Ich ging nie ohne aus dem Haus, egal, ob in die Schule, auf Besuch oder an eine Party. Wobei ich oft erleichtert um die Ecke bog und las.
Auf die Idee, einen Beruf daraus zu machen, kam ich, als ich nicht nur Autoren las, sondern auch ihre Biografie. Nicht wenige glichen den Austern, die aus einer Störung Perlen produzierten. Fast keine waren Leute, von denen man einen Gebrauchtwagen gekauft hätte. Es gab also Hoffnung.
Jahrhunderte von Legenden exzentrischer Schriftsteller haben das Gebiet des Schreibens in das Terrain der schwedischen Hausfrau verwandelt: Diese kippt, ebenfalls der Legende nach, vor dem Essen ein halbes Glas Rotwein über das Tischtuch, damit es bereits ruiniert ist und die Gäste entspannt essen können.
Wenn du schreibst, erwartet die Gesellschaft kein gesundes Benehmen, sondern nur gesunde Texte. Was sehr entspannend ist, solange man nicht gerade schreiben muss.
Ich hatte trotzdem Glück, nicht im Literaturbetrieb zu landen. Einsam einen Roman zu schreiben, verlangt mehr Disziplin und Menschenkenntnis, als ich je hatte.
Stattdessen landete ich im Journalismus wie die Unglücklichen, die am ersten Abend im Casino den Jackpot gewinnen: Dann gehen sie wieder hin und hängen fest. Mein erster Artikel war eine Short Story in der «Fabrikzeitung». Ich hoffte im allerbesten Fall auf 200 Franken Honorar. Sie überwiesen 800. Ich blieb hängen.
Für Geld schreiben war eine grosse Erleichterung. Ohne müsste man bei jeder Zeile begründen können, warum sie überhaupt geschrieben sein sollte. Schreibt man für Geld, hat man die beste mögliche Begründung, die es überhaupt fürs Schreiben gibt: Du musst überleben.
Überhaupt ist Journalismus kein schlechtes Reservat für Neurodiversität. Wie überall in der Kommunikationsbranche findet man sowieso erfreulich viele Leute, bei denen man den Verdacht hat, sie könnten auf dem Autismus-Spektrum sein. Sie erledigen beruflich, was sie privat weniger können.
Und sollten Sie ADHS haben, ist der Beruf alles andere als fremd: Sie leben auch so oft von Spiel zu Spiel, denken oder reden zu viel, messen allem, was passiert, übertrieben heftige Bedeutung bei, müssen sowieso jeden Tag immer wie von Neuem beginnen – und dass Sie die Welt weniger verstehen als die Leute an den Nebentischen, ist vielleicht Ihre grösste Stärke.
Denn in der Aufmerksamkeitsbranche läuft es gleich wie in der Luxusindustrie: Normalität ist keine allzu gefragte Ware.
Verstehen Sie die Welt nicht vollständig, ergibt das ein gut verkäufliches Schillern in Ihren Texten. Staunen ist oft interessanter als Gewissheit. Andere schreiben Sandkörner, Sie eine Perle.
Verstehen Sie die Sache erst im letzten Augenblick, haben Sie mehr Frische als Ihre Konkurrenz, die es schon immer wusste.
Der Ökonom Leopold Kohr etwa arbeitete als Emigrant in einer Kohlenmine, als ein Freund ihm schrieb, ob er nicht bei ihnen in der Universität von San Juan in Puerto Rico Professor werden wolle. Kohr telegrafierte sofort zurück: «Gern! Nur nicht für Chemie oder Ökonomie, denn von den beiden verstehe ich nichts.» Das Telegramm kam offensichtlich verstümmelt an, denn die Antwort lautete: «Für Chemie leider nichts mehr frei, aber Ökonomie möglich.» – «Und deshalb bin ich auch kein schlechter Professor geworden», erzählte Kohr später. «Ich lernte den ganzen Stoff vierundzwanzig Stunden vor meinen Studenten. Und meine Kollegen waren natürlich begeistert. Sie sahen ins Vorlesungszimmer und sagten: ‹Das ist so ein richtiger europäischer Gelehrter – der unterrichtet mit sieben aufgeschlagenen Büchern auf dem Pult.›»
Dazu kommt: Ihre Unfähigkeit, etwas abzuschliessen, von dem Sie nicht wirklich überzeugt sind, ist Ihr Gehalt wert. Sie ist zwar alles andere als effizient. Aber unter dem Strich ist es besser, wenn halb interessantes Zeug im Papierkorb landet als in den Gehirnen Ihrer Leser.
Last, but not least ist das wichtigste Rezept beim Schreiben: Aufrichtigkeit. Denn wann immer jemand aufrichtig erzählt, was ihn etwas angeht, ist das Thema egal: Es kann auch seine Briefmarkensammlung sein. Wenn du nur sagst, was dir wichtig ist, und sonst nichts, hört man dir zu.
Später mehr zur Branche. Aber das war ungefähr der Ort, an den es mich verschlagen hat. Weiss der Teufel, welche anderen unzivilisierten Branchen infrage kommen.
Sie wollen trotzdem wissen, welche Orte geeignet wären?
Hier eine der Lieblingserzählungen meines Grossvaters aus dem Berlin der 1930er-Jahre. Damals gab es ein berühmtes Delikatessengeschäft. Ganz Berlin kaufte dort ein: Man war sich einig, dass dort der beste Käse und die beste Wurst verkauft wurden. Die Waren hatten einen unverwechselbaren, würzigen Gout – und die Konkurrenz versuchte vergeblich, das Geheimnis zu knacken.
Eines Tages wurde das Geschäft von der Polizei geschlossen. Ein Lebensmittelinspektor hatte das Lager kontrolliert und entdeckt, dass darüber die Abflussrohre der Toiletten eines ganzen Wohnblocks führen. Und dass diese Rohre undicht waren.
Das Geheimnis des unverwechselbar würzigen Gouts war gelüftet.
Solche Orte meine ich.
Illustration: Alex Solman