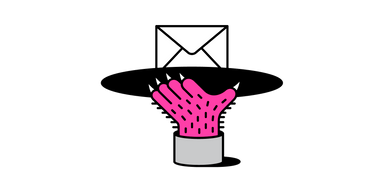
Bundesrat rügt Türkei, wenig Schutz für Asylbewerberinnen – und mehr Waffenexporte
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (73).
Von Philipp Albrecht, Andrea Arežina und Dennis Bühler, 17.10.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Sie fehlen in Verwaltungsräten, Chefredaktionen und im Parlament. In der Gleichstellungsdebatte geht es oft um Frauen, die nicht in die Führungsetagen vordringen, an Sitzungen nicht zu Wort kommen oder auf ihr Äusseres reduziert werden. Bisher kein Thema in der erstarkten Debatte waren Flüchtlingsfrauen. Das könnte sich nun ändern.
Das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte hat die kantonalen Asylunterkünfte im Auftrag der Kantone durchleuchtet und zieht ein bedenkliches Fazit. In einem Bericht bemängelt es, dass in kantonalen Asylunterkünften eine frauenspezifische Unterbringung wie auch ein Gewaltschutz fehlen. So hat eine Frau in einer Asylunterkunft ihre Schwangerschaft unfreiwillig abgebrochen, nachdem sie eine Übersetzung falsch verstanden hatte. Eine Dolmetscherin fehlte an diesem Tag.
Auch der Bund hat seine eigenen Asylzentren untersucht. Seine Analyse zur Situation der Flüchtlingsfrauen fällt weniger kritisch aus. Entsprechend blass bleiben die angekündigten Massnahmen.
So sieht eine von insgesamt 18 Massnahmen vor, dass Gynäkologinnen und Kinderärzte künftig auf einen Dolmetscherdienst zurückgreifen können – aber nur per Telefon. Ein solcher Dienst dürfte in Notfällen kaum genügen. Für einen Dolmetscher vor Ort möchte der Bund erst dann aufkommen, wenn keine andere Art der Verständigung möglich ist.
Beide Analysen gehen zurück auf einen Vorstoss der SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Gut möglich, dass Bundesrätin Karin Keller-Sutter die vorgeschlagenen Massnahmen zum Schutz der Flüchtlingsfrauen ergreifen wird. Schon einmal hat sie in Gleichstellungsfragen die Pionierinnenrolle eingenommen. Als Regierungsrätin im Kanton St. Gallen bekämpfte sie häusliche Gewalt und setzte sich für den Schutz der Opfer ein. Macht sie sich nun auch für geflüchtete Frauen stark?
Wir werden im Briefing aus Bern darüber berichten. Jetzt aber zum Wichtigsten der vergangenen Woche.
Register für Lobbying gefordert
Worum es geht: Regula Rytz, die Präsidentin der Grünen, verlangt ein öffentliches Register, in das sämtliche Treffen zwischen Parlamentarierinnen und Lobbyisten eingetragen werden müssen. Dazu hat sie eine parlamentarische Initiative eingereicht, die auch von Kollegen aus der SVP, der CVP und der GLP unterstützt wird. Die neue Initiative orientiert sich am sogenannten legislativen Fussabdruck, der dieses Jahr im EU-Parlament eingeführt wurde.
Warum Sie das wissen müssen: Im Wahlkampfjahr haben sich viele Kandidaten dem Thema Lobbying verschrieben. Darunter Lukas Reimann (SVP), Andrea Caroni (FDP), Cédric Wermuth (SP) und nun auch die Grüne Regula Rytz. Im Zentrum steht die Frage, ob sich Parlamentarier mit gut bezahlten Nebenämtern korrumpieren lassen. Die Republik hat ausführlich darüber berichtet. Ein solches Register würde bezahlte Nebenämter zwar nicht verbieten, aber mehr Transparenz schaffen – und die Öffentlichkeit könnte ihre Parlamentarierinnen zur Rechenschaft ziehen.
Wie es weitergeht: Zuerst behandelt der Nationalrat die Initiative von Rytz. Wann das genau sein wird, ist noch offen. Danach folgt der Ständerat. Die Chancen für die Initiative sind nicht besonders gross. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Vorstösse abgelehnt, die mehr Transparenz im Parlament verlangten. Entscheidend könnte sein, wie stark sich das Parlament bei den Wahlen nun verjüngen wird. Laut SVP-Nationalrat Lukas Reimann (37) sind die älteren Parlamentsmitglieder verantwortlich dafür, dass viele Transparenzvorstösse abgelehnt wurden.
Genug Unterschriften für Initiative gegen Tabakwerbung
Worum es geht: Die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» ist zustande gekommen. Hinter dem Anliegen stehen verschiedene Gesundheitsorganisationen. Sie verlangen, dass Zigarettenwerbung auf Plakaten im öffentlichen Raum in der ganzen Schweiz verboten wird.
Warum das wichtig ist: Wer als Jugendlicher keine Zigaretten raucht, wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit auch später nicht tun. Deshalb gilt es, Kinder und Jugendliche so früh wie möglich aufzuklären und vom Rauchen abzuhalten. Noch im Jahr 2016 wollte das Parlament nichts von einer Einschränkung bei der Tabakwerbung wissen. Nun hat sich unter dem Druck der Initiative ein Sinneswandel eingestellt. Diesen Herbst hat der Ständerat ein Gesetz verabschiedet, das ein Werbeverbot für Zigaretten in Zeitungen und im Internet vorsieht. Anders, als es die Initiative vorschlägt, bleibt Werbung im Kino aber weiterhin zulässig.
Wie es weitergeht: Als Nächstes werden Parlament und Bundesrat über die Initiative beraten müssen. Gut möglich, dass sie einen Gegenvorschlag ausarbeiten werden, um die Initianten zu einem Rückzug zu bewegen.
Schweizer Waffenexporte nehmen stark zu
Worum es geht: Von Januar bis September 2019 haben Schweizer Unternehmen Kriegsmaterial im Wert von fast einer halben Milliarde Franken exportiert – also für rund 200 Millionen Franken mehr als in den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Dies zeigt eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) veröffentlichte Statistik. Die grössten Abnehmer waren Dänemark und Deutschland.
Was Sie wissen müssen: Waffenexporte sind seit je umstritten, der Gegenwind aber hat in letzter Zeit noch einmal markant zugenommen. So kam im Sommer die von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) und mehreren Parteien lancierte Volksinitiative gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer zustande, kurz Korrekturinitiative genannt. Sie verlangt, dass Waffen künftig nicht mehr in Länder geliefert werden dürfen, in denen Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzt werden. Heute sind Exporte nur dann verboten, wenn ein hohes Risiko besteht, dass das Schweizer Material für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen eingesetzt wird. Erwartungsgemäss kritisierte die GSoA die jüngste Zunahme der Exporte: Die Schweiz solle Frieden fördern, statt Konflikte und Kriege weiter anzuheizen, schrieb sie in einer Mitteilung. Besonders störend seien Ausfuhren in Länder, die am Jemen-Krieg beteiligt sind, etwa nach Bahrain oder Saudiarabien.
Wie es weitergeht: Die Korrekturinitiative kommt im kommenden Jahr ins Parlament und frühestens 2021 an die Urne. Im Zusammenhang mit der türkischen Invasion in Nordsyrien wird sie aber wohl schon in den nächsten Tagen zu reden geben. Im vergangenen Jahr nämlich hat die Schweiz für knapp 100’000 Franken Kriegsmaterial in die Türkei geliefert (dabei handelte es sich primär um Ersatzteile zu früher gelieferten Flugabwehrsystemen). Die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf fordert nun einen vollen Stopp des Exports von Kriegsmaterial, wie ihn Norwegen vergangene Woche bereits beschlossen hat. Werde sie wiedergewählt, werde sie sich in der Dezembersession an den Bundesrat wenden, kündigte sie an.
Bundesrat richtet scharfe Worte an die Türkei
Worum es geht: Eine Woche nachdem die türkische Armee in Syrien einmarschiert war, richtete der Bundesrat gestern scharfe Worte an die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan. Er verurteile die militärische Intervention und erachte sie «als Verstoss gegen die Uno-Charta und somit als völkerrechtswidrig», schrieb er in einer Mitteilung. Die Türkei ruft er auf, alle Kampfhandlungen sofort einzustellen und über den Verhandlungsweg auf eine Deeskalation und eine politische Lösung der Konflikte hinzuwirken.
Was Sie wissen müssen: Das Verhältnis der Schweiz zur Türkei steht vor einer bedeutenden Weichenstellung. Noch im Sommer war weitgehend unbestritten, dass die beiden Länder stärker miteinander geschäften sollen: Deutlich genehmigten National- und Ständerat das revidierte Freihandelsabkommen mit der Türkei, die mit einem Handelsvolumen von jährlich 3,3 Milliarden Franken Rang 21 der Schweizer Handelsstatistik einnimmt. Vergangene Woche lief die Referendumsfrist ab, der Ball liegt nun beim Bundesrat. Der türkische Einmarsch in Syrien bringt ihn in eine delikate Situation: Soll er das Freihandelsabkommen trotz der Kriegshandlungen zeitnah ratifizieren? Tut er es nicht und spielt er auf Zeit, gelten für Schweizer Firmen im Handel mit der Türkei weiterhin höhere Hürden als für Unternehmen aus dem EU-Raum. Im gestern verschickten Communiqué äusserte sich der Bundesrat nicht zu seinen diesbezüglichen Plänen.
Wie es weitergeht: In den nächsten Tagen dürfte der Bundesrat seine diplomatischen Bemühungen verstärken, einen Beitrag zur Beilegung der diversen Konflikte in Syrien zu leisten. So unterstützt er etwa aktiv den Vorschlag des Uno-Sonderbeauftragten für Syrien, in Genf einen syrischen Verfassungsausschuss einzuberufen. Mit seinen aussergewöhnlich scharfen Worten an die Türkei hat der Bundesrat die Schweizer Position geklärt: Verletzungen des Völkerrechts werden nicht toleriert.
Die Zahl: 2 Tote pro Woche, weil Organe fehlen
In der Schweiz warten derzeit 1398 Patienten auf ein Spenderorgan. Das zeigt eine Statistik der Nationalen Stiftung für Organspende und Transplantation (Swisstransplant). Am häufigsten werden Nieren benötigt, gefolgt von Lebern und Herzen.
Weil passende Organe fehlen, sterben jede Woche durchschnittlich 2 Menschen. Und das, obwohl die Spendenbereitschaft gemäss einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2015 eigentlich hoch wäre: Rund drei Viertel der Befragten erklärten sich damals bereit, ihre Organe nach dem Tod zur Spende freizugeben. Aber nur die Hälfte davon hat ihren Willen dokumentiert.
Das lässt sich mit wenigen Klicks ändern: Seit Swisstransplant vor einem Jahr das Nationale Organspenderegister eingeführt hat, kann man seinen Spendeentscheid online festhalten. Bis anhin haben sich gut 65’000 Personen registriert. 91 Prozent von ihnen stimmen einer Organspende zu, 6 Prozent lehnen sie ab, und die restlichen 3 Prozent bieten entweder nur einen Teil ihrer Organe an oder wollen, dass im Todesfall eine Vertrauensperson für sie entscheidet.
Illustration: Till Lauer