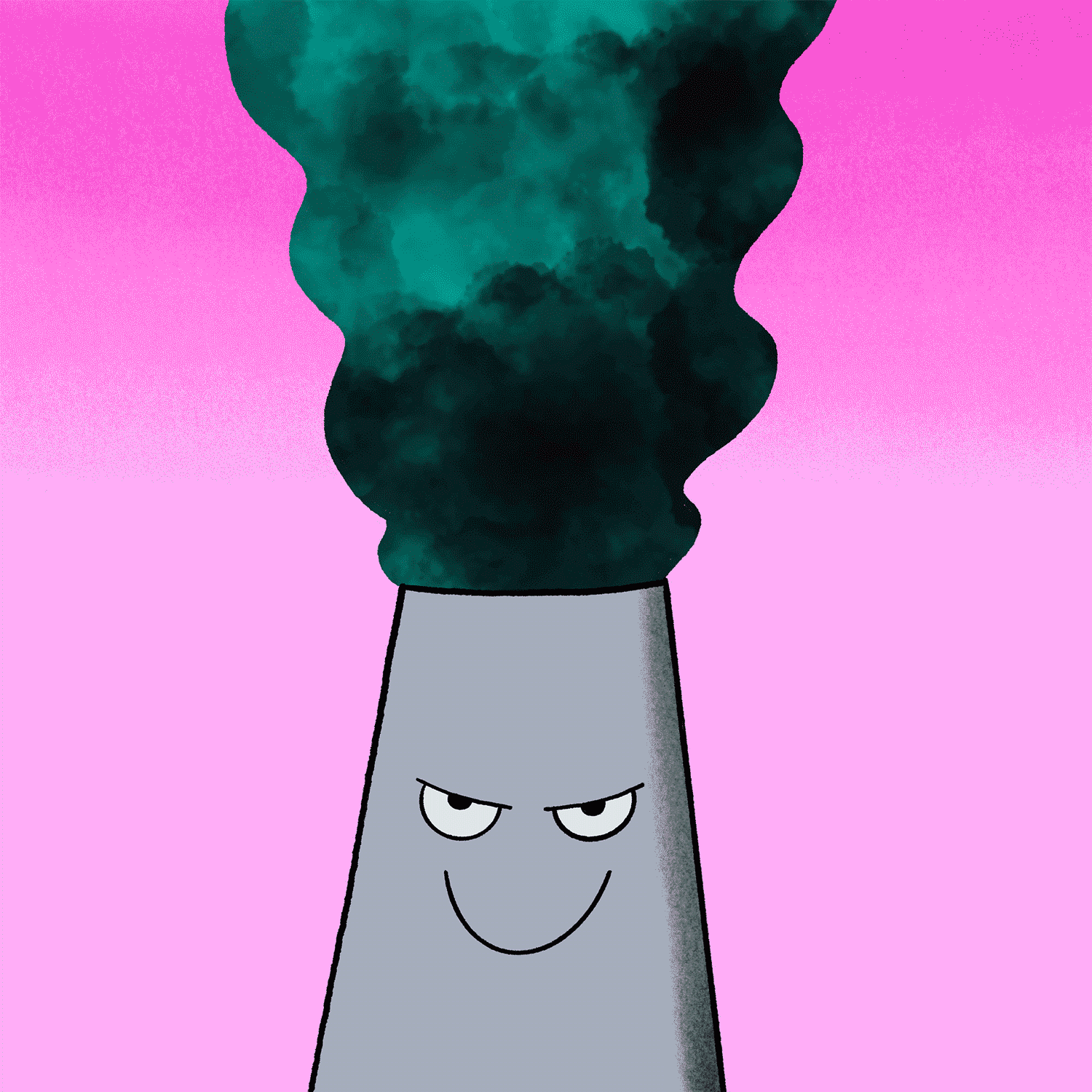
Und dann saugen wir es einfach ab
Die Schweiz muss klimaneutral werden. Das geht nicht ohne Technologien, die Kohlendioxid aus der Luft entfernen. Doch niemand weiss, wie das im grossen Stil funktionieren soll.
Von Cornelia Eisenach (Text) und Lisa Rock (Illustration), 23.01.2024
Cyril Brunner lebt auf kleinem Fusse. Zumindest, was seinen CO2-Fussabdruck angeht. Den hat er nämlich drastisch reduziert: Sein Strom kommt grösstenteils aus erneuerbaren Energiequellen. Das Haus, in dem er wohnt, heizt eine Wärmepumpe. Den Weg zu seinem Arbeitsort in der Forschungsgruppe für Klimaphysik an der ETH Zürich legt er jeden Morgen mit dem Velo zurück, bei schlechtem Wetter mit dem ÖV.
Er fliegt nie. In die Ferien fuhr er zuletzt nach Norwegen. Mit einem Elektroauto, das er mit Kollegen teilt. Auch den Alltagskonsum hat er drastisch zurückgefahren: Alle zwei Jahre ein neues Handy, jede Saison neue Kleider – das gibt es bei ihm nicht. Oft kauft er Gebrauchtes. Trotzdem empfindet er seinen geringen CO2-Fussabdruck nicht als Einschränkung.
«Ganz ehrlich», sagt er, «ich wüsste nicht, was ich gern hätte, aber aus Klimaschutzgründen nicht haben kann.»
Auf null Emissionen kommt der Klimaforscher Cyril Brunner bei aller Mühe trotzdem nicht. Auch er stösst jedes Jahr 5 Tonnen CO2 aus (der Schweizer Durchschnitt beträgt 12 Tonnen). Allein wer in diesem Land wohnt und die Strasseninfrastruktur, sauberes Wasser oder das Gesundheitssystem nutzt, pustet laut Footprint-Rechner des WWF im Jahr mindestens 2 Tonnen CO2 in die Luft. Auch die Ernährung verursacht Treibhausgase, selbst dann, wenn sie vegan ist.
Was Brunner im Kleinen erlebt, spiegelt sich im Grossen. Bis 2050 will die Schweiz klimaneutral sein und die heute 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente auf netto null senken. Aber gemäss der langfristigen Klimastrategie des Bundes wird die Schweiz auch dann noch 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausstossen.
Diese 12 Millionen Tonnen gelten als «schwer vermeidbar». Sie entstehen beispielsweise in der Landwirtschaft: Kühe stossen Methan aus, auch beim Reisanbau entsteht das Gas. Die Herstellung von Dünger und das Beackern von Böden setzen Treibhausgase frei. Und in Kläranlagen, bei der Kehrichtverbrennung, in Stahl- und Zementbetrieben sowie beim Einsatz von Narkosemitteln entstehen ebenfalls Emissionen, die sich bisher kaum verhindern lassen.
Schulden machen und tilgen
Um im Jahr 2050 dennoch auf netto null Emissionen zu kommen, sieht das neue Klimaschutzgesetz sogenannte Negativemissionen vor. Es soll nächstes Jahr in Kraft treten.
Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich ein einfaches Prinzip. Stellen Sie sich ein Konto vor: Die Schweiz macht 12 Millionen Schulden pro Jahr. Um eine schwarze Null unter dem Strich setzen zu können, muss man entweder weniger Schulden anhäufen oder ein Einkommen erzielen, das die Schulden ausgleicht.
Einen Teil dieser Schulden will man vermeiden: Etwa 5 Millionen Tonnen der Restemissionen will man dort abfangen, wo sie entstehen, und dann speichern. Zum Beispiel durch den Einbau eines CO2-Filters in einem Zementwerk. Pipelines sollen das abgefangene Gas ins Ausland leiten, etwa zur Speicherung unter der Nordsee. Das System heisst: Carbon capture and storage (CCS).
Die verbleibenden 7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr will man durch aktive Entfernung aus der Luft holen. Das sind die sogenannten Negativemissionen zur Tilgung der Schulden. Der Bundesrat fokussiert laut einem Bericht vom Mai 2022 auf zwei Technologien, die bisher allerdings noch nicht im grossen Stil erprobt sind: das Verfahren Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung (Bioenergy with carbon capture and storage, BECCS) im Inland. Und die direkte CO2-Entfernung aus der Luft (Direct Air Capture, DAC), das primär im Ausland zum Einsatz kommen soll, dort, wo es Speichermöglichkeiten und ausreichend erneuerbare Energiequellen gibt. Einen Überblick über weitere Methoden zur CO2-Entfernung, ihre Vor- und Nachteile, gibt dieser Republik-Artikel.
Das Verfahren zur direkten CO2-Entfernung aus der Luft wendet zum Beispiel das Schweizer Start-up Climeworks an, das der Bund auch finanziell unterstützt hat. Climeworks betreibt eine DAC-Anlage in Island. Dort saugen riesige Ventilatoren die Luft in Kollektoren, in denen die CO2-Moleküle herausgefiltert werden. Sind die Filter voll, werden sie auf 100 Grad Celsius erhitzt. Das CO2 löst sich, wird aufgefangen und unterirdisch gespeichert.
Aus physikalischer Sicht ist das die Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Auf ein Molekül Kohlendioxid kommen in der Luft etwa 2500 Moleküle anderer Gase. Es müssen also riesige Mengen Luft bewegt werden. Das Ganze erfordert enorm viel Energie und Wärme – die Anlage in Island bezieht sie aus klimaneutraler Geothermie. Sie hat die Kapazität, jährlich 4000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre zu filtern.
Ist das realistisch?
Wie und in welchem Umfang es solche Technologien braucht, darüber herrscht Uneinigkeit unter Wissenschaftlerinnen. Cyril Brunner formuliert es so: «Bei der Frage, ob es den Klimawandel gibt und ob er menschengemacht ist, gibt es eine Ja-Nein-Antwort. Die gibt es bei den Technologien nicht.»
Für die einen sind sie Symbol eines Tech-Optimismus, einer Scheinlösung, die es Politikerinnen und Unternehmen erspart, radikal Emissionen zu senken, und die ein «Weiter-wie-bisher» fördert. Für die anderen sind die Technologien schlicht eine Notwendigkeit, um die letzten Meter zu netto null zu schaffen, ihre Entwicklung und ihr weltweiter Einsatz nur eine Frage von Ingenieurskunst und der richtigen ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen.
Eine Frage, an der sich die Geister scheiden, ist die Machbarkeit im grossen Massstab. Denn global gesehen müssten wir im Jahr 2050 laut den Szenarien des Weltklimarats 6 bis 17 Milliarden Tonnen CO2 an Restemissionen aus der Atmosphäre zurückholen. Das ist mindestens eine Million Mal mehr, als die Climeworks-Anlage in Island derzeit leistet. Heute können wir durch das DAC-Verfahren nur ein paar Sekunden der CO2-Emissionen eines Jahres rückgängig machen. Wir müssten bis 2050 aber mehrere Wochen schaffen.
Solche riesigen Mengen an CO2 zu entnehmen, bei einem derzeitigen Marktpreis um 680 Dollar pro Tonne, verursacht enorme Kosten. Sie werden durch Skaleneffekte zwar sinken. Aber so weit, dass die CO2-Entfernung sich auch rechnet?
Bei der Firma Climeworks arbeitet man bereits an der Skalierung. In einigen Wochen wird in Island eine neue DAC-Anlage die Arbeit aufnehmen, die bis zu 36’000 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft fischen soll. Bis 2030 will die Firma Megatonnen, bis 2050 Gigatonnen entfernen können, an Standorten in den USA, Kenia und Kanada. Für das Jahr 2050 und darüber hinaus rechnet man damit, dass der Preis dafür auf 100 bis 300 Dollar pro Tonne CO2 sinkt.
«Die Erreichung einer Gigatonne CO2-Entfernung bis 2050 mag wie eine gigantische Aufgabe erscheinen», sagt Climeworks-Co-Gründer Jan Wurzbacher. «Aber wenn man sie in Zwischenschritte unterteilt, wird sie Schritt für Schritt erreichbar.» Die Erfolgsfaktoren seien die richtigen Investitionen – sei es von Investoren, Kunden oder staatlicher Seite –, schnelle Genehmigungsverfahren für sichere und permanente CO2-Speicher sowie die Bereitstellung erneuerbarer Energiequellen.
Grosse Mengen erneuerbarer Energie sind für das zweite Verfahren, auf das der Bundesrat setzt, das BECCS-Verfahren, zwar nicht nötig. Aber es gibt andere Probleme: Für die «Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung» (BECCS) werden Pflanzen angebaut, beispielsweise Gräser. Sie fixieren über Photosynthese Kohlendioxid aus der Luft und werden anschliessend verbrannt. Die entstehenden Treibhausgase fängt man über einen Filter ab, sammelt und speichert sie.
Dabei entsteht zwar Energie, aber das Verfahren ist auf Unmengen Biomasse angewiesen, die wiederum viel Fläche und Wasser zum Wachsen benötigt. Das sind Ressourcen, die eh schon knapp sind und zudem für die Nahrungsmittelproduktion gebraucht werden. Die nötigen Kraftwerke lassen sich nicht so leicht skalieren. Ausserdem ist für solche Fabriken eine ganz neue Infrastruktur nötig, etwa die Pipelines, die das Gas zu Speicherorten transportieren.
«Bisher hat niemand das Verfahren im grossen Massstab zum Laufen gebracht», sagt Glen Peters. Er ist Klimaforscher am Cicero (Center for International Climate Research) in Norwegen und als Leitautor des sechsten Berichts des Weltklimarats Spezialist für Emissionsszenarien.
Ob diese Technologien dereinst so laufen, dass wir damit die Restemissionen weltweit in den Griff kriegen, und das zu einem akzeptablen Preis? «Die Zeit wird es zeigen», sagt Peters. «Momentan wissen wir es einfach noch nicht. Aber was wir wissen: So ziemlich alles andere, was man tun kann, um den Klimawandel einzudämmen und die Emissionen zu senken, ist billiger.»
Technologien verzögern Klimaschutz
Ein anderer Aspekt, der oft Kritik an den Technologien hervorruft, ist ihre kommunikationstechnische Wirkung. Denn wenn man das CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückholen kann, dann könnte man fossile Brennstoffe ja auch weiter verbrennen oder wenigstens etwas länger verbrennen. Aus rein physikalischer Sicht ist es letztlich egal, ob wir CO2-Emissionen vermeiden oder sie rückgängig machen.
Der US-amerikanische Erdölkonzern Occidental Petroleum investiert derzeit beispielsweise eine Milliarde Dollar in eine Fabrik in Texas, die ähnlich wie Climeworks CO2 aus der Luft entfernen soll. 135 solcher Fabriken will der Konzern bis 2035 bauen. Sie sollen das CO2, das bei der Verbrennung des verkauften Öls und Gases entsteht, wieder einfangen und die gesamten Tätigkeiten des Konzerns auf netto null Emissionen bringen. So hoffe man, weiterhin in die Rohölförderung investieren zu können, sagte dessen CEO Vicki Hollub vergangenes Jahr.
Auch IT-Konzerne investieren in CO2-Entfernung. Microsoft etwa bezahlt Climeworks dafür, dass es nicht nur seinen jährlichen CO2-Ausstoss wieder rückgängig macht, sondern den jeglicher Treibhausgase, für die der Konzern seit seiner Existenz verantwortlich ist.
«Solche Investitionen sind eine Möglichkeit für Firmen, ins Handeln zu kommen», erklärt Glen Peters. «Doch die wirklich schwierigen und notwendigen Handlungen vermeiden sie», sagt Peters und meint damit, das Unternehmen solle politisch Druck machen, damit die Energieversorgung des Landes schneller CO2-neutral wird.
Die pure Existenz der CO2-Entfernung in den Szenarien des Weltklimarats oder auch der Schweizer Klimastrategie verzögert demnach die unverzügliche und drastische Reduktion von Treibhausgasen.
Der Klimawissenschaftler Kevin Anderson von der Universität Manchester warnte kürzlich in einem Kommentar: Durch die CO2-Entfernung in den Klimamodellen würden «sowohl eindeutige politische Entscheidungen umgangen als auch die heutigen politischen Normen verankert». Sie sei «eher ein politischer Spielball als eine ernsthafte technische Option». Seine Kollegin Lili Fuhr vom Center for International and Environmental Law (Ciel) spricht im selben Kommentar von «falschen Lösungen und gefährlicher Ablenkung».
Dass wir die Technologien in der Zukunft brauchen, davon ist Klimawissenschaftler Peters überzeugt. Allerdings nicht, um weiterhin Öl zu fördern oder um ein Produkt oder eine Dienstleistung als klimaneutral zu verkaufen, sondern nur für schwer vermeidbare Emissionen, also etwa in der Landwirtschaft, der Stahl- und Zementindustrie oder der Luftfahrt. Und dafür, die Erderwärmung eines Tages sogar rückgängig zu machen. So, dass wir das 1,5-Grad-Ziel auch dann noch erreichen, wenn die globalen Temperaturen zeitweise darüber liegen.
Wie es gelingen kann
Die Frage, welche Emissionen als «schwer vermeidbar» eingestuft würden, müsse gesellschaftlich ausgehandelt werden, sagt der ETH-Klimaforscher Cyril Brunner. Der Bundesrat etwa definiert Sektoren, die nach 2050 noch emittieren dürfen, etwa die Landwirtschaft und die Industrie. Doch Brunner ist skeptisch. Es werde in allen Sektoren Restemissionen geben, wenn auch kleine, sagt er.
Ein anderer Ansatzpunkt sei die sogenannte Grenzkostenanalyse. Sie folgt der Frage: Ist es billiger, eine Emission zu vermeiden oder für ihre Entfernung zu bezahlen? Bei einem Tonnenpreis für die Entfernung von 400 US-Dollar wären 15 Prozent der globalen Emissionen «schwer vermeidbar».
Gemäss einer solchen Analyse kann es billiger sein, über das Netto-null-Ziel von 2050 hinaus mit Kerosin zu fliegen und die CO2-Emissionen danach zu entfernen anstatt mit synthetischen Treibstoffen. Unter anderem deshalb taucht die Luftfahrt in manchen Klimaszenarien unter «schwer vermeidbar» auf.
Wie viel es letztlich kosten werde, eine Tonne CO2 zu entfernen, und ob es immer günstiger sein wird, sie zu vermeiden statt zu entfernen, sei schwierig einzuschätzen, sagt Brunner. «Es gibt viele Abschätzungen zu der Kostenfrage. Ich glaube, sie sind alle falsch, weil dieser Sektor noch ganz am Anfang steht.»
Brunner selbst bezahlt für die Entfernung des restlichen Kohlendioxids, das er trotz seines klimabewussten Lebensstils ausstösst, unter anderem bei Climeworks und bei einer schwedischen Firma, die CO2 mittels Pflanzenkohle im Boden anreichert. So kommt er tatsächlich auf netto null, auch wenn dies für ihn nur ein Nebeneffekt ist. Primär bezahlt er, weil er die Firmen unterstützen möchte. «Ich erwarte nicht, dass das alle machen. Wir müssen als Gesellschaft schauen, dass wir auf netto null kommen, nicht individuell», sagt Brunner.
Soll sich die CO2-Entfernung eines Tages rentieren, braucht es einen Markt und einen globalen Kohlenstoffpreis, argumentieren Expertinnen. Bisher haben die wenigsten Länder weltweit einen solchen Preis.
Wenn sich die CO2-Entfernung für Unternehmen rentiere, dann könne die Skalierung der Technologie sehr schnell gehen, sagt Brunner. So wie auch der Preis für Solarzellen und Batterien durch ihre massenhafte Anwendung massiv gesunken ist. «Die Nachfrage wird zunehmen», sagt Brunner. Die CO2-Entfernung werde sich zu einem globalen industriellen Sektor entwickeln.
Für Cyril Brunner ist das Problem der restlichen CO2-Emissionen ein Abfallproblem. Früher hätten die Leute ihren Abfall im Wald entsorgt, heute sei es in den meisten Schweizer Kantonen komplett normal, eine Gebühr in Form von Kehrichtsäcken für die Entsorgung zu zahlen. Eine solche «Aufräumgebühr» liesse sich zum Beispiel auf den Preis für fossile Brenn- und Treibstoffe aufschlagen.
Beim derzeitigen Preis für das «Aufräumen» einer Tonne CO2 durch das DAC-Verfahren würde dies bedeuten: Wer in einer Netto-null-Gesellschaft einen alten Ferrari mit Verbrennungsmotor fahren wolle, müsse dann etwa 1.88 Franken mehr pro Liter Benzin ausgeben.
Cyril Brunner schreibt selbst keine wissenschaftlichen Forschungsarbeiten mehr. Er sagt: «Wir wissen genug.» Stattdessen konzentriert er sich darauf, das Wissen aus der Forschung in die Öffentlichkeit zu tragen. Menschen hätten oft Angst vor Neuem, vor den Veränderungen, die für den Klimaschutz notwendig sind.
«Viele können es sich nicht vorstellen, wie ein Leben mit netto null CO2-Emissionen aussieht», sagt Brunner. Er arbeitet daran, dass sich das ändert.
In einer früheren Version haben wir an zwei Stellen von «5 Tonnen» beziehungsweise «7 Tonnen» geschrieben, korrekt ist «5 Millionen Tonnen» und «7 Millionen Tonnen». Die Stellen sind mittlerweile korrigiert und wir bedanken uns für den Hinweis aus der Verlegerschaft.