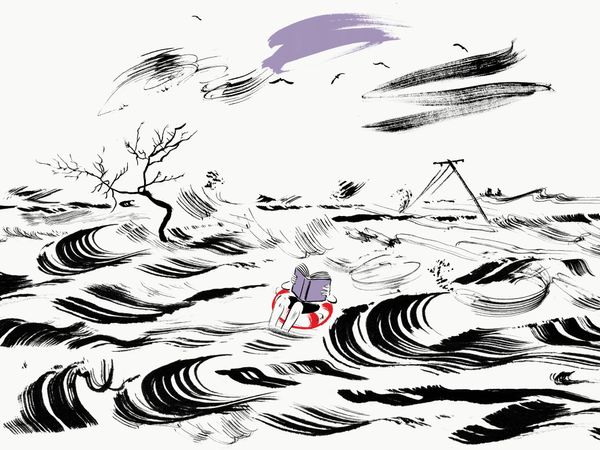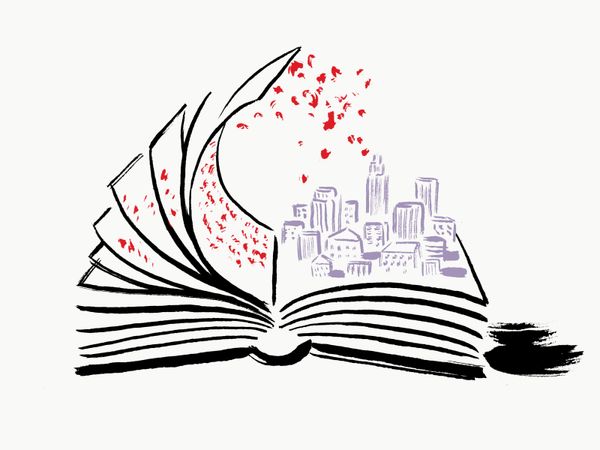Was heisst hier «Naturschutzgebiet»?
Die Schweizer Autorin Gianna Molinari hat ihren zweiten Roman vorgelegt. Er zeigt exemplarisch, was Literatur für das Verstehen der Klimakrise leisten kann. «Literatur im Klimanotstand», Folge 1.
Von Daniel Graf (Text) und Jan Robert Dünnweller (Illustration), 15.11.2023
Der Grönlandhai muss noch ein wenig warten, da unten in der Tiefsee, bis Dora den Blick auf ihn, den Erblindeten, lenkt. Zuerst muss sich das Forschungsschiff, auf dem Dora Richtung Arktis unterwegs ist, seinen Weg durchs Polarmeer bahnen, während zu Hause im Dorf bei Doras Tochter Pina und bei Lobo, dem Waisenjungen, der nächste Wachstumsschub ausbleibt. Beide haben sie das Grösserwerden eingestellt, wobei die Hintergründe fürs Erste ebenso im Dunkeln bleiben wie der Grönlandhai.
Sicher ist bloss: Für das winzige Dorf ist der Wachstumsstopp der beiden Kinder eine Katastrophe, schliesslich sind sie die Zukunft. Alle anderen potenziellen Zukünfte sind längst weggezogen, das Dorf schrumpfte schon seit Jahren, ebenso wie «die Schule schrumpfte, bis sie ganz verschwunden» sein würde. Nur die «riesengrosse Hecke», einst die Touristenattraktion der Gegend und der ganze Stolz der Dorfbewohner, wächst noch beständig, auch wenn Frau Werk, der Gärtnerin im Dorf, schon Übles schwant: «Sollte das Schrumpfen auf die Hecke übergreifen, dann ist endgültig Schluss.»
Gianna Molinari, mit ihrem Debüt 2018 vielfach ausgezeichnet und für den Schweizer Buchpreis nominiert, hat sich für ihren zweiten Roman ein doppeltes Setting gewählt: die Weite einer Polarmeer-Expedition und die Enge einer dörflichen Miniaturwelt. Beide Stränge verbindet ein und dieselbe Familiengeschichte – und Molinaris mittlerweile schon unverkennbarer Ton, irgendwo zwischen Märchenanklang, vermeintlich naiver Perspektive, manieristischer Verspieltheit und politischem Hintersinn.
Dieser Molinari-Sound ist eine Trademark und ein Risiko, manchmal an der Grenze zur Marotte. Der Humor, in den besten Momenten feinsinnig wie kaum irgendwo sonst, kann leicht etwas zu niedlich geraten. Und wer noch weiter an diesem Buch herumnörgeln wollte, könnte einen etwas zu gewollten Schluss und einen manchmal arg angestrengten Formwillen monieren («Obwohl es das Wissen um die Koordinaten des Nordpols gibt, ist dem Nordpol der Nordpol nicht anzusehen»).
Trotzdem ist «Hinter der Hecke die Welt» der wohl interessanteste Schweizer Klimaroman des Jahres und überhaupt: einer der besonders lohnenden Klimatexte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Das liegt einerseits daran, dass die Geschichte eben nicht in einer utopischen oder dystopischen Klimaallegorie aufgeht. Und andererseits daran, dass Molinari geradezu exemplarisch vorführt, wie der Beitrag der Literatur zum Verstehen der Klimakrise aussehen kann.
Mit den spezifischen Mitteln der Literatur erkundet Molinari nicht nur die Psychologie der Krisenerfahrung. Sie erweitert vielmehr das Empathie-Potenzial der Literatur über das Zwischenmenschliche hinaus auf nicht menschliches Leben, indem sie das naturwissenschaftliche Wissensarchiv zu einem Fundus für Geschichten macht. Und nicht zuletzt: Sie durchleuchtet unsere Sprache über die Natur auf ihre blinden Flecken – Sprachkritik als Ideologiekritik.
1. Ein Gefühl namens Solastalgie
Pina und Lobo also, die beiden einzigen Kinder im Dorf, sollen einmal die Dorfgärtnerei Werk übernehmen. So zumindest hat sich das Frau Werk gedacht, und weil das ganze Dorf denkt wie Frau Werk, haben Pina und Lobo als Hoffnungsträgerinnen so einiges zu schultern:
Geht an die frische Luft, Kinder, haltet eure Füsse warm. Euer Wachstum ist unser Wachstum.
Wachstum gibt es im Dorf einstweilen aber bloss beim Gebäudeleerstand. Und eines Tages klafft, aller Liebe von Frau Werk zum Trotz, in der Hecke ein mysteriöses Loch; wie ein Denkmal für den Selbstbetrug all jener, die sich noch eine rosige Zukunft für die Gemeinde erträumen. Und wie ein Menetekel.
Denn als ein Sturm das ganze Umland versehrt und ein Feuer «einen beachtlichen Teil der Hecke» verschlingt, bleibt den Dorfbewohnern nur noch der zweifelhafte Trost, dass der Sturm es nicht allein «auf das Dorf und die Hecke abgesehen hatte».
Molinari kann sich hier auf die assoziative Wirkung der Bilder verlassen: Wo die Dorfbewohner noch verdrängen und an Sündenbockerzählungen stricken, rufen Sturm und Feuer im Kopf der Leserin die Extremwetterkatastrophen der Gegenwart auf, die längst Teil des kollektiven Gedächtnisses sind. Die Klimathematik, die im Buch überall präsent ist und nur in der Dorferzählung ganz zurückgenommen scheint, bricht dadurch selbst in diesen Handlungsstrang ein. Ist der Assoziationsraum einmal aufgemacht, erinnert dann auch das zunehmende Trauer- und Ohnmachtsgefühl der Dorfbewohner an Gegenwartsphänomene wie Ökoangst und Klimadepression:
Frau Werk (…) wünschte sich (…) einen Schalter, den sie umlegen könnte, der sie mutig machen würde, aber nichts klickte, nichts surrte in ihr. Nur ein Pochen war da.
Was Molinari mit den Motiven eines schrumpfenden und verschwindenden Dorfes ins Bild setzt, ist im Grunde eine Form von «Solastalgie»: der Schmerz über den unwiederbringlichen Verlust des eigenen Lebensraums.
Allerdings: Ihr Roman funktioniert eben nicht in der blossen Stellvertreterlogik eines Sinnbilds. Das Dorf und seine Bewohner sind nicht nur die entzifferbare Chiffre für ein «eigentliches» Thema. «Hinter der Hecke die Welt» ist tatsächlich auch und sogar zuerst ein Dorfroman: ein Buch über Landflucht, über Strukturwandel, über das Gefährliche an konservativer Nostalgie und des beharrlichen Festhaltens am Gestern. Auf der Ebene der Assoziationen aber werden wir als Leserinnen immer wieder – und sei es nur momenthaft – aus den vordergründigen Deutungsbahnen hinaus- und in andere Kontexte hineingeworfen.
Die Lektion, die hier die Dorfbewohnerinnen zu lernen haben, führt der Roman auch durch seine Machart vor: Es gibt keine Abschottung, keine Inselexistenz, kein Leben, das sich «hinter der Hecke» der Welt entziehen könnte. Und es gibt keine naive Bezugnahme des Menschen mehr auf seine Umgebung. Die Natur, die wir vor Augen haben, ist eine gefährdete, und das bedeutet: in Gefahr ist unser Lebensraum.
Genau deshalb zielt Molinari mit ihrem wichtigsten literarischen Verfahren weit über das Zwischenmenschliche hinaus.
2. Die Poesie der Naturwissenschaft
Es gibt in diesem Buch eine Reihe heimlicher Nebenfiguren, die sprachlich zur Hauptsache werden. Der Küstenmammutbaum. Der Dickmaulrüssler. Der Gegenblättrige Steinbrech.
Molinari spielt mit der Poesie der biologischen Nomenklatur, mit dem poetischen Eigenwert und der sprachlichen Kraft, die auch in der naturwissenschaftlichen Fachsprache schlummern kann.
Manche dieser Namen enthalten selbst schon kleine Geschichten, andere bilden geradezu lyrische oder dadaistische Ein-Wort-Gedichte.
Basstölpel. Zwergstrauchheiden. Engelwurz.
Wie ihre Heldin Dora unternimmt auch Molinari eine Expedition, allerdings nicht ins (gar nicht so ewige) Eis, sondern durch die Sprachlandschaft der Naturwissenschaften, in der sie ihre Fundstücke einsammelt, um die Wörter und die darin verkapselten Geschichten zu archivieren.
Molinaris Roman ist auch eine verzweifelte Feier der Schönheit und der Vielfalt der Natur samt ihrer Kuriositäten, und ihr Buch evoziert diese herrlich skurrile Vielfalt auch durch das sprachliche Material. Es sind gerade die gleichermassen poetischen wie fachsprachlichen Wörter, mit denen Molinari weite Assoziationsräume öffnet. So erinnert sie an eine oft verschüttete, aber im Grunde urmenschliche Faszination für die Tier- und Pflanzenwelt und deren sprachliche Benennung, wie wir sie schon in den ersten Lebensjahren erfahren, wenn «Triceratops» für kein Kinderohr ein zu kompliziertes Wort ist.
So erzählt auch im Roman die Dorfälteste Pina und Lobo vom Paraceratherium. (Nie gehört? Schauen Sie mal hier.) Und wir hören staunend mit. Denn die Geschichten, die Molinari über den Roman hinweg über Tiere, Pflanzen und ihre Erforschung erzählt, sind selbst ein kleiner Biologiekurs.
Wir begegnen dem Arktischen Erdhörnchen, das seine Körpertemperatur im Winterschlaf auf Minusgrade absenkt und sich im Sommer quasi wieder auftaut; der amerikanischen Schwarzkopfmeise, die je nach Jahreszeit ihre Gehirngrösse verändert (und im Buch nicht ganz akkurat als «Schwarzmeise» auftritt); oder der Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte, die «nicht aufgrund ihres Daseins» berühmt wurde, «sondern aufgrund ihres Verschwindens», im Klartext: die genauso ausgestorben ist wie der Riesenalk.
In diesen Momenten erinnert Molinaris Roman durchaus ans zeitgenössische Nature Writing und an die Lyrik von Robert Macfarlane. Vor dem Hintergrund eines gigantischen Artensterbens bekommt das spielerische Wörtersammeln nämlich auch eine tiefernste Bedeutung. Mit den Tieren und Pflanzen, die aussterben, sterben auch die zugehörigen Wörter aus. Das Archiv der Namen ist deshalb auch Erinnerungsarbeit. Es formuliert, mit den heute gebräuchlichen ebenso wie mit den «verlorenen Wörtern», einen dringlichen Appell, die Artenvielfalt zu bewahren.
Molinaris Emotionalisierung der naturwissenschaftlichen Sprache ebenso wie das Übersetzen von biologischem Wissen in Fabeln und faszinierende Geschichte ist jedoch alles andere als ein risikofreies Verfahren. In einer unpolitischen, weltflüchtigen Variante könnte es auch zu einer Romantisierung führen – zu einer Beschönigungsästhetik, die uns erbauliche Storys zur Beruhigung liefert, weil wir den menschlichen Faktor bei alldem aussen vor lassen.
Deswegen kommt in diesem Roman alles darauf an, wie Molinari mit den Naturgeschichten umgeht und welche Rolle der Mensch darin spielt. Dafür aber hat die Autorin einen klaren Blick.
Wenn sie in einer kurzen Episode die reale Geschichte von einem Walross erzählt (ist Walross nicht auch so ein wunderbares Wort?), dann geht die noch kürzere Fassung davon etwa so: In Oslo wurde ein Walross zur Fotoattraktion. Es schwamm im Hafen, legte sich an Strände, posierte mit den Menschen, die ihm immer näher kamen. Die Behörden warnten: Achtung, Wildtier! Wenn ihr nicht Abstand zu ihm haltet, müssen wir es einschläfern, «zu eurer Sicherheit». Die Menschen aber hielten nicht Abstand. «Das Tier wurde eingeschläfert, nicht weil es den Menschen, sondern weil die Menschen ihm zu nahe kamen.»
Viele Seiten später hört Dora die Meeresforscherin vom Grönlandhai erzählen. «Irgendwo da unter uns» schwimme er «mit grosser Wahrscheinlichkeit», unbesehen vom Menschen und ganz den Zeitdimensionen eines Menschenlebens enthoben. Der Grönlandhai, sagt die Forscherin, erreiche ein Alter von bis zu 500 Jahren, geschlechtsreif werde er erst mit 150. «Ein sehr grosses, sehr altes, sehr langsames Tier» sei das. Auch seine Augen seien gross, sein Sehvermögen trotzdem schlecht, weil er in den Augenhöhlen einen Ruderfusskrebs als Parasiten trägt, der sich vom Augengewebe ernährt, sodass die Haie erblinden.
Doch diese Krebse, sagt die Forscherin bei Molinari, bedeuten nicht nur Schaden für den Hai. Sie lassen in der finsteren Tiefsee, wo das Sehvermögen ohnehin unnütz ist, durch ihren fluoreszierenden Körper die Augen des Grönlandhais leuchten und locken damit andere Wesen an, die der Hai dann frisst. So geht das mit den Meeresriesen seit Abertausenden von Jahren. Nur sei jetzt wohl bald das Ende des Grönlandhais gekommen, denn durch das Schmelzen des Eises werde nun auch die Tiefsee für den Menschen erreichbar und der Hai bald in den Fischernetzen landen.
Und das berühre sie doch sehr, sagt die Meeresforscherin, die Ausweglosigkeit, dass nicht einmal die tiefste Tiefsee Versteck genug ist. Tiefer tauchen kann er nicht.
Geschichten sind Empathie-Generatoren. Eben deshalb mobilisiert Molinari in diesem Buch die Kraft des Erzählens, um unsere Empathie stärker und problembewusster auf das nicht menschliche Leben auszudehnen.
Aber gerade weil Geschichten mächtig sind, kommt es, wenn sie politisches Bewusstsein schaffen wollen, auf ihre Aufrichtigkeit an. Und das heisst hier: keine Erzählung über das Mensch-Natur-Verhältnis, in der nicht die zerstörerische Rolle des Menschen in den Blick zu nehmen wäre.
Karten werden neu gezeichnet. Neue Linien gezogen. Ansprüche erhoben.
Die Geschichte der modernen menschlichen Naturerkundung ist auch eine Geschichte des Kolonialismus – gegen die Menschen und gegen die Natur.
«Was von den Expeditionen in die Arktis für die Arktis übrig bleibt», fragt deshalb Dora auf ihrem Schiff:
Was liessen sie zurück, die Entdecker, die Forscher, die Kolonialherren – es waren alles Herren.
Wäre es nicht besser gewesen, sinniert Dora, die Arktis so zu lassen, wie sie war?
Sie sieht die Spur, die das Boot im Eismeer hinterlässt, und weiss, dass es dafür zu spät ist.
3. Sprachkritik ist Ideologiekritik
Es gehört zur genauen Sprachbeobachtung und zur kritischen Reflexion dieses Romans, dass er dem zyklischen Wachstum der Natur den falschen Wachstumsfetisch des Kapitalismus gegenüberstellt.
Selbst Frau Werk, die gute Seele des Dorfes und Heckenpflegerin Nummer eins, träumt mit Blick auf das Schrumpfen des Dorfes und den Rückgang der Touristenzahlen «für einen kurzen Moment» davon, dass «die Gärtnerei Werk aufblühen» wird, weil all die Gärtnereien der Umgebung vor der Schliessung stünden, dass es dann doch wieder «Wachstum» geben und das Geschäft vielleicht bald «florieren» wird.
Ganz unaufdringlich führt Molinari vor, wie die Metaphorik des Kapitalismus auch die Sprache kolonisiert und noch das Natürlichste in eine zweckrationalistische Wachstumsideologie gezwängt hat. Und es ist, spiegelbildlich verkehrt, genau diese Art von Wachstumserwartung, der sich Pina und Lobo verweigern.
Doch nirgendwo wird die Widersprüchlichkeit und die Verzweckung des menschlichen Umgangs mit der Natur sprachlich so markant in Szene gesetzt wie mit dem Wort «Naturschutz».
«Eigentlich müsste alles Naturschutz sein», denn «das ist alles schützenswert», sagt Frau Werk, als sie Pina und Lobo das Naturschutzgebiet zeigt. Dann macht sie sich ans Unkrautjäten.
Und so lässt uns der Roman, ohne es explizit zu sagen, auf die Einsicht stossen, welche Abgründe sich noch bei dem vermeintlich so hehren Wort «Naturschutzgebiet» auftun: Der Mensch also errichtet auf diesem Planeten winzige, abgezirkelte Zonen, in denen er doch tatsächlich die Natur schützen will!
Nichts könnte frappierender als dieses Wort vor Augen führen, wie radikal der Schutz der Natur im Industriezeitalter zum Ausnahmefall verkommen ist.
Molinari «sagt» das nicht, sie erzählt – und lässt die Leserin selbst ihre Wortfunde machen. Kaum etwas könnte besser veranschaulichen, wie Literatur und Kunst eben keine Botschaften vortragen – sondern Erkenntnis induzieren. Molinaris Sprach- und Ideologiekritik kommt nicht als Argument daher, sondern als Potenzial in der ästhetischen Erfahrung. «Hinter der Hecke die Welt» ist kein Thesenroman, der vor allem dozieren will und seine Glaubenssätze notdürftig in literarische Figuren verpackt. Sondern Literatur als sinnliche Erfahrung, die wir im Lese- und Deutungsprozess selbst aktiv vollziehen.
Oder wie es der Literaturwissenschaftler Hubert Zapf kürzlich in einem Sammelband formulierte: «Ökologisch sensible, selbstreflexive Schreibformen» machen gerade durch ihre «Offenheit für die partizipatorische Ko-Interpretation ihrer Leserschaft» die Literatur zu einer «kreativen Form einer kulturökologischen Praxis».
Literatur in diesem Sinne ist aktive Zeitgenossenschaft. Und eine Einladung, daran teilzunehmen.
Gianna Molinari: «Hinter der Hecke die Welt». Roman. Aufbau, Berlin 2023. 208 Seiten, ca. 35 Franken.