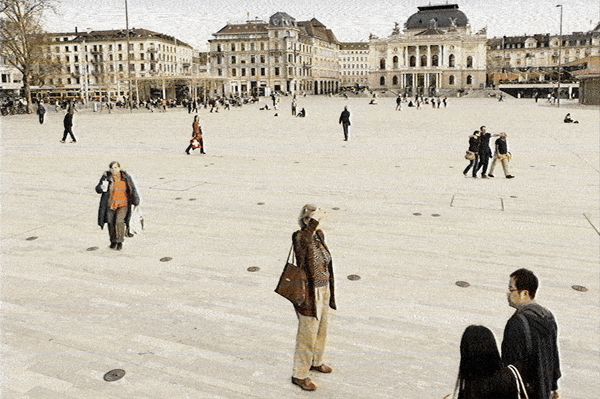Im Zweifel gegen den Zweifel
Die Telecomanbieter wollen den Schutz vor Mobilfunkstrahlung lockern. Doch trotz intensiver PR-Arbeit verschwinden die Gesundheitsbedenken nicht. Betroffene kämpfen für ihre Rechte. Der Mobilfunkreport, Teil 2.
Von Pascal Sigg (Text) und Yoshi Sodeoka (Animation), 02.06.2023
Es ist Anfang Mai, als FDP-Ständerat Hans Wicki im Hauptsitz des Telekommunikationsanbieters Sunrise sagt, er wolle das Problem der Baugesuche für Mobilfunkantennen «auf einen Chlapf» aus dem Weg räumen. Als ehemaliger Nidwaldner Baudirektor wisse er, was es dafür brauche.
Wicki präsidiert die ständerätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Doch er vertritt nicht nur die Interessen des Nidwaldner Wahlvolks. Als Co-Präsident der Lobbykampagne «Chance 5G» des Schweizer Verbands der Telekommunikation Asut präsentiert sich Wicki an diesem Abend als gewiefter, kompromissloser Kämpfer für ein Anliegen, das die Schweiz spaltet: ultraschnelles, ständig verfügbares Internet durch die Luft.
Hans Wicki schwört die rund zwanzig Anwesenden auf das gemeinsame Ziel ein. «Chance 5G» habe eine starke Community aufgebaut. «Wir sind auf gutem Weg, aber wir brauchen jetzt Ihre Überzeugungsarbeit.» Irgendwann zeigt er auf einen Mann in der vordersten Reihe, der sich mit einem Stift Notizen macht. «Sie sind Journalist?», fragt Wicki. «Nicht alles schreiben!»
Der Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes kommt in der Schweiz nicht so voran, wie sich das die Anbieter wünschen. Die Widerstände gegen die neue Technologie sind gross; viele Menschen fürchten um ihre Gesundheit. Doch Politik und Wissenschaft gelingt es nicht, Vertrauen zu schaffen. Was läuft falsch? Eine Miniserie in zwei Teilen. Zur Übersicht.
Sie lesen: Teil 2
Im Zweifel gegen den Zweifel
Die vergangenen Wochen waren wichtig für die Mobilfunkanbieter und ihre Interessenvertreter in Bern. Der Ausbau des Schweizer Mobilfunknetzes stockt aus ihrer Sicht seit mindestens zehn Jahren. 2016 und 2018 lehnte das Parlament Vorstösse ab, die dafür eine Erhöhung der Grenzwerte gefordert hatten. Bereits damals war klar, dass stärkere Netze grundsätzlich nur mit mehr Strahlung zu haben sein werden. Nun, so die Hoffnung Anfang Mai, könnte ihnen auch dank Wicki der Durchbruch gelingen.
Die Lage ist verzwickt. Wir nutzen elektromagnetische Strahlung für immer mehr Dienste an immer mehr Orten: Das SBB-Ticket kaufen wir erst im Zug, E-Mails bearbeiten wir als Beifahrer im Auto, wir bezahlen an der Kasse mit der Handykamera, Skirennen streamen wir live, wo immer wir gerade sind.
Gleichzeitig jedoch stehen viele Schweizerinnen dem Netzausbau skeptisch gegenüber. Viele Antennen werden bis vor Bundesgericht bekämpft. Derzeit sind laut Asut, dem Verband der Telekommunikation, schweizweit über 3000 Baubewilligungsverfahren für Antennenprojekte blockiert. Einige Gegner beteuern, dass sie unter der Strahlung leiden. Andere stützen sich vor allem auf die Wissenschaft. Denn die Gesundheitsrisiken von Mobilfunkstrahlung gelten als ungenügend erforscht.
Die Lobbykampagne «Chance 5G» behauptet zwar, bei den Gegnerinnen des schnellen Netzausbaus handle es sich um eine laute Minderheit. Allerdings widerspricht mindestens eine unabhängige Meinungsumfrage mit seriöser Methodik dieser Darstellung. In einer Befragung des ETH-Umweltpanels aus dem Jahr 2020 waren mehr als 50 Prozent der Personen der Meinung, dass die Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung nicht gelockert werden sollten. Es reiche, wenn 5G in der Schweiz erst in zwanzig bis dreissig Jahren flächendeckend verfügbar sei.
Doch um die 5G-Technologie voll nutzen zu können, braucht es aus der Sicht der Industrie dringend eine Lockerung des Schutzes. Entsprechend steht es auch im Bericht «Mobilfunk und Strahlung» des Departements für Umwelt, Verkehr und Kommunikation (Uvek) aus dem Jahr 2019 geschrieben: je höher die Grenzwerte, desto schneller der Ausbau. Und so forderte FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen im Juni 2021 im Nationalrat eine Erhöhung auf das Doppelte oder Vierfache der Anlagengrenzwerte.
«Es ist wirklich eine Technologie, die jetzt vom Stapel gelassen werden muss», rief der Berner in den Nationalratssaal. Und er appellierte: «Der Befreiungsschlag, liebe Kolleginnen und Kollegen, der muss jetzt einmal von uns kommen.» Der Nationalrat folgte ihm mit 97 zu 76 Stimmen. Vergangene Woche nun beriet die ständerätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen über das Geschäft, das der Ständerat in der laufenden Sommersession behandeln wird.
Antenne heisst Umzug
Auch für Kathrin Luginbühl ist das Geschäft von höchster Dringlichkeit. Die 62-Jährige wohnt in Hadlikon, einem Ortsteil von Hinwil im Zürcher Oberland. An einem warmen Frühlingsnachmittag steht sie im grossen Garten vor einem Bauernhaus, in der Nähe plätschert ein Bach. Sie zeigt über die Nachbarhäuser und sagt: «Seit über zehn Jahren hat es im Dorf keine Antenne mehr, und nun kämpfen wir schon sechs Jahre erfolgreich gegen die geplante Antenne da hinten.» Für Luginbühl ist klar: Sollte hier wieder eine Antenne gebaut werden, müsste sie einmal mehr umziehen.
Am Tag zuvor hatte Luginbühl der Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller einen Brief geschrieben und ihr mitgeteilt, sie sei gerne bereit, in der Kommissionssitzung des Ständerats als Direktbetroffene «Red und Antwort zu stehen».
Begonnen hatte alles Ende 1990, als Kathrin Luginbühl als Direktionssekretärin auf einem Laptop tippte. «Ich spürte ein Ziehen in den Händen, einen sonderbaren Druck im Kopf. Und tat es als momentane Unpässlichkeit ab. Doch die Symptome kamen wieder und wurden stärker.» Auch die Arbeit an den stationären Computern, damals noch mit Röhrenbildschirmen und einem Rechner unter dem Tisch, brachte Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Herzstechen. Die Firma habe sie zwar sehr unterstützt, doch sie habe bald bemerkt: «Büroarbeit heisst halt nun einmal Computerarbeit und Elektrosmog», sagt Luginbühl.
Deshalb fasste sie den Entschluss, sich berufsbegleitend zur Heilpraktikerin weiterzubilden, ein Beruf ohne Elektrosmog erzeugende Arbeitsgeräte. Sie wurde von den Krankenkassen anerkannt und hatte eine Perspektive gefunden. Dann baute die Swisscom Ende der 1990er-Jahre auf ihrer Mietwohnung in Zürich-Wipkingen eine Mobilfunkantenne.
Sie dachte sich zuerst nichts dabei. Anders als mit dem Laptop ging es ihr diesmal schleichend schlechter. Und auch die Symptome waren andere: Schlafstörungen, Erschöpfung und schliesslich zunehmend Kreislaufprobleme. Sie konnte in ihrer Wohnung weder leben noch arbeiten. Schliesslich musste sie ausziehen, wie später auch in Wetzikon, in Fehraltorf und in Flawil, wo sie jeden Abend in den Keller runterstieg, weil dies der einzige Ort im Haus war, wo die Strahlenbelastung so tief war, dass sie schlafen konnte.
Mit 37 beantragte sie notgedrungen eine IV-Rente. Das RAV sagte, sie sei zwar nicht krank, aber man könne sie als elektrosensible Person nicht vermitteln. Die Rente erhielt Luginbühl nach langem Ringen letztlich mit der Begründung, es liege eine psychische Beeinträchtigung vor, weil Elektrosensibilität in der Schweiz bis heute nicht anerkannt wird.
Und so tat Luginbühl etwas Ungewöhnliches. Sie wehrte sich vor Gericht wegen der falschen Begründung gegen ihre eigene IV-Rente. Zwei Gutachten – eines von der IV und eines in ihrem Auftrag – sowie drei Ärzte bestätigten unabhängig voneinander, dass sie psychisch gesund sei. «Man sagte mir, lass es bleiben, du riskierst nur deine Rente. Ich wusste aber, dass die Strahlung nicht nur mir schadet. Und so kämpfte ich nicht nur für mich.»
Wie mit der Beschwerde gegen ihre IV-Diagnose zog Luginbühl Anfang der Nullerjahre auch gegen zwei Antennen-Baubewilligungsverfahren bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Dieser führte aus prozessökonomischen Gründen alle drei Klagen zusammen und wies sie Anfang 2006 ab. Allerdings entschied das Gericht in einem Präjudizurteil: Artikel 8 der Menschenrechtskonvention, der allen Menschen ein Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens sowie der Wohnung zuspricht, ist grundsätzlich auch auf den Mobilfunk anwendbar.
Die wissenschaftliche Forschung kann Elektrohypersensibilität (EHS) bisher nicht genau erklären. Elektrohypersensibilitätsforscher Dariusz Leszczynski sagte an einem Workshop des EU-Parlaments vor wenigen Wochen jedoch: Ein kausaler Zusammenhang zwischen Elektrohypersensibilität und elektromagnetischer Strahlung könne nicht abschliessend ausgeschlossen werden. Die vorhandenen Forschungsresultate seien schlicht ungenügend. So seien zum Beispiel nur akute Effekte auf Menschen untersucht worden. Über Reaktionen, die später eintreten – wie sie auch Luginbühl beschreibt – wisse man nichts.
Kathrin Luginbühl weiss aber, was sie erlebt hat. Und sie weiss, dass sie nicht allein ist. Manchmal rufen sie fremde Leute an, die verzweifelt sind. Einige weinen am Telefon, weil sie sich von jenen Stellen, die sie eigentlich schützen sollten, nicht ernst genommen fühlen. Im Rahmen des ETH-Umweltpanels bezeichneten sich 10,6 Prozent der befragten Personen selber als elektrosensibel und rund ein Drittel gab an, nicht sicher zu sein.
«Wenn sich dies übertragen lässt auf die Gesamtbevölkerung», sagt Luginbühl unter der niedrigen Decke des alten Bauernhauses, «sind wir über 800’000 Menschen in diesem Land, die unter der Strahlung leiden. Es kann nicht sein, dass man uns ignoriert oder gar psychologisiert.» Und sie fragt: «Sollten wir jetzt nicht einen Weg suchen, um mit der Digitalisierung massvoll fortzuschreiten und auch die Schwachen unserer Gesellschaft zu schützen?»
Luginbühl sagt, sie achte darauf, dass sie nicht mehr als nötig unter Leute müsse, obwohl sie eigentlich sehr sozial und menschenfreundlich sei. Sie hat kein Handy, nutzt selber kein Internet und lässt ihre E-Mails von einer Bekannten bearbeiten. In der S-Bahn setzt sie sich dorthin, wo es kaum Leute hat. Die meisten würden unterwegs Smartphones nutzen, was bei ihr zu einem Stechen im Kopf führen könne.
Versprechen Sie sich denn gar nichts von 5G, Frau Luginbühl?
Sie habe zwar verstanden, dass sogenannte adaptive Antennen einen einzelnen Strahl effizienter abgeben können, sagt Luginbühl. «Aber dies würde bestenfalls etwas helfen, wenn wir davon ausgehen könnten, dass eine Antenne nur einen oder zwei Nutzer gleichzeitig bedient.» Gemäss Planung sollen aber über tausend Endgeräte gleichzeitig von einer einzelnen Antenne bedient werden. «Man kann ja nicht behaupten, man habe eine Technologie, die weniger strahlt – und gleichzeitig höhere Grenzwerte fordern. Da wird der Bevölkerung etwas vorgegaukelt.»
Sensoren im Stall
«Wenn die Welt sich digitalisiert, brauchen wir diese Konnektivität», sagt Sunrise-Manager Alexander Lehrmann Anfang Mai am Anlass von «Chance 5G». Lehrmann zeigt mögliche Anwendungsfälle und Geschäftsmöglichkeiten, die dank 5G Realität werden könnten oder bereits sind: Smart Manufacturing, Smart Stadium, Smart Construction, Smart Tourism oder Smart Farming.
5G könnte die ständige Verbindung verschiedener Geräte ermöglichen. Lehrmann spricht von einer Million Verbindungen pro Quadratkilometer in Städten. Diese Zahl nennt auch der Bericht «Nachhaltiges Mobilfunknetz» des Bundesrats. Die vielen Verbindungen zwischen einzelnen Geräten im sogenannten Internet of Things wiederum dürften auch das Bedürfnis nach visueller Kontrolle steigern. Und dafür dürften Live-Videoanwendungen verstärkt nachgefragt werden. Gerade da, wo 5G ernsthaft industriell genutzt werden würde, bedeutet es deshalb: intensivierte Automatisierung und umfassendere Überwachung.
Zum Beispiel könnten Drohnen auf einem Bauernhof Felder ständig aus der Luft auf Unkraut absuchen. Die Pflanzen würden mittels Bildanalysesoftware erkannt. Worauf ein Roboter die ungewünschten Pflanzen gezielt und ohne Einsatz von Pestiziden vernichten könnte. Denkbar sind auch Sensoren, die fortwährend Daten über die Kühe im Stall liefern. Falls diese Unregelmässigkeiten anzeigen, könnte die Bäuerin mittels Echtzeitvideo direkt von ihrem Smartphone in den Stall schauen.
Für Privatnutzer, gibt Lehrmann zu, drängten sich neue Anwendungen etwas weniger auf. Aber klar: Mobiles Gaming würde viel bequemer. In Regionen, wo es einfacher sei, Breitbandinternet übers Mobilfunknetz anzubieten, könnten die Leute dank 5G trotzdem 3-D-Videos schauen. Und an Heimspielen des FC Basel im Joggeli könne das Publikum über die Replay-App umstrittene Szenen auf dem eigenen Handy nachschauen.
Ganz grundsätzlich, so Lehrmann, wollten die Nutzer eben Videobilder haben. «Dann gehen die Bandbreiten nach oben, und da brauche ich Netze, die das beherrschen», sagt er. Und macht so klar: 5G-Netze tun letztlich dasselbe wie die bisherigen Netze, einfach besser: Sie können unzählige schnelle Verbindungen herstellen und permanent aufrechterhalten.
Erst das Geld, dann die Politik
Dass dafür die Antennen intensiver strahlen können müssen, wussten die Mobilfunkanbieter Jahre bevor sie Anfang 2019 die 5G-Konzessionen ersteigerten. Im Mai 2016 veröffentlichte die EPFL in Lausanne eine von der Swisscom mitfinanzierte Studie über den Stand der Digitalisierung in der Schweiz. Sie taxierte die Infrastruktur für Information und Kommunikation hierzulande als gut. Damit die Schweiz aber eine Leaderrolle übernehmen könne, empfahl sie das «Vorantreiben des Ausbaus des mobilen Breitbands».
Unter anderem die viel tieferen Grenzwerte im Vergleich zum Ausland würden die nötige Weiterentwicklung der Mobilfunknetze jedoch bremsen, sagte der damalige Swisscom-CEO Urs Schäppi am Rande einer Medienpräsentation. Und Olaf Swantee, damals CEO von Sunrise, bezeichnete 2017 die Schweizer Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung als «Digitalisierungsblocker».
Auch die Eidgenössische Kommunikationskommission, deren Mitglieder vom Bundesrat bestimmt werden, schrieb 2017, die Grenzwerte hätten gelockert werden müssen, damit die zu vergebenden Frequenzen optimal ausgenutzt werden könnten. Dass der Ständerat dies abgelehnt habe, «dürfte einen erheblichen Einfluss auf die Netzarchitektur haben und die Kosten des Netzausbaus in die Höhe treiben», schrieb Präsident Stephan Netzle.
Im Sommer 2017 führte das Bundesamt für Kommunikation eine kurze öffentliche Konsultation durch, in der Gesundheitsanliegen kaum Stimmen erhielten. So wurden beispielsweise die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz nicht darüber informiert.
Nachdem der Bundesrat im November 2017 den Weg für neue Frequenzen freigemacht hatte, war es deshalb nicht aus der Luft gegriffen, dass Moderatorin Andrea Vetsch Netzle in der SRF-Nachrichtensendung «10 vor 10» fragte: «Ist der Weg, den Sie verfolgen, nicht fahrlässig?»
«Nein», antwortete er. Das Thema werde international sehr stark erforscht. Und er sagte, aus seiner Sicht müsste die Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung gelockert werden – ansonsten wären viel, viel mehr Antennen notwendig. «Wenn man den bestehenden Antennen erlaubt, mehr zu leisten, braucht es weniger neue Antennen bei der neuen Technologie.»
Die Eidgenössische Kommunikationskommission versteigerte die ersten 5G-Frequenzen im Februar 2019 trotzdem, obschon das Parlament auch im Jahr zuvor eine Grenzwerterhöhung abgelehnt hatte. Dies spülte dem Bund fast 380 Millionen Franken in die Kasse. Stephan Netzle schrieb 2019: Dank der frühen Vergabe dieser Frequenzen sei die Schweiz im Vergleich zum Ausland in einer führenden Position. Dieser Vorsprung sei allerdings schnell verspielt, «wenn es uns nicht gelingt, die rechtlichen Rahmenbedingungen laufend und unter Berücksichtigung aller Interessen den technischen Bedürfnissen und Entwicklungen anzupassen».
Dass mit den «Rahmenbedingungen» vor allem die Grenzwerte gemeint waren, war da längst kein Geheimnis mehr. Auch im Sommer 2020, wenige Monate nachdem der Bundesrat sich geweigert hatte, die Grenzwerte zu lockern, beschwerte sich Netzle in einem Brief an die Regierung. Die Haltung seiner Kommission war klar: In Sachen Mobilfunk hat die Politik dem Geld zu folgen.
Verlorenes Vertrauen
Die Anwaltskanzlei von Michael Fretz befindet sich in einem Eckhaus mit grossem Parkplatz, wenige Schritte vom Aarauer Bahnhof in einem ruhigen Wohnquartier. Über den Holzboden ist blauer Teppich gespannt, im grosszügigen, hellen Sitzungszimmer mit langem Tisch hängt Kunst. Fretz ist auf Bau- und Immobilienrecht spezialisiert. Im Sommer 2019 machte ein Rechtsgutachten von ihm zur bundesrätlichen Anpassung der Strahlenschutzverordnung für 5G die Runde – bis ins Ausland.
Im Gutachten kritisierte Fretz das blinde Vorpreschen des Bundesrats. «Man begann mit dem Spiel, bevor man die Spielregeln festlegte», sagt Fretz. Wie waren die neuen adaptiven Antennen zu beurteilen? Wie wurden sie kontrolliert? Das war alles nicht klar. «Und trotzdem sagte die Verordnung: Adaptive Antennen dürfen privilegiert bewilligt werden.»
Spätestens seither gilt Fretz als Anwalt der Antennengegner. Ungefähr achtzig Antennenrekurse hat er momentan auf dem Tisch, zehn davon sind vor Bundesgericht. Wöchentlich rufen Leute an, die ihn engagieren wollen. Doch Fretz muss vielen von ihnen absagen.
«Ich wurde viel sensibler für Menschen, die wirklich darunter leiden», sagt er. «Das ist nicht Hokuspokus. Einmal hatte ich eine Person hier, die vorgängig sagte, wir müssten alle Strahlenquellen ausschalten. Doch als sie ins Sitzungszimmer trat, merkte sie, dass ich im Büro nebenan vergessen hatte, den Bluetooth-Kopfhörer auszuschalten. Zahlreiche Einzelschicksale haben mir gezeigt, dass es sich lohnt, sich für diese Menschen einzusetzen.»
Fretz sagt, diese tägliche Arbeit habe sein Vertrauen in die Bundesbehörden stark beschädigt. «Ich hätte die Erwartung an einen funktionierenden Rechtsstaat und an eine funktionierende Bundesverwaltung, dass man sich zuerst überlegt, wie man eine neue Technologie einführt, bevor man Konzessionen für Hunderte Millionen Franken verkauft.»
Vor wenigen Wochen fällte das Bundesgericht ein Urteil über ein geplantes Antennenprojekt in Steffisburg. Für Asut-Geschäftsführer Christian Grasser schaffte das Bundesgericht damit Klarheit. Zentrale Punkte des 5G-Ausbaus wie die Tauglichkeit der Qualitätssicherung oder die Vereinbarkeit mit dem Vorsorgeprinzip seien jetzt höchstrichterlich geklärt, und zahlreiche sistierte Baubewilligungsverfahren könnten nun weitergeführt und abgeschlossen werden, schreibt er auf Anfrage.
Der Anwalt seiner Gegnerinnen sieht dies jedoch ganz anders. Für Michael Fretz gibt es weiterhin vier rechtliche Knackpunkte.
Erstens: Der sogenannte Korrekturfaktor. «Damit erlaubt der Bundesrat seit Januar 2022 den Anbietern, den vorsorglichen Grenzwert zu überschreiten, falls er im Mittel über sechs Minuten eingehalten wird. Ist dies mit dem Vorsorgeprinzip vereinbar? Für mich ist es eine versteckte Grenzwerterhöhung. Dies ist wichtig, weil das Parlament zuletzt zweimal Grenzwerterhöhungen abgelehnt hat.»
Zweitens: «Generell bleibt die Frage nach den Grenzwerten und ihrer Vereinbarkeit mit dem Vorsorgeprinzip unbeantwortet. Unser Umweltschutzgesetz sagt, man müsse Immissionen verhindern, die schädlich oder lästig sind. Gegenwärtig sind sie für viele meiner Klienten mindestens lästig.»
Drittens: «Es fehlt eine übergeordnete Planung des Mobilfunknetzes. Drei Anbieter rüsten auf. Dies führt zu einem unkontrollierten und willkürlichen Wildwuchs. Jeder wählt Standorte, die von Grundeigentümern zur Verfügung gestellt werden. Und niemand sagt, ob dies aufgrund übergeordneter Kriterien wie zum Beispiel Strahlenschutz oder Ortsbild sinnvoll ist.»
Viertens: «Es gibt grosse Fragezeichen beim Vollzug. Gemäss der Schutzverordnung müssen die Behörden kontrollieren, dass die Anbieter die Grenzwerte einhalten. Dies ist besonders bei den adaptiven Antennen schwierig, weil sie softwaregesteuert sind. Die Behörden haben aber keinen Zugriff auf diese Systeme und können nur angemeldet bei den Betreibern vorbeigehen und reinschauen. Die Missbrauchsgefahr ist gross.»
Um diese Fragen zu klären, sieht Fretz den Bundesrat und das Bundesamt für Umwelt in der Verantwortung – nicht primär das Bundesgericht. Man bewege sich aber in einem schwierigen Spannungsfeld: «Das Recht muss sich manchmal der Politik beugen. Aber das Umgekehrte kann auch der Fall sein.»
Fretz wirkt während des stündigen Gesprächs ziemlich gelassen. Er hatte sich vorbereitet, viele Notizen gemacht und kennt sich im Thema aus. Erst am Schluss wird er bestimmter. Als Mensch und Bürger sei ihm einfach der Rechtsfrieden sehr wichtig. «Wir haben ein tolles Land, es funktioniert vieles ganz gut. Doch wenn die Menschen den Behörden nicht mehr vertrauen, dann geht es wirklich bergab. In unserer Demokratie müssen wir das Vertrauen der Leute in die Behörden wieder stärken. Und zwar, indem wir ihnen zeigen, dass wir nach ihren Interessen handeln. Und nicht nur nach denjenigen der Wirtschaft.»
Fehlende Transparenz
Vertrauen wollen auch die Mobilfunkanbieter schaffen. Im Sommer 2020 – eineinhalb Jahre, nachdem sie die Konzessionen ersteigert hatten, und wenige Monate, nachdem der Bundesrat mitgeteilt hatte, die Grenzwerte nicht anheben zu wollen – lancierten sie zusammen mit der Berner Agentur Furrerhugi die Lobbykampagne «Chance 5G». Das Ziel: Das Projekt soll durch sachliche Information der Bevölkerung Vertrauen in 5G schaffen. Denn der notwendige Ausbau mit 5G würde aufgrund fehlenden Wissens, falscher Schlüsse und Unsicherheiten politisch und gesellschaftlich stark ausgebremst. «Wir haben die Dynamik von Fake News unterschätzt», sagte Asut-Präsident Peter Grütter dem «Tages-Anzeiger». Und bezog sich dabei auf eine auf Social Media aufgetauchte Behauptung, 5G-Antennen würden Covid-19 übertragen.
Doch die Anbieter selber scheuen sich nicht vor irreführender Kommunikation. So interpretiert auch «Chance 5G» den wissenschaftlichen Forschungsstand zu möglichen Gesundheitsrisiken selber so selektiv wie die von der Industrie ins Leben gerufene «Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation». An einem Anlass in Herrliberg bezeichnete auch Sunrise-CEO André Krause einen «K-Tipp»-Artikel, der aufzeigte, dass einige Antennen zu stark strahlen, bevor sie amtlich abgenommen werden, als Fake News. Der beschuldigte Journalist schreibt dazu auf Anfrage der Republik: «Alle Aussagen im Artikel sind korrekt.»
Neben offensiver Kommunikation setzt die Lobbykampagne vor allem auf Networking. Sie zählt auf Botschafterinnen aus Wissenschaft und Wirtschaft. Aber auch Medienorganisationen wie die Verbände der Privatradios und des Privatfernsehens treten explizit als Unterstützer auf.
Medienunternehmen wie NZZ, Ringier, TX Group, die SRG oder das Kommunikationsbranchenmagazin «Persönlich» sind indirekt über die Initiative Digitalswitzerland, bei der ein Grossteil der Schweizer Wirtschaftselite mitmacht, mit der Lobbykampagne verbunden. Im Februar 2021 forderte Digitalswitzerland seine Mitglieder dringlich dazu auf, eine Petition von «Chance 5G» zu unterschreiben. 5G sei als «unverzichtbare Basisinfrastruktur der digitalen Welt» für den Wirtschaftsstandort Schweiz schlicht «matchentscheidend».
Daneben nimmt die Kampagne auch direkt Einfluss im Parlament. FDP-Ständerat Hans Wicki bildet das Co-Präsidium mit SVP-Präsident Marco Chiesa, Mitte-Nationalrat Martin Candinas und SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, die zudem im Asut-Vorstand sitzt. Gemäss Website sind über 30 Mitglieder des Nationalrats mit dem Projekt verbunden, allein 10 von ihnen sitzen in der zuständigen Kommission.
Hinzu kommen zehn Mitglieder des Ständerats, wobei fünf von ihnen in der von Hans Wicki präsidierten Kommission wirken. Von den grossen Parteien sind einzig die Grünen nicht vertreten. Bis auf Wicki gibt allerdings kein Politiker diese Interessenbindung im entsprechenden Transparenzregister des Parlaments an.
Claudio Looser, Projektleiter von «Chance 5G», sagt auf Anfrage, die Parlamentarier seien angefragt worden und machten mit, weil sie überzeugt davon seien – und zwar, ohne dafür bezahlt zu werden. Politische Einflussnahme nennt Looser nicht als Grund für die Zusammenarbeit. Mit der Unterstützung der Politikerinnen werde «insbesondere auch der Dialog mit der Bevölkerung aufgebaut und gepflegt». Looser erachtet es nicht als notwendig, dass die Interessenbindung offiziell offengelegt werde. Die Parlamentarierinnen seien auf der eigenen Website aufgeführt.
Die Zürcher GLP-Nationalrätin Barbara Schaffner schreibt, sie sei von «Chance 5G» angefragt worden. «Wohl als Mitglied der zuständigen Kommission und weil ich mich schon vorher positiv zu 5G geäussert hatte.» Sie werde nicht dafür bezahlt und habe das Engagement nicht als Interessenbindung verstanden. «Es ist ein Hinstehen mit Kopf und Namen für eine Sache, die ich als richtig und wichtig erachte – ähnlich wie in einem Abstimmungskomitee.» Auch Mitte-Ständerat Benedikt Würth sagt auf Anfrage, das Parlamentsgesetz werde nicht verletzt.
Otto Hostettler, Co-Präsident von Lobbywatch, findet das problematisch. «Für uns ist ‹Chance 5G› eine klassische Lobbyvereinigung. Daher ist es völlig klar, dass gemäss Parlamentsgesetz eine solche Tätigkeit deklarationspflichtig ist.»
Im Gesetz steht: «Beim Amtsantritt und jeweils auf Jahresbeginn unterrichtet jedes Ratsmitglied das Büro schriftlich über seine weiteren Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie Beiräten und ähnlichen Gremien von schweizerischen und ausländischen Körperschaften.»
Hostettler findet: «Auch wenn man die Aushängeschilder ‹Botschafter› nennt, muss man dies deklarieren. Es zeigt einmal mehr die fehlende Sensibilität vieler Politikerinnen und Politiker bezüglich Transparenz.»
Gäbe es ein Netz für alle?
Die Zürcher Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter stört sich am Lobbying und den PR-Kniffen der Mobilfunkunternehmen. Diese würden eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema verhindern. «Es ist ein Grundsatzproblem, dass man nicht über 5G sprechen kann, ohne in eine Ecke gestellt zu werden. Dabei geht es mir allein um die Frage, die wir einfach beantworten müssen: Wie schaffen wir es, dass wir ein funktionierendes Netz haben, ohne den Schutz von Mensch und Umwelt zu schwächen?»
Man vertraue einfach blind, dass die technischen Innovationen es schon richten würden. «Doch wenn mit dem Angebot auch die Nutzung weiterhin so steigt wie bisher, werden wir spätestens in zehn Jahren ein grosses Problem haben.»
Schlatter ist nicht die Einzige, die als Alternative zum schnelleren 5G-Ausbau ein stärkeres Glasfasernetz anführt. Insbesondere die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz plädieren schon lange dafür, die Innen- und Aussenversorgung zu trennen. Sie kritisieren: «Der Blick zurück mit dem Wissen von heute zeigt, dass seit Jahren der flächendeckende Glasfaserausbau auf dem Land und in der Stadt systematisch ausgebremst wurde zugunsten einer Priorisierung des Ausbaus von Mobilfunkanlagen.»
Für Schlatter ist klar, weshalb. Die Grundversorgung sei auf dem Land schlicht kein lohnendes Geschäft: «Den Markt gibt es, wo man Geld verdienen kann. Eine Umverteilung zugunsten der Peripherie will man vermeiden.»
Für Reto Vogt ist unbestritten, dass es den 5G-Standard braucht. Vogt ist Chefredaktor des Online-Mediums «Inside IT» und schreibt seit siebzehn Jahren über Telecomthemen. Doch Vogt sagt am Telefon auch klar: «Will man Breitbandinternet verkaufen, ist es aus Anbietersicht eindeutig kostengünstiger, ein Gebiet über 5G zu erschliessen als mittels Glasfaser.» Denn dafür müsse man den Boden aufreissen, was exponentiell teurer werde.
Als Teil ihres Versorgungsauftrags muss die Swisscom auch in ländlichen Gebieten eine gewisse Internetabdeckung gewährleisten. Dies darf sie auch übers Mobilfunknetz, was sie gemäss Vogt problemlos schaffe. 5G habe jedoch den erheblichen Nachteil, dass sich Bürgerinnen die Bandbreite teilten, während sie bei Glasfaser aus dem Vollen schöpfen könnten.
Doch die Kosten spielen durchaus eine Rolle für die Konzessionärin Swisscom, die in der Schweiz das Glasfasernetz baut: Das gab René Dönni Kuoni vom Bundesamt für Kommunikation kürzlich in einem Interview mit «Chance 5G» offen zu. Der Bund hält zwar die Aktienmehrheit an der Swisscom, stellt aber nur einen von neun Verwaltungsräten und erwartet, dass sie ihren Unternehmenswert stetig steigert und eine attraktive Dividendenrendite sicherstellt.
«Inside IT»-Chefredaktor Vogt findet, die Schweiz brauche sowohl Glasfaser als auch 5G. Er kritisiert allerdings, dass das Glasfasernetz von einem privaten Anbieter gebaut werde. «Meiner Ansicht nach sollte der Staat dies gewährleisten. So wie man Strassen und Schienen baut. Die Swisscom ist die einzige Anbieterin, welche sich den Bau des Netzes leisten kann, und sie investiert auch viel.» Aber sie lege nicht offen, wie schnell sie wo baue. Und so gibt es auch ländliche Gemeinden, die das Glasfasernetz auf eigene Kosten bauen wollen. Gemäss dem Bericht «Nachhaltiges Mobilfunknetz» hat der Bundesrat den Handlungsbedarf erkannt. Darin heisst es: «Glasfasernetze und Mobilfunk sind miteinander verknüpft und müssen sich punkto Versorgung gegenseitig ergänzen.»
200 versiegelte Couverts
Sie seien nicht technologiefeindlich, sagen sowohl Anwalt Michael Fretz als auch Antennenbekämpferin Kathrin Luginbühl. Aber der Bund müsse nun endlich abklären, was die Bevölkerung wirklich brauche und wolle, bevor neue Frequenzen versteigert würden, sagt Fretz. Luginbühl findet, die Grenzwerte müssten massiv gesenkt werden. Zudem sollte möglichst viel Datenverkehr aufs Kabel. Und als akute Notmassnahme fordert sie – besonders mit Blick auf das Behindertengleichstellungsgesetz, das gerade revidiert wird – antennenfreie Zonen.
Nachdem sie von Ständerätin Brigitte Häberli-Koller keine Antwort auf ihren Brief erhalten hatte, schickte Luginbühl diesen auch noch allen anderen Mitgliedern der Kommission. Niemand antwortete, und Luginbühl reiste nicht nach Bern.
Die ständerätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen empfahl die FDP-Motion schliesslich dem Ständerat nicht vorbehaltlos zur Annahme, sondern beraubte sie ihres Kerns. Mit 7 zu 5 Stimmen verlangten die Kommissionsmitglieder, dass die Grenzwerte nicht erhöht werden dürfen, und änderten die Motion entsprechend ab.
«Das ist immerhin ein Signal für den Gesundheitsschutz», sagt Luginbühl. Die Politiker erscheinen ihr von der komplexen Materie aber überfordert. Der Vorstoss sei so eigentlich gar nicht umsetzbar.
Weil die Kommission die Motion abgeändert hat, müsste sie im Fall einer Annahme im Ständerat auch später nochmals in den Nationalrat.
Dann will Luginbühl wieder eine Briefaktion durchführen. In versiegelten Couverts, mit handgeschriebenen Adressen. Sie erhofft sich, dass diese eher beachtet werden als eine E-Mail, die vielleicht im Spam-Ordner landet. Diesen Brief will sie dann 200-mal verschicken – an den ganzen Nationalrat.
Die Recherche für den zweiteiligen Mobilfunkreport wurde von Journafonds finanziell unterstützt.