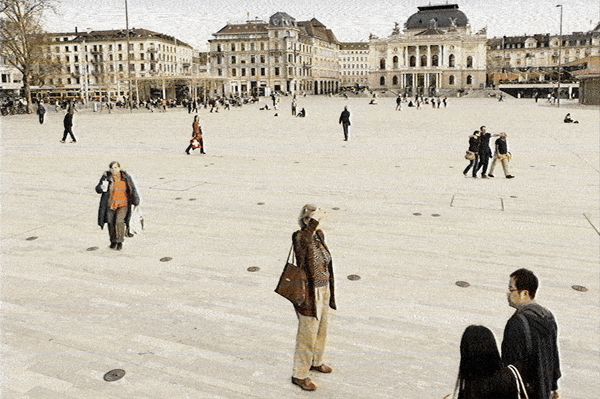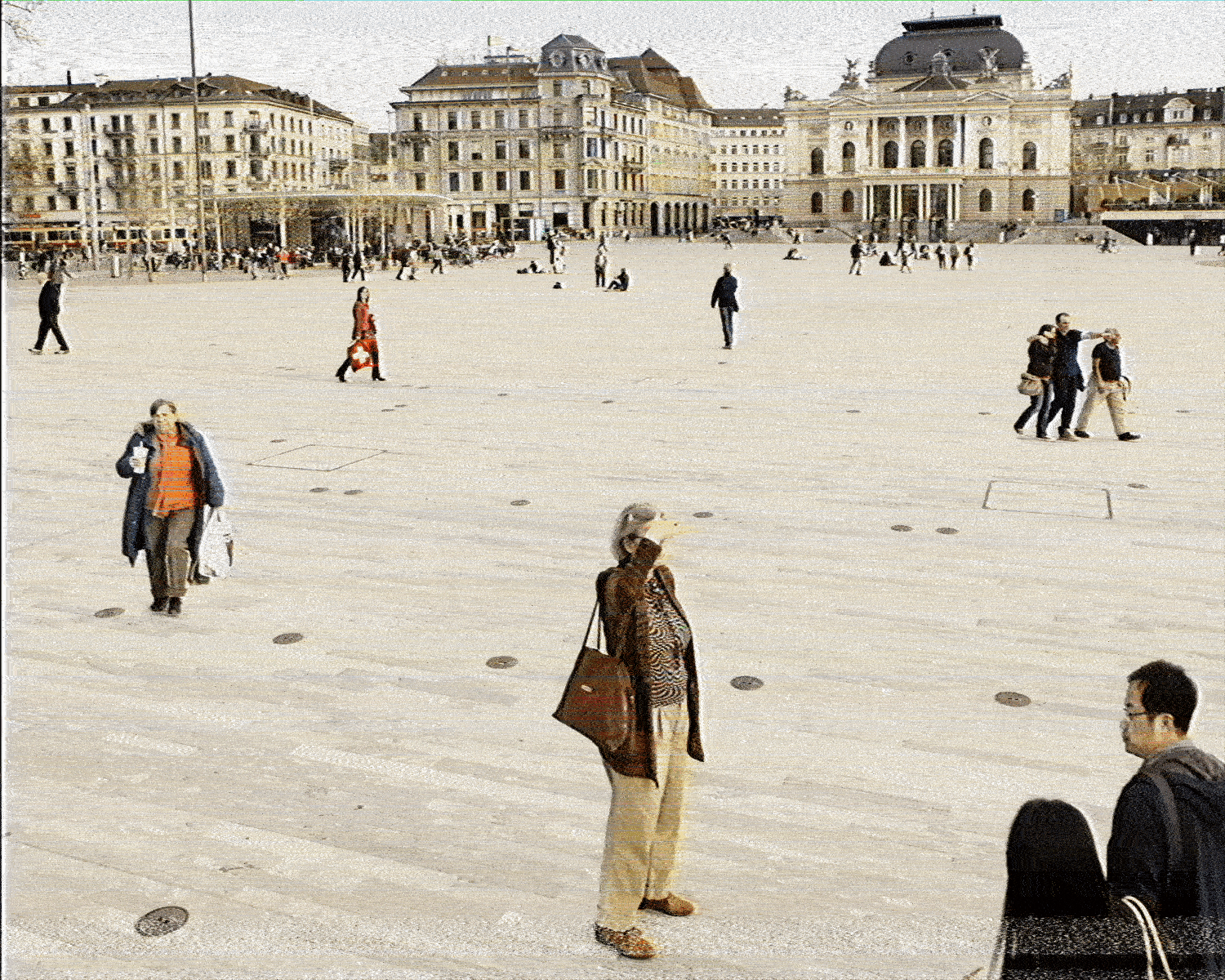
Wellenritt ins Ungewisse
Der Aufbau des 5G-Netzes stösst auf Widerstand. Der Grund: Über die Gesundheitsrisiken ist wenig bekannt – jedenfalls weniger, als die Industrie behauptet. Doch die Schweiz knausert bei der Forschung. Der Mobilfunkreport, Teil 1.
Von Pascal Sigg (Text) und Yoshi Sodeoka (Animation), 30.05.2023
Das Misstrauen in Herrliberg am Zürichsee war an diesem Abend im Januar irgendwann so gross, dass die Leute keine Antworten auf Fragen mehr hören wollten. Sie winkten stattdessen nach dem Mikrofon, um Dinge richtigzustellen, Ärger loszuwerden, auf Ungereimtheiten hinzuweisen.
Eigentlich wollte Sunrise-CEO André Krause in seiner Wohngemeinde selber «korrekt und umfassend» über den Mobilfunkstandard 5G und den Schutz der Bevölkerung informieren. So hatte ihn die «Zürichsee-Zeitung» zitiert, nachdem sich Anwohnerinnen gegen das Bauprojekt einer zusätzlichen Sunrise-Mobilfunkantenne auf einem Wohnblock gewehrt hatten.
Krause lud in den imposanten Saal des Restaurants Rössli zur Vogtei. Hier war Krause nicht im gläsernen Firmenhauptsitz am nördlichen Zürcher Stadtrand. Hier war er bei den Leuten.
Und die Leute waren über die Gesundheitsrisiken von Mobilfunkstrahlung offensichtlich anderer Meinung als der Sunrise-Chef. Krause zeigte dazu bloss eine einzige Folie mit dem Titel: «Über 30 Jahre Forschung: keine Gesundheitsrisiken». Den Rest der Präsentation überliess er Dr. Jürg Eberhard, der «interessenneutrale Vermittlung der Wissenschaft» versprach.
Der Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes kommt in der Schweiz nicht so voran, wie sich das die Anbieter wünschen. Die Widerstände gegen die neue Technologie sind gross; viele Menschen fürchten um ihre Gesundheit. Doch Politik und Wissenschaft gelingt es nicht, Vertrauen zu schaffen. Was läuft falsch? Eine Miniserie in zwei Teilen. Zur Übersicht.
Sie lesen: Teil 1
Wellenritt ins Ungewisse
Doch selbst der kostenlose Wein und die offerierten Apérohäppchen konnten die Stimmung nicht retten. «Alles wird erlogen!», polterte ein aufgebrachter Herr ins Mikrofon. Zwar fehlten Verschwörungstheorien, und die Leute im Saal brachten ihre Ansichten mehr oder weniger gesittet zum Ausdruck. Krause, der stets ruhig geblieben war, sagte trotzdem irgendwann: Wer selber informieren wolle, möge eine eigene Veranstaltung abhalten.
Am Ende des Abends, als alles gesagt und wenig besprochen war, blieben nicht nur viele Häppchen übrig, sondern auch zwei Erkenntnisse:
Das Misstrauen gegenüber Mobilfunkanbietern ist immens.
Es wird dadurch angefacht, dass Sunrise und Co. in den Augen vieler die Gefahren der Mobilfunkstrahlung kleinreden.
Sind tatsächlich viele Schweizerinnen übertrieben ängstlich und schlecht informiert? Oder verharmlosen Politik und Industrie mögliche Gesundheitsrisiken von Mobilfunkstrahlung? Mit diesen Fragen muss sich aktuell auch das Schweizer Parlament beschäftigen. Eine Motion der FDP-Fraktion sieht vor, das 5G-Netzwerk so schnell wie möglich aufzubauen und dabei die Grenzwerte erheblich zu erhöhen. National- und Bundesrat befürworten den Vorstoss. Die zuständige Kommission des Ständerats hat letzte Woche entschieden, dass der Aufbau des 5G-Netzes vorangetrieben werden soll, jedoch ohne Erhöhung der Grenzwerte. Kommende Woche berät der Ständerat darüber.
Die Strahlung erreicht unsere Körper
Damit wir auf einem Spaziergang facetimen oder Emojis verschicken können, nutzen unsere Smartphones elektromagnetische Felder, die von Mobilfunkantennen erzeugt werden. Die Felder bewegen sich in Wellen, ähnlich denjenigen, die ein ins Wasser geworfener Stein in einem stillen Teich verursacht. Die Wellen werden zu Informationsträgern, indem beispielsweise ihre Höhe (die Amplitude) oder der Abstand der Wellenberge (die Frequenz) verändert wird. Die Wellen verebben, wenn keine weiteren Antennen sie aufnehmen.
Grundsätzlich stimmt: Je kürzer der Abstand zwischen den Antennen ist, desto weniger müssen sie leisten, um einander zu erreichen. Experten erklären deshalb immer wieder, dass die meiste Strahlung von den Endgeräten selber ausgeht – vor allem bei schwachem Empfang.
Die hochfrequente 5G-Technologie nutzt zwar dieselbe Art von Wellen. Doch ihr zentrales Versprechen lautet: viel höhere Effizienz durch eine verbesserte Art der Übertragung dieser Wellen. Neue, sogenannt adaptive Antennen können ihre abgestrahlte Leistung konzentrierter und gezielter aussenden. Sie sind nur dann aktiv, wenn Daten übertragen werden, und nur in die Richtung des aktiven Empfängers. Weil diese Antennen auch mehrere Benutzerinnen innerhalb eines Strahls gleichzeitig versorgen können, kann ihre Strahlung allerdings kurzzeitig intensiver sein als diejenige herkömmlicher Technologien.
Egal ob kurz und stark oder lang und schwach: Die Energie dieser Wellen erreicht auch unsere Körper. Und die Strahlung tieferer Frequenzen dringt tiefer ein als diejenige höherer Frequenzen.
Je nach Eindringtiefe sind andere Körperzelltypen betroffen. Unsere Körper senden auch selber elektromagnetische Wellen aus, insbesondere via Nervensystem. Sie tun dies allerdings auf deutlich tieferen Frequenzen als der Mobilfunk. Grundsätzlich gilt: Unsere Körper werden leitfähiger, je höher die Frequenz der von aussen eintreffenden Wellen ist.
Beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen mit möglichen Auswirkungen von Handystrahlung auf unsere Gesundheit, müssten sie zum Beispiel folgende Fragen interessieren: Was genau passiert kurz- und langfristig in Hautzellen, wenn sie mit intervallartiger Handystrahlung verschiedener Frequenzen in Kontakt kommen? Wie reagiert das Nervensystem auf die Signale von aussen? Und unter welchen Umständen könnten diese uns allenfalls schaden?
Eine zu einfache Antwort
An der Veranstaltung in Herrliberg hatte Jürg Eberhard eine einfache Antwort auf diese komplizierten Fragen: Mobilfunkstrahlung habe nur dann gesundheitliche Folgen, wenn sie die Haut zu stark erwärme. Und dies passiere erst bei hundertfacher Überschreitung der Grenzwerte, die hierzulande übrigens so streng seien wie weltweit sonst nirgends.
Tatsächlich muss die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern mit Mobilfunkstrahlung besonders vorsichtig umgehen. Denn das Umweltschutzgesetz beinhaltet ein Vorsorgeprinzip. Sofern die Schädlichkeit einer Technologie «feststeht oder zu erwarten ist», sieht dieses einen besonderen Schutz vor. Deshalb kennt die Schweiz auch besonders tiefe Grenzwerte.
Eberhards Erklärung war trotzdem bemerkenswert. Denn sie beruhte auf einer unvollständigen Betrachtung des Forschungsstands. Eberhard ignorierte etwa die Interpretationen und Empfehlungen, welche die Beratende Expertengruppe für nicht ionisierende Strahlung (Berenis) vor zwei Jahren im zweiten Corona-Lockdown in einem Sondernewsletter verschickt hatte. Die Gruppe, 2014 vom Bundesamt für Umwelt einberufen, sichtet regelmässig neue publizierte wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Mobilfunkstrahlung und wählt jene zur detaillierten Bewertung aus, welche aus ihrer Sicht für den Schutz von Mensch und Umwelt von Bedeutung sein könnten.
Nun hatten zwei Mitglieder, Meike Mevissen von der Universität Bern und David Schürmann von der Universität Basel, in einer vom Bundesamt für Umwelt in Auftrag gegebenen Übersichtsstudie alle zwischen 2010 und 2020 erschienenen relevanten Tier- und Zellstudien auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Zellstress und nicht ionisierender Strahlung untersucht.
Ihr Fazit: Auch unter Berücksichtigung methodischer Schwächen zeichne sich eine Tendenz ab, dass schon wenig Strahlung zu Veränderungen in Zellen führen könne. Es gebe Hinweise, dass Mobilfunkstrahlung bereits im Bereich der bestehenden Grenzwerte gesundheitliche Auswirkungen haben könne. Dies gelte insbesondere bei Kindern und Betagten sowie Menschen mit Immunschwächen oder neurodegenerativen Erkrankungen wie Diabetes, Multipler Sklerose oder Demenz.
Als Jürg Eberhard in Herrliberg darauf angesprochen wurde, projizierte er eine bisher nicht gezeigte Folie, um die Bedenken im Saal zu zerstreuen. Bei den erwähnten Wirkungen, sagte er, handle es sich um ein «nicht konsistent nachgewiesenes gesundheitliches Risiko».
Daraufhin meldete sich eine Dame aus dem Publikum, die sich als promovierte Biochemikerin vorstellte. Die Leute seien nicht ängstlich, sondern machten sich berechtigte Sorgen, sagte sie. Und fügte bei: «Es sind genügend Studien da.»
Als ein Mann fragte, ob für Menschen mit Multipler Sklerose besondere, von Mobilfunkstrahlung verursachte Gesundheitsrisiken bestünden, gab Eberhard Entwarnung. Worauf sich der Herr, der sich als Elektroingenieur vorgestellt hatte, demonstrativ von seinem Platz erhob und zu einem der Bartische schritt.
Es war offensichtlich: Eberhard stiess viele Anwesende, die sich selber vertieft mit der Sache beschäftigt hatten, vor den Kopf, weil sie seine Position nicht teilten. Und er mit dieser die Mobilfunkanbieter stützte. Eberhard schreibt dazu auf Anfrage, ihm sei an der Veranstaltung in Herrliberg «offensichtlich nicht gelungen, den Stand des Wissens beziehungsweise Unwissens aufzuzeigen».
Was die Industrie behauptet
Das Problem: Nichtwissen wird von der Industrie forsch zu Wissen umgedeutet. Wenige Tage nach der Infoveranstaltung in Herrliberg sagte Sunrise-CEO Krause in der SRF-Sendung «Eco Talk»: «Die wissenschaftliche Erkenntnis, die wir heute haben, weist klar nach, dass es keine bedenklichen Herausforderungen der 5G-Strahlung gibt.» Salt-CEO Pascal Grieder legte kurz darauf im «Blick» nach: «Die seriösen wissenschaftlichen Studien sind ausgesprochen klar in der Aussage, dass Mobilfunkstrahlung weitgehend unbedenklich ist.»
Von einem derartigen Konsens ist die Wissenschaft allerdings weit entfernt.
Der polnische Forscher Dariusz Leszczynski ist einer der international respektiertesten Experten auf dem Gebiet. «Wir haben Tausende Studien, aber die meisten sind von schlechter Qualität», sagte er unlängst in einem Podcast-Interview. «Wenn die Leute wüssten, wie schlecht die Qualität der Studien ist, auf Basis derer wir sagen, dass wir vor der Strahlung geschützt sind, wären sie erstaunt und schockiert.»
Trotz Tausender Studien ist also immer noch zu wenig über die möglichen Wirkungen nicht ionisierender Strahlung bekannt. Und damit ist der Raum für unterschiedliche Interpretationen riesig.
Wichtig in diesem Interpretationsstreit ist die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung ICNIRP. Die Gruppe von Forscherinnen ist sehr einflussreich, da sie Empfehlungen für Grenzwerte abgibt. Allerdings verfügt der Verein, der seine Mitglieder selber bestimmt, über kein offizielles Mandat dazu. Nachdem Medienberichte und die Grünen im EU-Parlament Interessenkonflikte und fehlende Transparenz kritisiert hatten, erklärte sich die Gruppe vor einem Jahr. Heute publiziert sie ihre Jahresberichte und deklariert Einnahmen und Interessen der Mitglieder.
Die Position der ICNIRP bleibt jedoch radikal: Risiken, die nicht wissenschaftlich zweifelsfrei bewiesen sind, anerkennt sie nicht. Und sie akzeptiert weiterhin nur das sogenannte thermische Wirkmodell, wonach nicht ionisierende Strahlung die Oberfläche menschlicher Körper einzig erwärmen kann.
2020 präsentierte die Gruppe überarbeitete Empfehlungen zur Festsetzung der Grenzwerte. Ihr Vorsteher sagte, die Richtlinien seien nach einer gründlichen Sichtung der relevanten Wissenschaftsliteratur entwickelt worden: «Sie schützen gegen alle wissenschaftlich nachgewiesenen Gesundheitsbeeinträchtigungen durch elektromagnetische Felder im Spektrum von 100 Kilohertz bis 300 Gigahertz.» Die Schweizer Mobilfunkanbieter berufen sich bei ihrer Interpretation der Gesundheitsrisiken auf diese Beurteilungen der Gruppe.
Gegründet worden war sie 1992 unter anderem vom australischen Strahlenforscher Michael Repacholi. Dieser liess sich später als Direktor des Programms zur elektromagnetischen Strahlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mobiltelefonhersteller Motorola jährlich 50’000 Dollar zuschanzen. Im Nachhinein wurde dann bekannt, dass Motorola 1994 zusammen mit einer PR-Firma unliebsame Forschungsergebnisse gezielt in Zweifel gezogen hatte.
Die Strategie: konsequent darauf hinweisen, dass Studienergebnisse noch nicht bestätigt wurden. Zudem sollten glaubwürdige, respektierte Wissenschaftler rekrutiert werden, die diesen Standpunkt anstelle eigener Expertinnen vertraten. Der damals verantwortliche, auf Energiethemen spezialisierte Berater arbeitete von 2014 bis 2020 bei der PR-Agentur Hill + Knowlton Strategies – einer Partnerin der Berner Agentur Furrerhugi, die im Auftrag des Schweizerischen Verbands der Telekommunikation (Asut) lobbyiert.
Die enge Interpretation der ICNIRP, wonach Mobilfunkstrahlung bloss die Hautoberfläche erwärmen kann, teilen heute nicht mehr viele Forscherinnen. Im vergangenen Jahr kamen Kritiker zum Schluss, dass sich die Gruppe bei der Überarbeitung der Strahlenschutzgrenzwerte im Jahr 2020 selbstreferenziell auf lediglich 17 Autoren bezogen hatte, die fast alle mit ihr verbunden waren. Skeptische Wissenschaftlerinnen gründen deshalb eigene Gruppen, die andere Empfehlungen abgeben, oder unterzeichnen Appelle. Damit rufen sie die WHO und die Uno sowie deren Mitgliedsstaaten dazu auf, die globalen Bedenken bezüglich der Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung auf Mensch und Umwelt ernst zu nehmen.
Auch die Schweizer Berenis-Gruppe will sich nicht zu stark an den Empfehlungen der ICNIRP orientieren: Es gebe weiterhin genügend Unsicherheiten, insbesondere im Bereich der 5G-Frequenzen.
Resilienz, Ratten und Replikationen
Drei Monate nach dem Herrliberger Infoabend sitzt Berenis-Mitglied Jürg Fröhlich im engen Sitzungszimmer seiner Kleinfirma in einem unscheinbaren Altbau oberhalb des Zürcher Hegibachplatzes. Die Firma stellt Geräte zur wissenschaftlichen Messung nicht ionisierender Strahlung her. Vor der Firmengründung 2014 hatte er 9 Jahre an der ETH an biologischen und medizinischen Anwendungen und Auswirkungen von elektromagnetischen Wellen und Licht geforscht.
Heute beliefert seine Firma Umweltämter und Universitäten auf der ganzen Welt mit Geräten, die für die epidemiologische Forschung eingesetzt werden.
Fröhlich gilt als integer und unabhängiger als andere, weil er auf keine Zuwendungen aus der Industrie angewiesen ist, keine Forschungsgelder akquirieren muss. Er sagt, er habe sich während des Studiums zunehmend für Wissenschaftstheorie und -soziologie interessiert. Wie kommt man mit einer gewissen Methodik zu einem sogenannten Konsens über die Wahrheit, und was bedeutet diese?
Und so ist Fröhlich ein gefragter Mann, wenn es um Studien geht, die die Wirkung von Mobilfunkstrahlung untersuchen.
Herr Fröhlich, weshalb wissen wir denn so wenig über die Gesundheitsrisiken von Mobilfunkstrahlung?
Fröhlich nennt vier Gründe.
Erstens: Das Forschungsfeld ist komplex und braucht interdisziplinäre Expertise. Um elektromagnetische Felder und Mobilfunktechnologien zu verstehen, ist physikalisches und technisches Wissen nötig – von Physikern, Elektroingenieurinnen. Um den menschlichen Körper zu verstehen, braucht es zum Beispiel Mediziner, Mikrobiologinnen oder Neurologen.
Zweitens: Verschiedene biologische Effekte von Mobilfunkstrahlung sind zwar identifiziert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Effekte auch gesundheitliche Auswirkungen haben. So kann Zellstress innerhalb eines bestimmten Bereichs beispielsweise auch regenerativ wirken: «Unsere Körper sind Selbstreparaturmaschinen. Aber wir haben noch nicht identifiziert, unter welchen Umständen der Zellstress mehr schadet als nützt. Dies ist direkt auch sehr schwer bestimmbar, da sehr viele Einflüsse Zellstress erzeugen können.»
Drittens: Bezüglich Einflüssen auf Gewebe gibt es kaum Forschung am Menschen direkt, weil das in der Praxis schwierig umzusetzen ist. Die meisten Studien basieren auf Tierversuchen oder Experimenten mit Zellkulturen oder Modellorganismen, wobei unklar bleibt, ob sich die Resultate auf den Menschen übertragen lassen.
Und viertens: Von fast allen wichtigen Studien, in denen Forscher allenfalls gesundheitsschädliche Wirkungen identifizierten, fehlen Replikationsstudien, welche die Resultate ein zweites oder drittes Mal unabhängig überprüfen.
Dies ist insbesondere auch bei der bisher grössten und teuersten Langzeitstudie der Fall, der sogenannten NTP-Studie des US-Gesundheitsdepartements. Sie kostete 30 Millionen Franken. Doch die Versuchseinrichtung – alleine im Wert von 10 Millionen – wurde vor der Auswertung der Resultate sofort wieder abgebaut. Nun soll die Studie endlich in Japan und Südkorea teilweise wiederholt werden. Allerdings nicht mit derselben Bestrahlungsintensität.
Fröhlich schüttelt den Kopf: «Ich kann mir mit Studienreplikationen nichts verdienen. Aufregender ist es, einen Effekt zu entdecken. Eigentlich müsste man mit jeder Studie auch gleich zwei unabhängige Replikationen ansetzen und im Preis einrechnen.»
Und so kann Fröhlich die Ergebnisse vieler aufwendiger und seriöser Studien nur unbefriedigend mit folgendem Prädikat bewerten: begrenzte Evidenz.
Die Hoffnung: Staatlich motivierte Forschung
Trotzdem liefern viele dieser Studien immerhin bemerkenswerte Hinweise, die weitere Forschung eigentlich unabdingbar machen. Kann Mobilfunkstrahlung allenfalls das Gleichgewicht innerhalb von Zellen entscheidend stören? Kann sie Vorerkrankungen verstärken? Reagieren unter Umständen junge und alte Menschen sensibler? Wie genau kann sie die Hirnaktivität beeinflussen? Schadet sie der menschlichen Fortpflanzungsfähigkeit?
Zu all diesen Fragen gibt es internationale Expertinnen, die besorgt sind. Hugh Taylor zum Beispiel, Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Yale School of Medicine, sagte dem US-Onlinemagazin «Pro Publica»: «Die Beweise sind sehr, sehr stark, dass es einen kausalen Link gibt zwischen Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Mobilfunkstrahlung.» Während der Zeit der Gehirnentwicklung sei der Fötus sehr verletzlich. Auch er bezog sich dabei auf Forschung mit Mäusen.
Woran sollte denn jetzt besonders intensiv geforscht werden, Herr Fröhlich?
«Ich würde beim Nervensystem ansetzen. Damit erzeugen unsere Körper selber elektromagnetische Felder. Gibt es einen direkten oder indirekten Einfluss auf neurodegenerative Krankheiten wie Demenz oder Multiple Sklerose? In diesem Bereich wird experimentell bereits geforscht. Doch man steht erst ganz am Anfang.»
Sinnvoll fände Fröhlich auch, wenn seine frühere Forschung weiterverfolgt würde. Konkret: Was passiert akut, wenn Radiofrequenzstrahlung für Therapie und Diagnose genutzt wird? Gibt es irgendwelche Nebeneffekte, die allenfalls wieder korrigiert werden, oder nicht? Mit seinen Forschungskollegen hat er beobachtet, dass man mit niederfrequenten Magnetfeldern ab einer bestimmten Stärke die Zellregeneration anregen und dies biologisch messen kann. «Die Frage stellt sich nun: Ab welchem Level passiert dies nicht mehr? Und was sind die entscheidenden Faktoren?»
Gegenwärtig laufen international zahlreiche grosse Forschungsanstrengungen. Ein Cluster von vier Projekten von drei bis fünf Jahren Laufzeit hat total 29 Millionen Euro aus dem «Horizon»-Topf der EU erhalten. Fröhlich ist an einem dieser Projekte beteiligt. Das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut an zwei. Auch die WHO gab systematische Reviews in Auftrag, deren Ergebnisse im Verlauf dieses Jahres erwartet werden.
Fröhlich verspricht sich dabei am meisten von staatlich motivierter Forschung durch politischen Druck. Risikoforschung sei aufwendig, meist fächerübergreifend und führe nicht zu schnellen Publikationen. Zudem sei der Bereich elektromagnetische Strahlung weniger attraktiv für die persönliche Profilierung im akademischen Umfeld als neue Technologien. «Was erforscht wird, ist nicht immer zuerst eine wissenschaftliche Frage, sondern eine Vorliebenfrage», sagt Fröhlich: «Wofür erhält man Aufmerksamkeit? An welche Fördertöpfe gelangt man? Es gibt Wissenschaftler, die sich dieser Fragen auch so annehmen, aber meistens wird diese Forschung getriggert durch ein politisches Bedürfnis nach Klärung und nicht durch die hochgelobte curiositas.»
Fröhlichs Standpunkt ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die hitzig geführte Debatte um die Risiken von 5G vor allem eines zeigt: Die Frage, welche Risiken wir bei der immer intensiveren Technologisierung von immer mehr Lebensbereichen eingehen wollen, ist hochpolitisch. Reicht es uns, zu sehen, dass die Krebsrate ganz allgemein nicht gestiegen ist? Oder wollen wir mit aller Sicherheit ausschliessen können, dass Mobilfunkstrahlung womöglich dazu beiträgt, dass unser Nervensystem Schaden nimmt? Wie viel wollen wir wissen?
Und wem sind wir zu vertrauen bereit?
Industrie-PR im ETH-Mäntelchen
Die Mobilfunkanbieter selber behandeln diese Fragen zweifellos bereits hochpolitisch. Dabei suchen sie die Autorität wissenschaftlicher Expertise. Jürg Eberhard – der von Sunrise geladene Experte – wurde später in einem Bericht über den Anlass in Herrliberg von TeleZüri als «Strahlenforscher» bezeichnet. Und Sunrise-CEO André Krause sagte kurz darauf, Eberhard erforsche das Thema an der Universität Zürich.
Beides stimmt nicht und suggeriert eine Expertise, die Eberhard gar nicht hat.
Jürg Eberhard ist nämlich kein Mobilfunkexperte. Vielmehr trat er in Herrliberg als Geschäftsführer der «Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation» auf. Die Stiftung bezeichnet sich als «die kompetente Anlaufstelle für Personen und Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft». Es ist eine Organisation der Mobilfunkindustrie. Swisscom, Salt, Sunrise und der Branchenverband Asut sind alle dabei.
Eberhard verfügt zwar über einen Doktortitel der ETH, doch elektromagnetische Strahlung ist nicht sein Fachgebiet. Er forscht auch nicht selber, obschon er auch schon als ETH-Forscher betitelt wurde. Gemäss eigenen Angaben hat er Erfahrung mit der Entwicklung und dem Management von Start-ups und auf Führungsebene im Energiesektor. Auf Anfrage schreibt Eberhard, er beschäftige sich seit 2021 mit Mobilfunk, und seine Tätigkeit beschränke sich auf «Zusammenfassungen von andernorts durchgeführten Studien».
Auch sein Arbeitgeber forscht nicht selber. Die «Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation» vergibt Gelder für Forschungsprojekte, publiziert Ergebnisse in wissenschaftlichen Publikationen und vermittelt «Forschungsfakten und Sachwissen in der Gesellschaft». «Wir halten es für richtig und wichtig», schreibt Eberhard, «wenn die Industrie Eigenverantwortung wahrnimmt und Forschung zu den Auswirkungen der von ihr eingesetzten Technologien mitfinanziert und diese Aufgabe nicht allein beim Staat hängen bleibt.»
Doch diese Forschung nach dem Verursacherprinzip ist höchst bescheiden alimentiert. Via Stiftung haben die Mobilfunkunternehmen in den letzten Jahren verhältnismässig wenig Geld in Forschungsprojekte gesteckt. 2021 waren es total 250’000 Franken, 2022 waren es 325’000 Franken und 2023 100’000 Franken – 2024 sei dafür ein grösseres Projekt geplant.
Laut Jürg Fröhlich kostet ein seriöses Forschungsprojekt allerdings mindestens 500’000 Franken – und sollte idealerweise wiederholt werden. Fröhlich sitzt im wissenschaftlichen Ausschuss der Stiftung. Er erhält dafür kein Geld und beteuert, dass die vertraglich abgesicherte Firewall zwischen Forschung und Auftraggebern funktioniere. Die Unternehmen könnten keinerlei Einfluss auf die Vergabe und die Durchführung der Forschungsprojekte nehmen.
Viel Stiftungsgeld fliesst so in Kommunikation und Gatekeeping. Gemäss Eberhard gehört zu seiner Arbeit auf der Geschäftsstelle tägliches Monitoring wissenschaftlicher Publikationen oder die Teilnahme an Konferenzen. «Wir geben zu Fachfragen Auskunft gegenüber Sponsoren, Trägern, kantonalen Fachstellen, Gemeinden, Medien, Unternehmen und Privatpersonen. Zudem organisieren wir regelmässig Informationsanlässe und halten Vorträge.» Doch hier fehlt eine vergleichbare Firewall zu den Trägern.
Dies führt schon lange zu Kritik. Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz verliessen 2006 die Stiftung. 2015 sagte die Organisation, die Unabhängigkeit der Information sei «nicht gewährleistet, wenn eine Stiftung, welche hauptsächlich durch die Immissionsverursacher beauftragt wird, bewerten soll, ob die durch den Immissionsverursacher verursachte Immission gesundheitsgefährdend ist».
Was der Forschungsstiftung trotz allem wissenschaftliche Glaubwürdigkeit verleiht: Sie hat eine Adresse in einem ETH-Gebäude und eine ETH-Web-URL, Jürg Eberhard verfügt über eine ETH-E-Mail und ein ETH-Angestelltenprofil. Doch der Eindruck, dass die Stiftung ein Teil der ETH ist, erweist sich als falsch. Gemäss Eberhard ist sie dort bloss «eingebettet». Das Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik stelle der Stiftung ein Büro samt Infrastruktur zur Verfügung, schreibt Eberhard. Die ETH-Medienstelle bestätigt dies. Die Stiftung sei «administrativ» dem Leiter des Instituts für Elektromagnetische Felder unterstellt.
Allerdings: Es existieren keine Verträge, die die Beziehung regeln. Institutsleiter ist Jürg Leuthold, der selber die Technologie und nicht deren mögliche Gesundheitswirkungen erforscht und vor vier Jahren trotzdem sagte, das einzig Gefährliche an 5G sei für ihn die Angst vor 5G.
Die ETH, so Eberhard, profitiere von der Arbeit seiner Stiftung als «Kompetenzzentrum, welches sich ausschliesslich mit Fragen rund um elektromagnetische Felder und deren Auswirkungen beschäftigt und die Forschung auf diesem Gebiet international verfolgt». Es gebe keine andere Stelle in der Schweiz, die diese Aufgabe erfüllte.
Nur: Das stimmt nicht. Die vom Bundesamt für Umwelt eingesetzte Expertengruppe Berenis tut exakt dasselbe – und bewertet den Forschungsstand mit deutlich mehr wissenschaftlicher Expertise vorsichtiger und kommuniziert deutlich zurückhaltender.
Die verschwundenen Millionen
Der Bund ist auch der kräftigste Förderer von Forschung zu Mobilfunkstrahlung. Trotzdem stockt es auch dort, obschon der politische Wille vorhanden wäre. 2019 forderte die SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, die im Vorstand des Telecom-Branchenverbands Asut ist, den Bundesrat in einer Motion auf, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, um «die gesundheitlichen Wirkungen» der Mobilfunkstrahlung «besser zu klären». Die Arbeiten sollten durch die Einnahmen aus der Versteigerung der Mobilfunkkonzessionen von 2019 finanziert werden, mit denen der Bund fast 380 Millionen Franken eingenommen hatte. Denn Graf-Litscher erachtete die existierenden Forschungsbudgets als «völlig ungenügend».
Der politische Prozess verlief ziemlich schnell: Zwei Monate später beantragte der Bundesrat die Annahme der Motion, kurz vor Weihnachten stimmte der Nationalrat zu, nur ein Jahr nach der Einreichung auch der Ständerat.
Verwaltung und Parlament waren sich für einmal einig: Die Schweiz benötigt mehr Geld für Forschung über die gesundheitlichen Wirkungen von Mobilfunk, und der Bund soll es zur Verfügung stellen.
Doch mehr als zwei Jahre später fehlen die Mittel dafür noch immer. Auf Anfrage schreibt das Bundesamt für Umwelt, es sei daran, die Motion umzusetzen, und verweist auf sechs Forschungsprojekte, die vor wenigen Monaten starteten. Für die zehnjährige Förderung habe man ein Gesamtbudget von 8 Millionen Franken.
Allerdings floss für diese Forschung gar kein zusätzliches Geld. Das Bundesamt für Umwelt habe dafür «intern Ressourcen priorisiert und somit keine zusätzlichen Mittel erhalten». Weshalb, bleibt unklar. Gemäss einem Controllingbericht erachtet das zuständige Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation seinen Umsetzungsauftrag trotzdem als erledigt.
Hat es die Motion verwässert? Das Departement will sich nicht äussern, nicht einmal zum Status der Motion. Eine Anfrage bleibt trotz Eingangsbestätigung zwei Wochen lang unbeantwortet. Auch drei Anrufe zu Bürozeiten beantwortet niemand.
Die fast 380 Millionen Franken, die der Bund für die 5G-Konzessionen von den Mobilfunkunternehmen erhielt, sind allem Anschein nach schon ausgegeben. Bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung heisst es auf Anfrage: «Einnahmen aus Versteigerungen von Mobilfunklizenzen fliessen in die allgemeine Bundeskasse und werden für die verschiedensten Aufgabengebiete (soziale Wohlfahrt, Verkehr, Finanzen und Steuern, Bildung und Forschung etc.) verwendet.»
Wie das Parlament fordern auch die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz mehr Forschung. Sie sind die einzige Organisation mit medizinischem Fokus, die sich ausserhalb der Verwaltung mit Risiken von Funkstrahlung beschäftigt.
In einer ausführlichen Stellungnahme gegenüber der Republik schreibt der Verein: «Gerade jetzt, da im Rahmen der digitalen Transformation und der Einführung neuer Mobilfunkstandards die Durchdringung des Alltags mit nicht ionisierender Strahlung zunimmt, müssen sich nationale und internationale Regulierungsbehörden und Beratungsgremien die Frage stellen, ob die geltenden Regulierungen genügend schützen.» Zudem rechtfertige der aktuelle Forschungsstand auch eine konsequente Umsetzung des Vorsorgeprinzips.
«Die pauschale Entwarnung gibt es nicht», sagt Berenis-Mitglied Jürg Fröhlich. «Ich sehe nicht, dass es etwas gibt, was alarmierend ist, aber das heisst nicht, dass man es nicht weiter beobachten muss.» Zudem verweist Fröhlich auf die Position seiner Expertengruppe. «Es gibt im Moment keine Basis, um etwas zu ändern. In unserem Umweltschutzgesetz steht das Vorsorgeprinzip. Der Vorsorgegrenzwert gilt, weil etwas nicht vollends geklärt ist. Und solange sich diese Unsicherheit nicht auf ein vertretbares Niveau reduziert hat, lässt man es, wie es ist.»
Die Recherche für den zweiteiligen Mobilfunkreport wurde von Journafonds finanziell unterstützt.