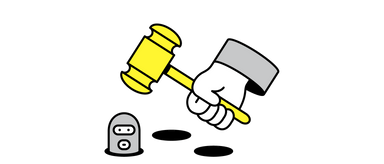
Die DNA der Brandstifterin
Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in St. Gallen wird mitten in der Nacht Brennpaste angezündet. Mit viel Glück kommt es nicht zur Katastrophe. Die Spuren deuten auf eine Mieterin hin. Doch die will es nicht gewesen sein.
Von Sina Bühler, 10.05.2023
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
1869 gelang es dem Basler Forscher Friedrich Miescher erstmals, Desoxyribonukleinsäure zu isolieren – auf Englisch und meist auch auf Deutsch kurz DNA genannt. Er entdeckte sie, als er mit Wundverbänden voller Eiter experimentierte. Erst viele Jahre später, 1944, wurde belegt, dass es sich dabei um die Trägerin der Erbinformation handelt, worauf ein wissenschaftlicher Wettlauf um die Erforschung der DNA-Struktur begann. Zwei Teams entschlüsselten die Doppelhelix-Struktur. Das war vor ziemlich genau siebzig Jahren.
Die Entdeckung der DNA hat die polizeiliche Ermittlungsarbeit revolutioniert – obwohl diese Nutzung anfänglich nicht im Fokus stand. DNA enthält individuelle menschliche Bausteine. Finden sich an einem Tatort oder an einem Tatinstrument DNA-Spuren, verfügen die Strafverfolger über wichtige Hinweise zur Täterschaft. Um den genetischen Fingerabdruck zu ermitteln, wird die DNA – von der schon winzige Proben ausreichen – mit Enzymen zerlegt, nach Grössen aufgetrennt und mithilfe radioaktiver Sonden sichtbar gemacht. Die Muster sind so einzigartig wie mechanische Fingerabdrücke.
Der Mörder von zwei 15-jährigen Mädchen in der britischen Stadt Leicester war 1987 der erste Täter, der durch die DNA-Methode überführt wurde. Und, was genauso wichtig war: Die Methode hat einen anderen Verdächtigen entlastet – einen psychisch kranken Mann, der einen der Morde gestanden hatte.
Auch sogenannte cold cases können nachträglich mithilfe von DNA-Analysen gelöst werden; beim angeblich ältesten Fall handelt es sich um einen Doppelmord im US-Bundesstaat Montana aus dem Jahr 1956. Indem die Ermittler sein DNA-Profil auf eine Online-Plattform luden, auf dem Menschen ihre Verwandten suchen, fanden die Strafverfolger seine Kinder – und über diesen Umweg den in der Zwischenzeit verstorbenen Täter.
DNA-Spuren sollen auch im Fall einer Brandstiftung in St. Gallen eine zentrale Rolle spielen.
Ort: Kreisgericht St. Gallen
Zeit: 25. April 2023, 8.30 Uhr
Fall-Nr.: ST.2022.10668
Thema: Versuchte qualifizierte Brandstiftung
«Sicherheitsbrennpaste» nennt sich das Produkt, es besteht aus Brennsprit und einem Bindemittel, das die Flüssigkeit zu Gel verwandelt – mit dem Zweck, dass die Paste nicht ausläuft, sollte das Fonduerechaud umkippen. Bei sachgemässer Verwendung gilt eine Paste als sicherer als der flüssige Brennsprit. Aber auch die Sicherheitsbrennpaste erzeugt eine offene Flamme, wenn sie angezündet wird.
Es ist Ende März 2022, mitten in der Nacht.
Jemand schleicht durchs Treppenhaus eines St. Galler Altstadthauses und verteilt den Inhalt von zwei Literflaschen Sicherheitsbrennpaste auf dem Boden, auf Fussmatten und Türschwellen im ganzen Gebäude. Vorher klebt die Person mit Malerband die Bewegungssensoren ab, die das Licht steuern. Vermutlich, damit das Verteilen des Brennstoffs nicht auffällt.
Zuletzt zündet sie auf einem Stockwerk die restliche Klebebandrolle an, auf dem nächsten Stock ein Stück abgerissenes Abdeckband, weiter oben einen getränkten Fussabtreter und schliesslich im vierten Stock eine hölzerne Türschwelle.
Nichts brennt, es glimmt nur.
Ein Riesenglück. Schier unvorstellbar, was alles hätte passieren können.
Mindestens vierzehn Bewohnerinnen befanden sich in dieser Nacht im Haus. Wäre der Brand ausgebrochen und auf die Nachbarhäuser übergesprungen – was dann? Wäre es zur gleichen Katastrophe gekommen wie vor dreissig Jahren, als ein Grossbrand in der St. Galler Altstadt vier Todesopfer forderte und fünf Häuser komplett zerstörte? Oder wäre nur wenig passiert, weil das Gebäude, in dem der Anschlag geschah, hauptsächlich aus Stein und Beton besteht?
Viele Fragen. Beklemmende Szenarien. Doch sie sind vor dem Kreisgericht St. Gallen nur am Rande ein Thema.
Im Zentrum steht eine 39-jährige Frau, die sich wegen versuchter Brandstiftung verantworten muss und sagt: «Ich war es nicht.»
Das Problem an ihrer Unschuldsbeteuerung: Ihre DNA war überall – auf den Bewegungssensoren, den Flaschen, den Schraubdeckeln, auf der Klebebandrolle. Wie ihre Spuren dorthin kamen, erzählt sie mit grosser Ausführlichkeit. Sie schildert, wie sie nach dem versuchten Brandanschlag durchs Treppenhaus spaziert sei und all die erwähnten Sachen angefasst habe. Wie sie mit ihren Fingern über jeden einzelnen Gegenstand gestrichen, sich kurz hingesetzt habe. Und dann die Polizei gerufen habe.
Das Problem an dieser Erklärung: Mehrere Gegenstände können nach der Brandlegung gar nicht berührt worden sein. Die Klebebandrolle beispielsweise, die halb abgebrannt war, auf der ein Zündholz lag – sie wäre bei einer Berührung zu Asche zerfallen, tat dies aber erst, als die Spurensicherung sie einpackte.
Oder die Russspur, die millimetergenau rund um die Flasche passte, die von der Beschuldigten angeblich aufgehoben und wieder hingestellt worden war. Die Flaschendeckel, die sie bei einer ersten Befragung nicht berührt haben will und an die sie sich plötzlich doch erinnern konnte, nachdem die Polizei ihre Spuren darauf gefunden hatte. Das Klebeband, das sie nicht vom Sensor gerissen haben wollte – ihre DNA war trotzdem drauf.
Ausserdem gibt es ein Überwachungsvideo aus dem Coop, auf dem zu sehen ist, wie sie eine Flasche Brennpaste kauft. Sie bezahlt mit Bargeld, kurz nachdem sie im gleichen Laden einen grösseren Einkauf mit ihrer Postcard beglichen und auf ihrer Treuekarte registriert hatte.
Wozu sie die Paste gebraucht habe, will der Gerichtsvorsitzende wissen. Zum Putzen, lautet ihre Antwort. Sie habe nicht realisiert, dass es kein Brennsprit sei. Doch was ist mit der halb vollen Brennspritflasche, die bei der Hausdurchsuchung direkt im Eingangsbereich ihrer Wohnung gefunden worden war? Sie habe vergessen, dass sie diese noch hatte, sagt die Frau.
Und nicht zuletzt: Wer auch immer den Brand gelegt hat, war die ganze Nacht im Haus. Auch das belegt eine Überwachungskamera. Es gibt zwar einen Hinterausgang, doch der war komplett mit Spinnweben verklebt. Niemand wäre dort durchgekommen, ohne sie zu zerreissen.
Auch dafür hat die Beschuldigte keine Erklärung.
Für die Staatsanwaltschaft steht ihre Schuld fest. Der Tatbestand der versuchten qualifizierten Brandstiftung sei erfüllt, fünf Jahren Freiheitsstrafe seien für die Frau angemessen.
Für Pflichtverteidiger Davide Scardanzan ist die Ausgangslage schwierig. Er beginnt sein Plädoyer mit einem literarischen Vergleich. Erst kürzlich, sagt er, habe Radiodetektiv Philip Maloney eine ähnliche Geschichte erzählt. Im sonntäglichen Hörspiel habe ein Mann beim Auffinden seiner erstochenen Frau als Erstes das Messer aus ihrer Brust gezogen, wobei sich seine DNA auf der Tatwaffe verteilt habe. Doch der Mann sei unschuldig gewesen.
Den Fall mit der realen Brandstiftung in der St. Galler Altstadt kann der Verteidiger weniger einleuchtend erklären – also konzentriert er sich vor allem auf die offenen Fragen, die weder Staatsanwaltschaft noch Polizei beantworten konnten.
Warum habe seine Mandantin das Haus nicht verlassen, wenn sie den Brand selbst gelegt habe? Sie sei nicht suizidär, das habe ein Gutachten bestätigt. Und: Sämtliche DNA-Spuren seien Mischprofile gewesen, zum Teil ohne genügende Sicherheit bestimmt.
Woher kam die zweite Flasche mit Brennflüssigkeit? Warum wurde bei seiner Mandantin keine Zündholzschachtel gefunden? Warum zog sie nach dem Vorfall in ein Hotel – aus Angst?
Die wohl wichtigste offene Frage ist jene nach dem Motiv. Auch dazu habe der Gutachter nichts finden können, sagt der Verteidiger. Und kommt im Umkehrschluss auf folgende Lösung: Es gibt kein Motiv, also war sie nicht die Brandstifterin. Staatsanwalt Stephan Ramseyer hingegen sagt: Sie bestreitet die Tat, also finden wir kein Motiv.
Einen wichtigen Hinweis aufs Wie und Warum der Brandstiftung liefert eine Frage von Kreisrichter René Suhner gleich zu Beginn des Prozesses: Wie es mit der Ordnung stehe, in ihrer neuen Wohnung, will er von der Beschuldigten wissen. Worauf klar wird: Die Frau ist ein Messie, und die Wohnung, die mit viel Glück nicht abgebrannt ist, vollgestopft mit Gesammeltem, Unrat, Abfall. Schämte sie sich deswegen und wollte sie mit dem Feuer das Chaos beseitigen?
Reine Spekulation.
Keine Spekulation bleibt fürs Gericht die Frage, ob sie es getan hat. Das dreiköpfige Gremium spricht die Frau der versuchten vorsätzlichen Brandstiftung schuldig. Alle Spuren würden auf ihre Täterschaft hindeuten, begründet Suhner das Verdikt: die DNA, der Kauf der Brennpaste und dass in jener Nacht niemand sonst ins Haus gekommen war.
Die Frau habe gewusst, dass sie mit ihrer Tat Menschen in Gefahr brachte, eine unkontrollierbare Feuersbrunst riskierte. Weil der angerichtete Schaden aber gering war (er lag bei 6736.80 Franken), fällt die Strafe tiefer aus als vom Staatsanwalt verlangt.
Die Frau wird zu zwei Jahren bedingt verurteilt, bei einer Probezeit von ebenfalls zwei Jahren. Lässt sie sich in dieser Zeit nichts zuschulden kommen, muss sie die Strafe nicht antreten. Die Untersuchungs- und Prozesskosten von 31’845.90 Franken muss sie hingegen übernehmen. Falls das Urteil rechtskräftig wird.
Illustration: Till Lauer