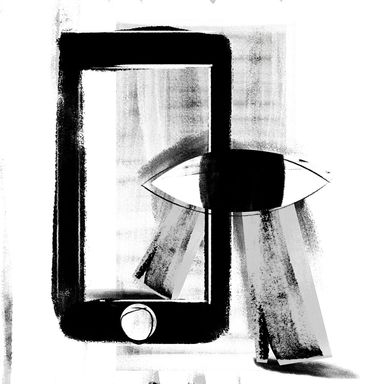
Apparatur des Fortschritts
Wie die Fotografie die wissenschaftliche Wahrnehmung der Welt veränderte. Und welche Rolle Fotografinnen und Wissenschaftlerinnen dabei spielten.
Von Urs Stahel, 18.06.2019
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Das Foto sieht für den Laien aus wie eine Dreh- oder Schmirgelscheibe, die über Jahre hinweg auf einer Werkbank benutzt und nun mit deutlichen Spuren des Gebrauchs von oben fotografiert worden ist. Allerdings liefe diese Lesart der leicht rätselhaften Bildzeichen hier kräftig ins Leere. Das Foto zeigt vielmehr zum ersten Mal eine zweidimensionale visuelle Spur der dreidimensionalen Doppelhelix, der Struktur unserer DNA. Aufgenommen wurde sie im Mai 1952 von Rosalind Franklin und ihrem Doktoranden Raymond Gosling. Franklin forschte damals als Biochemikerin an der MRC Biophysics Unit des King’s College in London, in der DNA-Forschungsgruppe, die von John Randall, dem späteren Sir John Randall, geleitet wurde.
Es handelt sich dabei um eine Röntgenkristallographie, ein Verfahren, das weit über hundert Jahre alt ist. Vereinfacht gesagt wird dabei ein Molekül, das sich in einem Kristall oder in einer anderen geordneten Form befindet, von Röntgenstrahlen beschossen. Diese Strahlen prallen an Elektronen in den Atomen des Moleküls ab und streuen in einem einzigartigen, charakteristischen Muster. Aus diesem Muster, wie hier auf «Photo 51», lässt sich dann die Struktur des Moleküls ablesen. Die Zahl 51 steht in diesem Fall für den 51. Versuch, am Thymus eines Kalbes die DNA-Struktur sichtbar zu machen.
Diese Fotografie war für die spätere Entdeckung der DNA-Doppelhelix-Struktur durch James Watson und Francis Crick von fundamentaler Bedeutung. Watson selbst schrieb: «In dem Augenblick, als ich das Bild sah, klappte mir der Unterkiefer herunter, und mein Puls flatterte. Das Schema war unvergleichlich viel einfacher als alle, die man bis dahin erhalten hatte.»
Doch der Weg der Information zu ihm war fragwürdig. Ohne Wissen von Rosalind Franklin hatte der Doktorand Gosling das Foto zusammen mit Forschungsberichten zuerst dem Forscher Maurice Wilkins und über ihn dann auch James Watson weitergereicht. Was zu guter Letzt dazu führen sollte, dass den drei Forschern Watson, Crick und Wilkins 1962 für die Entdeckung der Doppelhelix der Nobelpreis für Medizin zugesprochen wurde. Rosalind Franklin hingegen war vier Jahre zuvor gestorben und wurde deshalb gar nicht erst nominiert.
Es handelt sich also um eine der bekannten, üblichen Geschichten aus dem Wissenschaftsbetrieb, denkt man sofort. Die Rolle der Frau in Forschungsprojekten war ja bis in die jüngere Vergangenheit oft ein ethischer Schandfleck im Wissenschaftsbetrieb, insbesondere in den Naturwissenschaften. Im konkreten Fall könnte man immerhin geltend machen, dass wir aufgrund der Regel, nur lebende Personen mit dem Nobelpreis auszuzeichnen, nicht wissen, ob Rosalind Franklin allenfalls mitnominiert worden wäre, wenn sie noch gelebt hätte. Jedenfalls hatte es bitteren Streit gegeben zwischen den Wissenschaftlern über diese unautorisierte Datenübergabe. Franklin wechselte deshalb 1953 zum Birkbeck College. Am King’s College liess man sie gehen, aber nur unter der Bedingung, dass sie nicht mehr an der DNA forsche.
Ein ähnliches Beispiel ist die Botanikerin Anna Atkins, ebenfalls eine Britin: Sie war die erste Person, die ein Fotobuch erstellt hat. 1843 veröffentlichte sie unter dem Titel «British Algae: Cyanotype Impressions» zauberhafte Kontaktkopien von Pflanzen auf Blaupausen, auf sogenannten Cyanotypien. In der Folge publizierte sie bis 1853 zwölf weitere Bücher mit insgesamt 389 Cyanotypien, die allesamt auffallend feingliedrig aufgebaut sind und entsprechend poetisch anmuten. Ihre eigentliche Leistung beruhte aber darin, dass sie als Allererste die Fotografie für eine wissenschaftliche Datenerhebung eingesetzt hat. Leider fiel dieses Werk danach für lange Zeit in Vergessenheit und wurde erst in den letzten Dekaden wiederentdeckt und aufgearbeitet.
Durch die Pionierarbeit von Atkins und dann über mehr als 150 Jahre erfüllte Fotografie nicht nur die Funktion der realitätsnahen oder schönen Wiedergabe der Welt, sondern auch der anschaulichen Datenerhebung zu wissenschaftlichen Zwecken. Sie wurde «künstliche Retina», «wahre Retina des Gelehrten», wie es damals hiess. Von Beginn an war die Fotografie – selbst ein Erzeugnis der Wissenschaft und der Technik – eine Apparatur des Fortschritts, welche die wissenschaftliche Wahrnehmung der Welt veränderte. Kaum wurde sie handlicher, schneller, präziser, diente sie als wichtiges Forschungs- und Visualisierungsinstrument, um Abfolgen, Verläufe, Abweichungen festzuhalten; um entweder tief in den Mikrokosmos einzutauchen oder um weit in den Makrokosmos auszuschwingen.
Die Fotografie half der Wissenschaft aber auch immer wieder, ihre Forschungsresultate für die Geldgeber, die Politiker und für uns alle verständlich zu machen. Berenice Abbot, die berühmte amerikanische Fotografin, notierte, als sie sich in den 1950er-Jahren mit der Wissenschaftsfotografie zu beschäftigen begann: «I believe that photography can be this spokesman, as no other form of expression can be (…) there is an essential unity between photography, science’s child, and science, the parent.» («Ich glaube, dass die Fotografie wie keine andere Ausdrucksform diese Vertreterin sein kann (…) Es gibt eine grundlegende Einheit zwischen der Fotografie – einem Kind der Wissenschaft – und der Wissenschaft – ihrem Elternteil.»)
Im Kontext des Frauenstreiks in der Schweiz kann man aber auch von spannenden und erfolgreichen Projekten der wissenschaftlichen Fotografie berichten. Neben Berenice Abbotts Bemühungen, Physik für den Schulunterricht besser zu visualisieren, wären etwa die Pflanzenstillleben von Sanna Kannisto zu nennen, die sie, mitten im Dschungel – neben den forschenden Biologen – in einem selbst gebauten Theaterraum mit Farbigkeit und Eleganz inszeniert und mit denen sie so den Objektivitätsanspruch von Wissenschaftsfotografie spielerisch unterläuft.
Oder Catherine Wagners visuelles Inventar von wissenschaftlichen Maschinen, Geräten, Gefässen, von Reagenzgläsern, die in Reih und Glied stehen, von Messgeräten, vom Besteck, mit dem in den Untersuchungsreihen hantiert wird. Sie beschäftigt sich darin gleichsam mit der Maschinerie des wissenschaftlichen Forschens. Oder die Amerikanerin Nancy Burson, die in den frühen Siebzigerjahren mit dem MIT (Massachusetts Institute of Technology) zusammenarbeitete, um mit ersten digital hergestellten Versionen ihrer composites, Überblendungen von Porträtaufnahmen, das Altern von Gesichtern zu simulieren.
Im schweizerischen Kontext überzeugen zurzeit zwei Romands mit ihren Arbeiten in diesem Bereich: Catherine Leutenegger, die zurzeit mit einer attraktiven, grossen Serie von erleuchteten Farbbildern die verschiedenen hoch abstrakten Forschungen an der EPFL in Lausanne für uns zu veranschaulichen versucht (unter dem Titel «Infinity Room I» an der ETH in Lausanne bis zum 28. Juli zu sehen), und Matthieu Gafsou (ein Quotenmann darf sein), der unter dem Titel «H+» dem «Transhumanen» nachgeht, also der wissenschaftlichen Erforschung des verstärkten, unterstützten, veränderten Körpers und der zunehmenden Verschränkung von Körper und Maschine.
Die Rolle der Fotografie in der Wissenschaft hat sich über fast zwei Jahrhunderte stark verändert. Für die Veranschaulichung ist sie noch immer meist das Endprodukt, für den eigentlichen Prozess des Forschens hingegen haben Film- und Videoaufnahmen sowie Nebelkammern, Elektronenmikroskope, Teilchenbeschleuniger, Sequenzierautomaten oder sonstige Instrumente die Rolle von blossen Leittechniken des Forschens übernommen. Diese Veränderung, schreibt Christoph Hoffmann, Professor für Wissenschaftsforschung an der Universität Luzern, habe mit einer grundlegenden epistemologischen Verschiebung im 20. Jahrhundert zu tun: «In Natur-, Human- und Sozialwissenschaften gilt heute fast unumschränkt die Zahl als Erkenntnisbasis, und eine Sache zu verstehen, verlangt danach, sie mathematisch zu durchdringen oder wenigstens zu quantifizieren. Bildgebende Verfahren sind in diesem Sinne zweitrangige Forschungsmittel. Man benutzt sie, um Rohdaten zu gewinnen, strebt dabei aber schon etwas anderes an.»
Viele der hier aufgeführten Beispiele (und weit mehr) sind im eben erschienenen, reichhaltigen Buch von Marvin Heiferman enthalten: «Seeing Science. How Photography Reveals the Universe». UMBC Aperture, 2019.