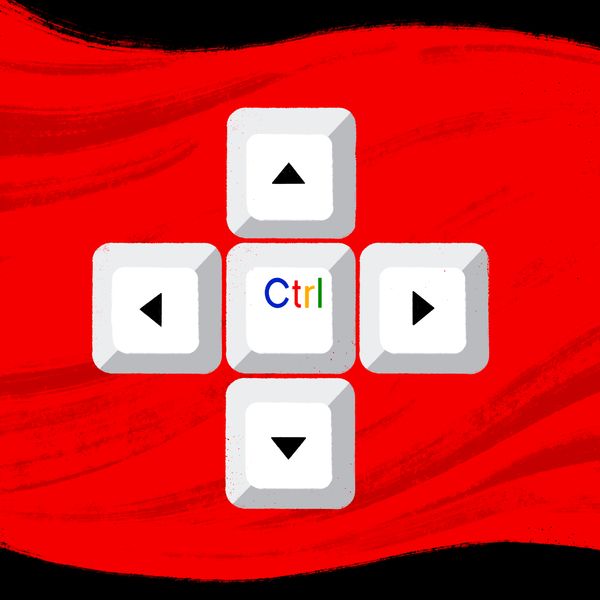Die Entzauberung von Google
«Am Ende dieser Revolution sind die Reichen weiter reich und die Mächtigen weiter mächtig»: Stanford-Professor Adrian Daub über den Mythos Big Tech und was davon übrig bleibt. «Do not feed the Google», Folge 3.
Von Daniel Ryser, Ramona Sprenger (Text), Adrià Fruitós (Illustration) und Mark Davis (Bild), 18.01.2023
Don’t be evil.
Im April 2022 besuchten wir einen Informationsanlass der Stadt Zürich im Google-Gebäude an der Zürcher Europaallee. Titel der Veranstaltung: «Silicon Limmattal? Der Tech-Sektor und seine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Stadt Zürich».
Anna Schindler, die Direktorin der Zürcher Stadtentwicklung, und Google-Schweiz-Direktor Patrick Warnking sprachen in einem grossen Auditorium über die Vorzüge von Google und der Schweiz. Moderiert wurde der Anlass von SRF-Wissenschaftsjournalistin Kathrin Hönegger. Obwohl der Europäische Gerichtshof einige Monate zuvor eine 2,4-Milliarden-Euro-Strafe gegen den Google-Konzern bestätigt hatte und die Bestätigung der 4,1-Milliarden-Euro-Rekordstrafe wegen illegaler Praktiken von Google bei seinen Android-Smartphones bevorstand, hatte die SRF-Journalistin keine kritischen Fragen vorbereitet. Der Anlass war eine glatt polierte gemeinsame PR-Veranstaltung der Stadt Zürich und von Google.
Schindler, Warnking, Hönegger und noch ein paar andere Teilnehmende sprachen über Velowege, von denen es in Zürich doch noch ganz viel mehr brauche. Der Google-Chef lobte das grossartige öffentliche Verkehrs- und Bildungssystem, die schönen Berge, die kurzen Wege. Das alles seien Gründe, weswegen Google-Mitarbeitende gerne in die Schweiz kämen und schliesslich blieben, sagte Warnking. Anna Schindler wischte Bedenken aus dem Publikum beiseite, die Standort-Marketing-Strategie mache das Leben in der Stadt bald unerschwinglich. Danach gab es vegane Cookies für alle.
Das hier musste das Paradies sein: ein Ort, wo es keine Probleme gab. Vielleicht war es aber auch die Hölle. Ein Ort nämlich, wo man ganz genau weiss, welchen Anstrich man sich geben muss, um über gewisse Dinge nicht zu reden.
Serie «Do not feed the Google»
Der diskrete Überwachungsgigant: Wir zeichnen nach, wie der Google-Konzern zur Bedrohung für die Demokratie wurde – und die Schweiz zu seinem wichtigsten Standort ausserhalb des Silicon Valley. Gespräche mit Internet-Expertinnen aus den USA, den Niederlanden, Deutschland und Kanada. Zur Übersicht.
Folge 2
Vom ungehinderten Aufstieg zum Monopol
Sie lesen: Folge 3
Die Entzauberung von Google
Folge 4
Wenn ethische Werte nur ein Feigenblatt sind
Folge 5
Half Google, einen Schweizer auszuspionieren?
Folge 6
Auf dem Roboterpferd in die Schlacht
Folge 7
Gewinne maximieren, bis sie weg sind
Folge 8
Google und die Schweiz – eine Liebesgeschichte
Folge 9
Google im rot-grünen Steuerparadies
Folge 10
Inside Google Schweiz
Bonus-Folge
Podcast: Warum sind alle so verschwiegen?
Um die Veranstaltung zu verstehen – die nicht angesprochenen Milliardensanktionen, die euphorisch verklausulierte Sprache, die veganen Cookies –, riefen wir Adrian Daub an, Literaturwissenschaftler in Stanford, an einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Südöstlich von San Francisco gelegen, gilt Stanford wegen seiner Forschung als eigentliche Begründerin des Wirtschaftsstandorts Silicon Valley mit all seinen Unternehmen in der IT- und Hightech-Industrie.
Adrian Daub hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Was das Valley denken nennt». Darin befasst sich der 42-Jährige mit der Ideologie des Silicon Valley, aber auch mit den Slogans und Begriffen der Big-Tech-Konzerne. Er kommt darin zum Schluss, dass das Silicon Valley «einen Hang dazu hat, revolutionär zu sein, ohne irgendwas zu revolutionieren».
«Und wir sind die Nashörner»
Viele bedienten sich heute des Begriffs Silicon Valley, sagt der Literaturwissenschaftler. Wenn die Stadt Zürich zu einem Anlass mit dem Titel «Silicon Limmattal» lade, sei das nur ein Slogan von vielen. Das sei für ihn als jemand, der im Silicon Valley lebe und sich schon lange mit dem Mythos beschäftige, ein Stück weit seltsam, weil dabei ganz selektiv auf die Region Bezug genommen werde.
«Man versteht das, was man kopieren möchte, gar nicht», sagt Daub. Silicon Valley könne theoretisch alles Mögliche sein: «Hochtechnologie. Funding structures. Venture capital. Risiko-Investoren. Vernetzung mit Universitäten. Meint man das? Oder geht es um diesen Silicon-Valley-Spirit, die Ideologie? Dass das, was das Valley gross gemacht habe, dieser radikalliberale, deregulatorische Fimmel ist? Und das muss jetzt auch in die Schweiz kommen?»
Das seien schliesslich alles Meinungen, die man haben könne. «Ich finde es aber einfach unglaublich unpräzise», sagt Daub. «In Nordkalifornien sind viele ganz spezifische Sachen zusammengekommen, um diese Gemengelage zu schaffen. Der europäische Blick und diese metaphorische Anlehnung an das Silicon Valley machen sich selten die Mühe, zu sagen, was man denn jetzt genau importieren oder reproduzieren möchte.»
Im Silicon Valley gebe es ja auch ganz andere Unternehmen. Unternehmen mit fünfzig oder achtzig Mitarbeiterinnen, die interessante Dinge sehr gut machten, ordentlich verdienten, aber eben keine Milliarden. «Da ist die Denke auch eine ganz andere», sagt der Stanford-Professor. «Aber diese Unternehmen werden in Europa wenig wahrgenommen und kaum kopiert. Wenn man sagt, wir wollen das Silicon Valley kopieren, denken vermutlich alle an den Besuch bei Google, als sie mal in Mountain View waren.»
Wenn mit Silicon Valley also die grossen sogenannten «Unicorns» gemeint seien, «die riesigen Unternehmen mit irrsinnigen Bewertungen», die als Global Player überall mitspielten, Facebook, Tesla und so weiter: «Mit dieser Sicht geht eine ganz bestimmte Ideologie einher, eine ganz bestimmte Denke und eine ganz bestimmte Art, soziale Schichtung hinzunehmen. Diese Unternehmen haben ganz viele Menschen sehr reich gemacht und hundertmal mehr Menschen sehr, sehr arm.»
Europäische Wirtschaftsleute, europäische Politikerinnen würden reihenweise hierhinfahren, sagt Daub. «Ich bin schon vielen Politikern in Stanford einfach so über den Weg gelaufen. Die wollten sich den Campus anschauen. Da gibt es aber gar nichts zu sehen. Da sind ein paar Palmen, hübsch, aber nicht interessant. Aber sie wollten das sehen. In Deutschland nennen sie das offenbar Safaris. Und wir sind die Nashörner.»
Eine Revolution, finanziert von Milliardären
Wenn man von einer Ideologie des Silicon Valley spreche, sei damit Folgendes gemeint: «Eine radikalliberale Staatsskepsis, kombiniert mit einer Kulturpolitik der Hippies. Die Vorstellung, dass Gemeinschaft und Selbsterfüllung sehr wichtig sind, aber im Rahmen eines knallharten kapitalistischen We-first-Systems.»
Ein zentraler Begriff des Silicon Valley sei dabei jener der Disruption. Das Durcheinanderwirbeln von etablierten Strukturen. «Viele dieser Technologien sind angetreten und haben implizit gesagt, wir entmachten das, was man hier Gatekeeper nennt», sagt Daub. «Man kann sich jetzt seine eigene front page, seine eigene Seite 1, zusammenbasteln, ohne dass eine böse Redaktion da reinfuhrwerkt. Man kann sich seine Informationen selber suchen, ohne dass öffentlich-rechtliche Stellen dazwischenfunken. Man kann jetzt selber Taxifahrer werden, ohne sich regulieren lassen zu müssen. Es geht um Empowerment.»
Somit würden tatsächlich alte Hierarchien auf den Kopf gestellt und alte Machtzentren ein Stück weit entmachtet. Und das sei tatsächlich in gewissem Sinne revolutionär. «Am Schluss aber sind bei dieser Revolution die Reichen nicht die Taxifahrer oder die Autorinnen bei den Zeitungen», sagt Daub. «Am Ende dieser Revolution sind die Reichen weiter reich und die Mächtigen weiter mächtig. Das meine ich dann auch damit, wenn ich zum Schluss komme, dass das Silicon Valley einen Hang dazu hat, revolutionär zu sein, ohne irgendwas zu revolutionieren. Denn nach der ganzen Disruption ist die Hierarchie genauso aufgestellt wie davor.»
Am Ende hätten weiterhin weisse Männer in jenem Alter, in dem weisse Männer normalerweise viel Macht hätten, ebenjene Macht. Es werde versprochen, dass viel durcheinandergewirbelt werde. Und das stimme auch. «Aber wenn der Staub sich mal gelegt hat, ist es auffällig, dass jene, die vorher obenauf waren, weiterhin obenauf sind.»
«Wir wissen, welche Art Revolution von Milliardären finanziert wird, nur verbinden wir diese Umbrüche normalerweise mit dem Namen Pinochet und nicht mit dem Namen Trotzki», sagt der Stanford-Professor. «Darauf läuft die Sache mit der Disruption raus. Es ist nicht überraschend, dass viele dieser Silicon-Valley-Granden sich im Endeffekt zu einer neofeudalen und natürlich rechten Politik bekannt haben. Einfach weil sie eben die Art Revolution gut finden, bei der Menschen wie sie normalerweise nicht um ihre Pfründen fürchten müssen.»
«Zoogler? Das musste ich ganz kurz verdauen»
Wenn wir an Google und Zürich dächten, erzählen wir dem Mann aus Stanford, kämen uns zuerst einmal Rutschbahnen aus Plastik in den Sinn. Denn das sei schliesslich das, worüber in den lokalen Medien nach dem Tag der offenen Tür bei Google berichtet werde: dass es da eine Rutschbahn für die neuen Angestellten gebe, um ins Google-Team hinabzuschlittern. Dass es Billard- und Pingpongtische gebe. Und einen Töggelikasten. Und das Büro heisst nicht Büro, sondern Campus, und die Zürcher Mitarbeitenden von Google nennen sich «Zoogler».
Jetzt wird es einen Moment lang ganz still am anderen Ende der Zoom-Leitung.
«Herr Daub, sind Sie noch da?» – «Ja, ja, ich bin noch da. Aber was sagten Sie? Zoogler? Das musste ich ganz kurz verdauen.»
Diese ganzen Dinge, die Rutschbahn, der «Campus» – das sei letztlich alles Teil eines eigenen Bonussystems, das der amerikanischen Uni nachempfunden sei: «Macht Yoga am Arbeitsplatz. Gebt uns eure Wäsche. Wir kochen für euch.»
«Wenn es den Arbeitgeber dazu befähigt, dich drei Stunden länger am Arbeitsplatz zu halten, rechnet sich das im Endeffekt dann halt doch. Eine Wäschekraft anzustellen, kostet ja nicht so viel. Die kriegt ja auch keine Google-Aktien», sagt der Mann aus Stanford. «Wir sind hier kein Unternehmen, wir sind eine Familie, wir sind auf einer Mission, wir sind hier, um die Welt zu verändern: Diese Ideologie kommt auch aus der Hippiezeit.»
Im Grunde genommen befähige diese Ideologie den Arbeitgeber, unvernünftig viel von seiner Belegschaft zu fordern. «Familie ist die Art von Arbeit, von der ich nicht sagen kann: So, jetzt ist aber Schluss, jetzt ist Feierabend, jetzt geh ich nach Hause. Das sind subtile Formen der Ausbeutung», sagt Daub.
Er habe aber auch das Gefühl, dass diese Ideologie für die USA entworfen worden sei und in der Schweiz nicht verfange. «Bei einem 26-jährigen Programmierer im Silicon Valley, der direkt von der Uni kommt, funktioniert so was perfekt. Er ist die absolut perfekte Zielgruppe. Bei einer 36-Jährigen, die gerade ihren Doktortitel an der Uni Zürich gemacht hat, an der ETH? Irgendwann ist man doch zu alt für solch einen Scheiss.»
Nichts Böses tun, sich vegan ernähren, ewig leben
Wir kommen mit Daub auf Patrick Warnking zu sprechen, der bis Ende 2022 Länderchef von Google Schweiz war. Ein Mann, dem es wichtig sei, von Diversität zu sprechen. Aber wie passten diese Worte zum eigenen Google-Diversity-Report 2022, der beispielsweise die Zahl von schwarzen Frauen in Führungspositionen in den USA auf 2 Prozent beziffert, die von weissen Männern auf 43,7 Prozent und von Männern generell auf rund 70 Prozent? Oder zu den Erfahrungen von Timnit Gebru, der Ende 2020 fristlos gefeuerten Ex-Co-Leiterin der Abteilung für Ethik in der künstlichen Intelligenz? Wie passte es zusammen, dass die Afroamerikanerin Gebru keine Geschichte von Diversität und Inklusivität erzählte, sondern eine Geschichte des Rassismus und Sexismus?
«Wie weit es diese Unternehmen mit der Inklusivität ernst meinen: Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das sind weiss dominierte Unternehmen, männlich dominierte Unternehmen», sagt Daub.
Diese Unternehmen seien zudem stark dabei, Arbeit zu hierarchisieren. Viele Leute, die auf einem Google-Campus arbeiteten, seien gar nicht wirklich bei Google angestellt. «Die arbeiten für irgendwelche Zweitunternehmen oder Subunternehmen», sagt der Literaturwissenschaftler. «Wer zur Belegschaft zählt, ist äusserst eng umrissen. Und das ist eindeutig so, dazu gibt es auch Untersuchungen: Natürlich sind das relativ diverse Unternehmen, aber sie werden umso diverser, je weniger Geld fliesst. Und je diverser sie werden, desto weniger hat das Unternehmen selber noch die Hand im Spiel. Je mehr man in das Kerngeschäft kommt, desto weisser, desto männlicher wird es.»
Und schliesslich und endlich landen wir bei den veganen Cookies, die verteilt wurden, an dem Abend im Zürcher Google-Gebäude, dem gemeinsamen Panel von Google und der Stadt Zürich, an dem keine einzige kritische Frage gestellt wurde, an dem uns vorgemacht wurde, dass es hier weit und breit kein einziges Problem gebe.
«Self-care ist ein grosser Teil dieser Silicon-Valley-Ideologie», sagt Adrian Daub. «Self-care war mal ein Begriff unter afroamerikanischen Feministinnen und war eigentlich darauf aus, die Verwerfungen des Kapitalismus ein Stück weit abzufedern. Was es mittlerweile bedeutet in Silicon Valley, ist ja eigentlich eher, dass ganz reiche Menschen ihr Leben noch mal zehn Jahre verlängern wollen. Mit Eigenblut-Doping wie bei Peter Thiel oder durch irgendwelche komische Heilpraktiken. Und da gehören die veganen Google-Cookies ehrlich gesagt hin.»
Das ehemalige und langjährige Mantra von Google, sagt Adrian Daub schliesslich, das sei ja schon sehr interessant: «Don’t be evil» – «Tu nichts Böses». «Don’t be evil ist ein negativer Imperativ. Als Literaturwissenschaftler frage ich mich: Auf wen bezieht sich das denn? Ist es eine Erinnerung an das Unternehmen? Bedeutet es, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich melden soll, wenn das Unternehmen etwas falsch macht? Ist es eine basisdemokratische Geste? Wenn es wirklich eine Selbstermahnung ist, wer kontrolliert das dann?»
Google lasse sich schliesslich ungern von der Regierung kontrollieren. Oder von der Presse. Das wären mögliche Instanzen. Kräfte aber, denen Google sich entweder verwehre oder sie zerstöre. «Die Presse hat unter Google gelitten wie sonst unter kaum einem anderen Unternehmen», sagt Daub. «Google News ist in den USA ein extrem harter Schlag für die Branche gewesen. Der Lokaljournalismus ist hier kaputt deswegen.»
«Google operiert mit Begriffen, von denen das Unternehmen meint, ganz genau zu wissen, was sie bedeuten, aber die es eigentlich nie definiert», sagt der Literaturwissenschaftler. «Man sagt: Sei nicht böse. Tu nichts Böses. Aber meine Güte: Die letzten 25 Jahrhunderte westlicher Philosophie haben versucht, sich zu überlegen: Wo kommt das her? Was ist das Böse? Wie können wir sicherstellen, dass wir es nicht tun? Hier wird das einfach mal so vorausgesetzt. Da ist eine unglaubliche Kavaliersmentalität dabei, dass man sagt: Das kriegen wir schon hin. Wir von Google wissen schon, was richtig und was falsch ist.»
Zur Serie «Do not feed the Google» und zur Co-Autorin
Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik, dem Dezentrum und dem WAV. Das Dezentrum ist ein Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Das WAV ist ein unabhängiges Recherchekollektiv aus Zürich.
Ramona Sprenger ist Interaction Designerin aus Zürich. Als Partnerin beim Think & Do Tank Dezentrum engagiert sie sich für eine nachhaltige Digitalisierung, bei der die Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Aktuell arbeitet sie für TA-Swiss an einer Publikation zu Blockchain und Kultur und baut mit Climate Ticker eine Plattform für offene, lokale Klimadaten und lokalpolitische Massnahmen auf.
Der Europäische Gerichtshof hat die 2,4-Milliarden-Euro-Strafe gegen den Google-Konzern im November 2021 nicht verhängt, sondern nur bestätigt. Wir haben die Stelle in diesem Sinn präzisiert und danken für den Hinweis.