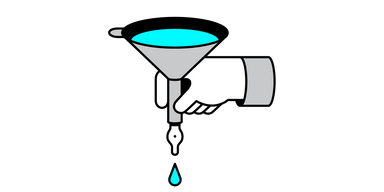
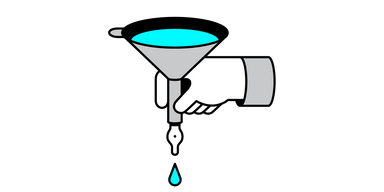
Attentat schockiert Japan, die Ukraine schiesst zurück – und Uber kommt nicht aus den Schlagzeilen raus
Woche 28/2022 – das Nachrichtenbriefing aus der Republik-Redaktion.
Von Philipp Albrecht, Ronja Beck, Cornelia Eisenach, Oliver Fuchs, Bettina Hamilton-Irvine und Theresa Hein, 15.07.2022
Keine Lust auf «Breaking News» im Minutentakt? Jeden Freitag trennen wir für Sie das Wichtige vom Nichtigen.
Jetzt 21 Tage kostenlos Probe lesen:
Ukraine: Russen beschiessen zivile Gebäude im Osten
Das Kriegsgeschehen: Die russischen Streitkräfte fahren ihre Angriffswelle im Osten des Landes fort. Nach der Einnahme der Region Luhansk werden die Kämpfe zunehmend in die Nachbarregion Donezk verlagert. Dabei werden nach Aussage des ukrainischen Generalstabs immer wieder zivile Ziele beschossen.
In der Kleinstadt Tschassiw Jar traf eine Rakete ein vierstöckiges Wohnhaus, mindestens 45 Menschen kamen ums Leben. Die russische Armee bestreitet den Angriff. Auch auf die Grossstadt Kramatorsk gab es einen tödlichen Raketenangriff. In der südukrainischen Grossstadt Mykolajiw wurden bei Angriffen Wohnhäuser und ein Spital beschädigt, mindestens 5 Menschen starben. Ebenfalls im Süden des Landes haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive gestartet. Sie wollen den von den Russen besetzten Raum Cherson zurückerobern.
Seit Beginn des Angriffskrieges hat die Uno 5000 getötete und mehr als 6500 verletzte Zivilistinnen erfasst. Sie geht aber von einer deutlich höheren Opferzahl aus.
Die innenpolitischen Entwicklungen in Russland: Zum ersten Mal seit Einführung eines umstrittenen neuen Gesetzes wurde eine Haftstrafe ausgesprochen, weil jemand den Krieg beim Namen genannt hat. Weil Alexei Gorinow, Gemeinderatsmitglied eines Moskauer Stadtteils, bei einer Sitzung über den Tod ukrainischer Kinder im Krieg gesprochen hatte, muss er für sieben Jahre ins Gefängnis. Seine Aussage war gefilmt und auf Social Media verbreitet worden. Bei der Urteilsverkündung hielt der 60-Jährige einen Zettel mit den Worten «Brauchen Sie diesen Krieg noch?» in die Höhe. Wer in Russland den «Militäreinsatz» in der Ukraine als Krieg bezeichnet, muss mit bis zu 15 Jahren Haft rechnen.
Derweil bietet Wladimir Putin allen Ukrainern per Schnellverfahren den russischen Pass an. Bisher war die Einbürgerung nur in vereinzelten Regionen möglich – in den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk bereits seit 2019. Damit will Putin unter anderem weitere militärische Angriffe mit dem vermeintlichen Schutz russischer Staatsangehöriger rechtfertigen. Die EU hat angekündigt, solche Papiere nicht anzuerkennen.
Die internationalen Entwicklungen: Am G-20-Aussenministertreffen auf Bali kam es zu einem Eklat. Weil Vertreterinnen westlicher Staaten «den brutalen Angriffskrieg Russlands» als grösste aktuelle Gefahr bezeichneten und bilaterale Gespräche mit dem russischen Aussenminister Sergei Lawrow ablehnten, verliess dieser nach seiner Rede den Saal.
Für die Verhandlungen in der Türkei über die von Russland blockierten Getreidelieferungen aus der Ukraine zeichnet sich ein positiver Ausgang ab. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sieht gute Chancen, dass die Ware bald freigegeben wird. Uno-Generalsekretär António Guterres sprach von einem «entscheidenden Schritt» in Richtung einer Lösung, ohne konkreter zu werden. Auch eine russische Delegation ist an den Gesprächen beteiligt.
Japan: Prägendster Politiker der Nachkriegszeit ermordet
Darum geht es: Bei einer Wahlkampfrede in der Stadt Nara am Freitag wurde der frühere japanische Premierminister Shinzo Abe getötet. Der mutmassliche Attentäter schoss mit einer selbst gebauten Waffe zweimal auf den 67-jährigen Politiker. Sicherheitskräfte überwältigten den Schützen sofort. Ein Helikopter flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo ihn die Ärztinnen kurz darauf für tot erklärten.
Warum das wichtig ist: Abe war der am längsten amtierende Regierungschef Japans und damit einer der prominentesten Politiker des Landes. 2006 wurde der Vorsitzende der seit 1955 fast durchwegs regierenden Liberaldemokratischen Partei LDP erstmals zum Premierminister gewählt. Nach seinem Rücktritt 2007 aus angeblich gesundheitlichen Gründen kehrte er 2012 ins Amt zurück – und blieb für eine Rekordzeit von knapp acht Jahren. Ab 2013 prägte er das Land besonders durch seine tiefgreifenden Wirtschaftsreformen. Der nationalistische Premier versuchte zudem während Jahren erfolglos, die pazifistische Verfassung Japans aufzubrechen. Was den Attentäter antrieb, ist noch nicht vollständig geklärt. Gemäss seinen Aussagen bei der Polizei soll er einen Groll gegen den Politiker gehegt haben aufgrund dessen Verbindungen zur Vereinigungskirche, einer international agierenden Sekte, die weltweit Machthaber als Rednerinnen engagiert.
Was als Nächstes geschieht: Zwei Tage nach Abes Ermordung hat die konservative LDP mit weiteren rechten Kräften die japanischen Oberhauswahlen mit Abstand gewonnen. Mit den neuen Mehrheiten in beiden Kammern könnte Verfassungsartikel 9, der Japan unter anderem verbietet, Krieg zu führen, demnächst Geschichte sein. Damit ginge ein lang gehegter Wunsch Abes in Erfüllung. Doch ohne Abe als Vorsitzenden der grössten Fraktion und wichtigen Strippenzieher in der Partei könnte Premier Fumio Kishida an Rückhalt verlieren.
Alles, immer, überall: Erste Bilder vom James-Webb-Teleskop
Darum geht es: Das James-Webb-Weltraumteleskop lieferte seine ersten Bilder aus dem All und damit einen tiefen Blick in die Vergangenheit des Universums. Die Nasa veröffentlichte insgesamt fünf Aufnahmen, darunter eine des Galaxienhaufens SMACS 0723 mit einer der frühesten Galaxien des Universums überhaupt: Ihr Licht brauchte mehr als 13 Milliarden Jahre, um auf der Erde anzukommen. Das rund 10 Milliarden Dollar teure Teleskop war im Dezember 2021 nach 25 Jahren Entwicklung ins Weltall geschossen worden.
Warum das wichtig ist: Bisher stützte sich die Erforschung des Universums auf das Hubble-Weltraumteleskop, das Bilder im sichtbaren Bereich des Lichtes macht. Weil das James-Webb-Teleskop im Gegensatz dazu infrarotes Licht sieht, also Wärmestrahlung, kann es viel weiter in die Vergangenheit blicken: Stellt man sich das Universum als 50-jährigen Menschen vor, so zeigt Hubble das Kindergartenalter und James Webb die Krabbelgruppe. Ausserdem durchdringt es Staub- und Gasschwaden und kann dadurch bei der Geburt von Sternen zuschauen, so wie sie etwa im Innern des Carina-Nebels geschieht. Dieser Nebel ist mit bisher unbekannten Sternen und Galaxien im Hintergrund ebenfalls auf einer der Aufnahmen zu sehen.
Was als Nächstes geschieht: Die Forschungsgemeinschaft hofft, tiefer in die Frühzeit des Universums zu blicken und mehr darüber zu lernen, wie Sterne entstehen. Ausserdem will sie Exoplaneten untersuchen, also Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems. Mit viel Glück findet sich einer, auf dem Leben möglich wäre. Die Daten des Weltraumteleskops lassen nämlich auch Rückschlüsse auf die Beschaffenheit von exoplanetaren Atmosphären zu. Erste Ergebnisse zum Exoplaneten WASP-96b wurden ebenfalls am Dienstag vorgestellt: Die Atmosphäre dieses Gasplaneten enthält demnach Wasser.
Sri Lanka: Demonstranten jagen Präsidenten ins Exil
Darum geht es: Monatelange Massenproteste in Sri Lanka nahmen am letzten Wochenende eine neue Dimension an, als Zehntausende von Menschen in Colombo gegen die Regierung demonstrierten. Einige hundert stürmten den Präsidentenpalast sowie die offizielle Residenz des Premierministers, wo sie Feuer legten. Präsident Gotabaya Rajapaksa kündigte daraufhin seinen Rücktritt an und ernannte Premierminister Ranil Wickremesinghe zum Übergangspräsidenten. Dieser erklärte den Ausnahmezustand im ganzen Land und verhängte eine Ausgangssperre. Er forderte zudem Armee und Polizei auf, «alles Notwendige zu tun, um die Ordnung wiederherzustellen». Rajapaksa und seine Frau haben sich mittlerweile auf die Malediven abgesetzt.
Warum das wichtig ist: Auslöser für die politische Krise ist die schlimmste Wirtschaftskrise in Sri Lanka seit Jahrzehnten. Die Rupie hat massiv an Wert verloren, der Staat ist bankrott. Es fehlt an Nahrung, Benzin und Medikamenten, Schulen und Ämter mussten schliessen. Die wütende Bevölkerung wirft dem geflohenen Präsidenten Rajapaksa Missmanagement vor und will ihn zur Verantwortung ziehen. Sie traut weder ihm noch Wickremesinghe und will einen Neuanfang. Rajapaksas korrupte Familie hat die Politik Sri Lankas in den letzten zwei Jahrzehnten dominiert, ihre Macht und den Einfluss auf die Justiz stetig ausgeweitet und sich selber dabei bereichert. Das Land wurde dabei immer mehr zu einem autoritären Regime.
Was als Nächstes geschieht: Auch nach der Flucht des verhassten Präsidenten demonstrieren die Menschen weiter. Sie fordern, dass auch der bisherige Premier Wickremesinghe zurücktritt. Ob es nun zu gewalttätigen Ausschreitungen komme, hänge von der Reaktion des Militärs ab, sagt die Journalistin Natalie Mayroth gegenüber SRF. Das Parlament soll am 20. Juli einen neuen Präsidenten wählen. Die Demonstranten wünschen sich eine Person, die nicht aus dem inneren Kreis der aktuellen Regierung kommt.
Uber: Whistleblower enthüllt soziopathische Firmenkultur
Darum geht es: Uber versuchte über Jahre, mit unethischen, schmutzigen und möglicherweise sogar illegalen Methoden rund um die Welt zum dominanten Taxiunternehmen zu werden. Das zeigen Dokumente, die ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter dem «Guardian» zur Verfügung gestellt hat. Der Konzern operierte etwa vielerorts ohne Zulassung, zahlte Akademiker für Gefälligkeitsstudien, kungelte mit Medienmanagern – und brachte Fahrerinnen bewusst in körperliche Gefahr. Uber betont, das sei alles mindestens Schnee von gestern, manche Vorwürfe seien falsch.
Warum das wichtig ist: Schon nur wegen des folgenden Satzes: «Violence guarantees success.» Sinngemäss, wenn Menschen verletzt werden, dann hilft das uns. Das antwortete Uber-Mitgründer Travis Kalanick auf die Sorge eines Angestellten, dass Proteste von Taxifahrern in Paris gegen Uber-Fahrerinnen in Gewalt münden könnten. Kalanick wurde 2017 als CEO weggeputscht.
Was als Nächstes geschieht: Diese Dokumente sind einerseits peinlich für Uber, das sich seit Kalanicks Abgang um ein freundlicheres Image bemüht. Andererseits aber auch für viele mächtige Politiker, Medienmanagerinnen, Forscher und Beamte, die sich (oft heimlich) in Ubers Dienst gestellt hatten. Darunter sind etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder die ehemalige EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes. Und aus den USA droht bereits neues Ungemach: Über 500 Frauen verklagen Uber wegen sexueller Übergriffe von Fahrern. Sie werfen dem Unternehmen vor, jahrelang nicht genug dagegen unternommen zu haben.
Zum Schluss: Pay up, Pal!
Der Preis für den schlechtesten Dealmaker der Woche geht an Elon Musk. Im Twitter-Übernahmeprozess muss der Mitbegründer von Paypal und Tesla irgendwann erkannt haben, dass er die vertraglich vereinbarten 44 Milliarden Dollar in Cash nicht zusammenbringt. Also begann er, den Preis zu drücken. Seine Taktik: Er verbreitete die Behauptung, es gebe mehr Fake-Profile auf Twitter, als das Unternehmen angegeben hatte. Nach monatelangem Seilziehen zog er sich letzte Woche aus dem Vertrag zurück und gab an, Twitter weigere sich, ihm die verlangten Daten vorzulegen. Der Börsenwert des Kaufobjekts ist in der Zwischenzeit auf 28 Milliarden geschrumpft. Nun verklagt ihn Twitter. Ein Gericht soll ihn doch noch zum Kauf zwingen. Die Chancen auf Erfolg stehen nicht schlecht, da Musk den Vertrag schon unterschrieben hat und offenbar keine Beweise für den Fake-Account-Vorwurf besitzt. Dumm gelaufen.
Was sonst noch wichtig war
Corona: Die Corona-Lage in der Schweiz verschlechtert sich zunehmend. Die Positivitätsrate bei den Antigen-Schnelltests – ein Indikator für unentdeckte Infektionen – ist auf fast 55 Prozent angestiegen, ein Rekordwert. Die offiziellen Fallzahlen, ebenfalls steigend, werden also von einer grossen Dunkelziffer begleitet. Auch im Abwasser nimmt die Viruslast stark zu.
Italien: Das Land steht vor einer Regierungskrise. Die Koalition konnte sich gestern nicht einigen, als es um Massnahmen gegen die Auswirkungen der Inflation ging. Einer notwendigen Vertrauensabstimmung im Senat blieben die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung fern. Regierungschef Mario Draghi kündigte daraufhin seinen Rücktritt an. Sollte es zu Neuwahlen kommen, müssten diese noch im Sommer oder Herbst stattfinden.
Schweiz: Die Schweiz hat im vergangenen halben Jahr Kriegsmaterial im Wert von fast 517 Millionen Franken exportiert, seit den Achtzigerjahren war dieser Wert nur im zweiten Halbjahr 2011 höher. Laut Bundesverwaltung handelt es sich vor allem um Flugabwehrgerät. Die drei wichtigsten Abnehmerländer waren Katar, Dänemark und Saudiarabien.
Deutschland: Seit Montag strömt kein russisches Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1. Zwar wird sie jeden Sommer gewartet, in diesem Jahr stehen die Chancen allerdings schlecht, dass der Gasfluss nach den üblichen 10 Tagen wieder aufgenommen wird. Russisches Gas deckt 35 Prozent des deutschen Energiebedarfs ab, entsprechend dramatisch wären die Folgen eines Stopps.
Grossbritannien: Am Mittwoch begannen unter den britischen Konservativen die Abstimmungen über die Nachfolge von Noch-Premierminister Boris Johnson. Unter den verbleibenden fünf Kandidaten ist auch der frühere Finanzminister Rishi Sunak, der bisher am meisten Stimmen erhielt. Am 5. September folgt die Stichwahl der letzten zwei Verbleibenden.
Südafrika: In der Nacht zum Sonntag starben in Südafrika 19 Menschen bei Schiessereien nahe den Städten Durban und Johannesburg. Das Land hat eine der höchsten Pro-Kopf-Mordraten weltweit, seit einigen Monaten nimmt die Zahl der Tötungsdelikte deutlich zu.
USA: Bei seinem ersten Besuch in Israel seit Amtsantritt hat US-Präsident Joe Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid die anhaltende Unterstützung der USA zugesichert. Ausserdem sprach sich Biden für eine 2-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und Palästina aus.
Eurozone: Erstmals seit seiner Einführung 2002 war der Euro am Dienstag nur noch so viel wert wie ein US-Dollar. Gründe dafür sind unter anderem die Rezessionsgefahr wegen des Russland-Ukraine-Krieges, die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und ein starker Dollar.
Japan: Ein Gericht in Tokio hat den Energiekonzern Tepco zu einer Entschädigung in Milliardenhöhe an Aktionäre verdonnert. 2019 war der Betreiber des Atomkraftwerks Fukushima, in dem es 2011 nach einem Tsunami zu drei Kernschmelzen kam, noch von einem Bezirksgericht freigesprochen worden.
Iran: Binnen einer Woche wurden im Iran drei Filmschaffende festgenommen, die jüngste Festnahme betraf am Montag den Cannes-Gewinner Jafar Panahi. Er hatte sich mit zwei festgenommenen Kollegen solidarisiert, denen vorgeworfen wird, die öffentliche Ordnung zu gefährden und mit Regimegegnern zusammenzuarbeiten.
Die Top-Storys
Modeln bis zum Personenschutz Lijana Kaggwa, einstmals Teilnehmerin der Castingshow «Germany’s Next Topmodel», spricht in einem Video von Manipulationen und wie die jungen Frauen zu vermeintlichen Hassfiguren gemacht wurden. Die Konsequenz für Kaggwa: massive Bedrohung, Personenschutz – und eine Klage. Das Urteil könnte deutsches Reality-TV massgeblich verändern, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt (Paywall).
Einfach nur radikal In Österreich gibt es einen 100-köpfigen Klimarat. Die zufällig aus allen Altersgruppen, Regionen und Teilen des Landes zusammengesetzte Gruppe zeigt mit ihren Vorschlägen und Forderungen, wie weit Menschen zu gehen bereit sind, wenn sie keine politischen, wirtschaftlichen, sozialen Abhängigkeiten haben. Ein wichtiger Hinweis für Politikerinnen (Paywall)?
Von langer Hand geplant Als vor zwei Wochen der Oberste Gerichtshof der USA das Urteil «Roe v. Wade» kippte und damit das Recht auf Abtreibung in die Hände der Bundesstaaten legte, kam das für viele Menschen weltweit als Schock. Überraschend ist dieser Entscheid aber nicht. Die Netflix-Dokumentation «Reversing Roe» (Paywall) zeichnete schon 2018 nach, wie Evangelikale in den USA jahrzehntelang auf den Kippentscheid hinarbeiteten und dank dem Opportunismus von mehreren US-Präsidenten ihr Ziel erreichten.
Illustration: Till Lauer