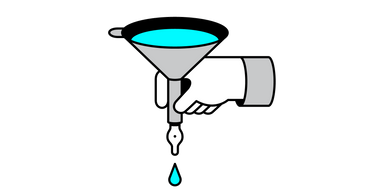
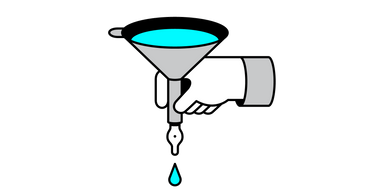
Russland schiesst Rakete auf Einkaufszentrum, USA schränken Recht auf Abtreibung ein und Novartis streicht 1400 Jobs in der Schweiz
Woche 26/2022 – das Nachrichtenbriefing aus der Republik-Redaktion.
Von Philipp Albrecht, Christian Andiel, Reto Aschwanden, Ronja Beck, Elia Blülle und Theresa Hein, 01.07.2022
Keine Lust auf «Breaking News» im Minutentakt? Jeden Freitag trennen wir für Sie das Wichtige vom Nichtigen.
Jetzt 21 Tage kostenlos Probe lesen:
Ukraine: Russland beschiesst Shoppingcenter, Belarus soll atomwaffenfähige Raketen erhalten
Das Kriegsgeschehen: Am Montag schlug eine russische Rakete in ein Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ein. Dabei wurden laut Angaben der ukrainischen Behörden mindestens 18 Menschen getötet und 60 schwer verletzt. Dutzende gelten noch als vermisst. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Angriff, nachdem es zunächst dementiert hatte. Kein Eingeständnis gab es von russischer Seite hinsichtlich eines gezielten Angriffs auf das zivile Ziel: Man habe auf Hallen mit Munition in der Nähe geschossen. Ein Überwachungsvideo von einem benachbarten Parkplatz scheint allerdings den Angriff auf das Gebäude zu belegen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sollen sich zum Zeitpunkt des Raketeneinschlags an die 1000 Zivilisten in dem Einkaufszentrum aufgehalten haben. Vor dem Uno-Sicherheitsrat forderte er in einer Ansprache den Ausschluss Russlands aus dem mächtigsten Uno-Gremium und sprach von «Terrorismus».
In der im Donbass liegenden Stadt Lyssytschansk kam es ebenfalls zu Luft- und Artillerieangriffen mit mehreren Toten. Lyssytschansk ist eine Nachbarstadt der jüngst von Russland eroberten Stadt Sjewjerodonezk. Es ist die letzte grosse Stadt der Region Luhansk, die sich noch nicht unter russischer Kontrolle befindet.
Am Donnerstag gab Russland bekannt, es ziehe seine Truppen von der Schlangeninsel ab. Mit dieser «Geste des guten Willens» wolle man Exporte von ukrainischem Weizen über das Schwarze Meer möglich machen. Die Ukraine hingegen behauptet, sie habe die russischen Truppen auf der strategisch wichtigen Insel südlich von Odessa erfolgreich angegriffen.
Zwischen Kiew und Moskau fand diese Woche der grösste Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn statt, 144 ukrainische Soldaten sollen laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium befreit worden sein. Russische Separatisten bestätigten den Austausch und die gleiche Zahl zurückgeholter Gefangener.
Moskau gab bekannt, in den nächsten Monaten atomwaffenfähige Raketen nach Belarus verlegen zu wollen. Die Raketen vom Typ Iskander-M könnten «sowohl ballistische Raketen als auch Marschflugkörper aufnehmen – sowohl in konventioneller als auch in nuklearer Ausführung». Das sagte Wladimir Putin der russischen Nachrichtenagentur Tass am Montag. Russischen Medien zufolge haben die Raketen eine Reichweite von 500 Kilometern.
Die Reaktionen: Angesichts der Raketen-Ankündigung äusserten sich die Staats- und Regierungschefs am G-7-Gipfel im bayerischen Elmau besorgt. Ausserdem verurteilte man dort einhellig den Anschlag auf das Einkaufszentrum in Krementschuk. Eine gemeinsame Erklärung nannte den Anschlag ein «Kriegsverbrechen». Am Mittwoch begann im spanischen Madrid der Nato-Gipfel, bei dem ein neues strategisches Konzept vorgestellt und Russland zur grössten Bedrohung im euroatlantischen Raum erklärt wurde (mehr zum Nato-Treffen im nächsten Absatz). Vor dem Gipfel erklärte US-Präsident Joe Biden im Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Truppenpräsenz der USA in Europa wegen des Krieges verstärken zu wollen.
Nato: Der Weg für historische Erweiterung ist frei
Darum geht es: Das wichtigste internationale Militärbündnis will sich nach Norden erweitern. Am Nato-Gipfel in Madrid diesen Mittwoch wurden Schweden und Finnland offiziell ins Bündnis eingeladen. In der Nacht zuvor hatte die Türkei nach Wochen des Widerstands ihr Veto zurückgezogen.
Warum das wichtig ist: Ein Beitritt zur Nato kam für einen Grossteil der Bevölkerung Schwedens und Finnlands, zweier traditionell neutraler Staaten, jahrzehntelang nicht infrage. Putins Überfall auf die Ukraine änderte dies schlagartig. Bereits im Mai hatten sich die Regierungen der beiden skandinavischen Staaten für den Beitritt entschieden. Wegen angeblicher Sicherheitsbedenken – es ging um «Terroristen» der Kurdischen Arbeiterpartei PKK in den beiden Ländern – blockierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan jedoch den weiteren Prozess. Nach einem stundenlangen Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson liess Erdoğan die Blockade diese Woche schliesslich fallen. Seine Zustimmung gab es jedoch nicht umsonst: Gemäss dem vereinbarten Memorandum sollen Auslieferungen von «Terrorverdächtigen» sowie Waffenlieferungen in die Türkei möglich sein. Zudem soll unter anderem die syrische Kurdenmiliz YPG keine Unterstützung durch die beiden Länder mehr erhalten.
Was als Nächstes geschieht: Bekannte Vertreterinnen der kurdischen Diaspora in Schweden werten die Zugeständnisse als Verrat und fürchten, in die Türkei abgeschoben zu werden. Im Memorandum betonen die neuen Nato-Kandidaten, sich an das europäische Auslieferungsübereinkommen halten zu wollen. Die Norderweiterung ist in den nächsten Monaten zu erwarten. Die bestehenden Mitgliedsstaaten müssen dem Beitritt zuerst noch geschlossen zustimmen – ein sehr wahrscheinliches Szenario.
G-7-Treffen: Solidarität mit der Ukraine und ein Gegenentwurf zu Chinas Seidenstrasse
Darum geht es: Von Sonntag bis Dienstag hat sich die G-7 im bayerischen Elmau getroffen. Die Staatschefs von Deutschland, der USA, Kanada, Grossbritannien, Frankreich, Italien und Japan bekräftigten dabei, sie würden der Ukraine «so lange wie nötig zu Seite stehen». Zudem prüfen sie, den Preis für russisches Öl zu deckeln – das soll verhindern, dass Russland von steigenden Preisen profitiert, und den Ölmarkt entspannen. Weiter versprachen die G-7-Staaten zusätzliche 4,5 Milliarden Dollar gegen die Hungerkrise. Zudem weichten sie die Glasgower Erklärung zur Bekämpfung der Klimakrise auf. Das heisst: Investitionen in fossile Energieprojekte sollen als Ausnahmen auch weiterhin möglich sein.
Warum das wichtig ist: Neben den Entscheiden zu akuten Themen fällte die G-7 auch einen Entscheid, der langfristig von grosser geopolitischer Bedeutung sein könnte. Bis 2027 will sie 600 Milliarden Dollar in Entwicklungs- und Schwellenländer investieren. Dieses gigantische Investitionsprogramm soll ein Gegengewicht bilden zur neuen Seidenstrasse, mit der China Milliarden investiert. Die G-7 will damit Chinas wachsenden Einfluss etwa in Afrika zurückdrängen. Der Westen wirbt um Verbündete, das zeigte auch die erstmalige Einladung von Schwellenländern an ein G-7-Treffen: Mit Senegal, Südafrika, Argentinien, Indien und Indonesien nahmen fünf Staaten teil, die insgesamt etwa ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachen und sich bisher hinsichtlich des russischen Kriegs gegen die Ukraine weniger deutlich positioniert haben als die EU und die USA.
Was als Nächstes geschieht: Konkret sind die Beschlüsse zur Ukraine. So soll das Land dieses Jahr bis zu 29,5 Milliarden Dollar an Finanzhilfen erhalten. Wann und wie die längerfristigen Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländer erfolgen, wird sich erst noch zeigen müssen.
USA: Oberster Gerichtshof kippt Recht auf Abtreibung
Darum geht es: Der Oberste Gerichtshof hob letzten Freitag das «Roe v. Wade»-Urteil auf und bereitet den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze. Seit 1973 garantierte «Roe v. Wade» Frauen das Recht auf eine Abtreibung, solange der Fötus ausserhalb der Gebärmutter nicht überlebensfähig war – also etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Der US Supreme Court begründete seinen Entscheid damit, dass die Verfassung kein Recht auf Abtreibung gewähre und sich ein solches Recht auch nicht aus anderen Verfassungsgrundsätzen ableiten lasse. Nun können die 50 US-Bundesstaaten selbst über das Recht auf Abtreibung entscheiden. Einige Bundesstaaten wie Oklahoma und South Dakota hatten bereits im voraus sogenannte trigger laws beschlossen, die nach dem Urteil sofort in Kraft traten und Abtreibungen bis auf wenige Ausnahmen de facto verbieten.
Warum das wichtig ist: Das 1973 beschlossene Abtreibungsurteil war ein Meilenstein in der US-Emanzipationsgeschichte. Frauen konnten erstmals über ihre körperliche Integrität bestimmen. Gemäss Umfragen sprach sich über all die Jahre eine Bevölkerungsmehrheit konstant für das Abtreibungsrecht aus. Ebenso konstant kämpften konservative und radikal evangelikale Gruppen dagegen an. Weil der ehemalige US-Präsident Donald Trump in seiner Legislatur drei neue Richter ernennen konnte, die alle als rechtskonservativ gelten, haben die Abtreibungsgegner nun erstmals eine Mehrheit im Obersten Gerichtshof, die jetzt den Entscheid von 1973 rückgängig machte. Der Beschluss zeigt, dass sich die US-Judikative zunehmend entlang der Parteigrenzen politisiert.
Was als Nächstes geschieht: Es wird erwartet, dass ungefähr die Hälfte aller US-Bundesstaaten das Recht auf Abtreibung stark einschränken werden. Das hat für betroffene Frauen schwere Konsequenzen. Sie werden entweder auf eine Abtreibung verzichten oder in andere, liberalere Bundesstaaten ausweichen müssen. Insbesondere ärmere – oftmals schwarze – Frauen könnten sich solche weiten Reisen aber kaum leisten. Wissenschaftlerinnen rechnen in restriktiven Bundesstaaten mit einer Zunahme der Kriminalität, Prekarisierung und Todesfällen als Folge von illegalen und deshalb oft unsachgemässen Schwangerschaftsabbrüchen.
Pharma: Massenentlassung bei Novartis
Darum geht es: Der Schweizer Pharmakonzern setzt einen Anfang April angekündigten Stellenabbau in die Tat um. Er fällt grösser aus als befürchtet: In den nächsten drei Jahren verschwindet in der Schweiz jede achte Stelle. Konkret werden 1400 der hierzulande 11’600 Arbeitsplätze gestrichen. Am Dienstag hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Basel seine Angestellten informiert. Betroffen sind ausschliesslich Bürojobs, etwa in der Personalabteilung, in der Werbung und im Vertrieb. Der Rotstift wird nicht nur in der Schweiz angesetzt: Weltweit gehen bis zu 8000 der total 108’000 Stellen verloren.
Warum das wichtig ist: Mit 50 Milliarden Franken Umsatz ist Novartis eine der grössten Schweizer Firmen und zugleich eines der grössten Pharmaunternehmen weltweit. In Basel ist Novartis neben Roche der grösste Steuerzahler. Konzernchef Vas Narasimhan ist vor vier Jahren angetreten, das zunehmend träge gewordene Unternehmen auf neue Technologien auszurichten. Viele seiner Ziele hat er inzwischen umgesetzt. Dass das nicht ohne grössere Einsparungen gehen würde, war von Anfang an klar. Eine erste Sparrunde mit über 2000 Stellenstreichungen, hauptsächlich in der Produktion, wurde bereits im September 2018 angekündigt. Investoren setzten Narasimhan in den letzten Monaten zunehmend unter Druck, da sich der Aktienkurs der Konkurrentin Roche, die mit weniger Personal deutlich mehr umsetzt, besser entwickelte.
Was als Nächstes geschieht: Nun geht es an die Umsetzung. Dabei werden zahlreiche Stellen in Servicecenter in Tschechien, Indien, Mexiko, Malaysia verschoben. Für die Betroffenen ist ein Sozialplan vorgesehen, über die Details wird noch verhandelt. Der Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz bezeichnet den Abbau als «verantwortungslos» und kündigte an, für die Novartis-Angestellten zu kämpfen.
Zum Schluss: Das Kampfjet-Kino boomt!
Was wünscht man sich in Kriegszeiten mehr, als für ein bisschen Ablenkung die gemütliche Dunkelheit eines Kinos aufzusuchen – und sich zwei Stunden lang die heftigsten Kampfjet-Kapriolen zu geben, yeah! «Top Gun: Maverick», die Fortsetzung des, wenn wir ehrlich sind, ziemlich peinlichen Achtzigerjahre-Fliegerdramas «Top Gun», ist der erfolgreichste Film, bei dem Tom Cruise jemals mitgespielt hat. Über eine Milliarde US-Dollar spülte der Film in den ersten fünf Wochen in die Kinokassen. Und das, obwohl er in China und Russland nicht zu sehen ist. Und obwohl Tom Cruise ein bekannter Sektenmissionar ist. Und obwohl Original wie Fortsetzung vom US-Militär unterstützt worden sind und als Kriegspropaganda rege Verwendung fanden und finden. Und obwohl sich in der Ukraine gerade ein sehr realer Krieg zuträgt. Bereits in den 1990ern versuchte Tom Cruise in einem Interview, die Kritik zu kontern: «Ich will, dass die Kids wissen, dass echter Krieg nicht so aussieht. ‹Top Gun› war bloss eine Achterbahnfahrt.» Danke für die Aufklärung, Tom.
Was sonst noch wichtig war
Corona: Die Fallzahlen steigen weiter. In der Woche zwischen dem 21. und dem 28. Juni hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 33’108 laborbestätigte Fälle registriert, das ist ein Drittel mehr als in der Vorwoche. Zudem meldet das BAG 300 neue Spitaleinweisungen und 14 Todesfälle. Mehrere Kantone bieten nun freiwillige Auffrischungsimpfungen an. Der Richtpreis beträgt 60 Franken und muss selbst bezahlt werden.
Schweiz I: Das Bundesstrafgericht hat die Credit Suisse (CS) wegen Geldwäscherei schuldig gesprochen und zu einer Busse von 2 Millionen Franken verurteilt. Es geht um einen Fall, in dem ein Kokainkartell Koffer voller Bargeld bei der Bank deponierte. Die CS will gegen das Urteil Berufung einlegen.
Schweiz II: Ringier muss Zahlen offenlegen, mit denen sich nachvollziehen lässt, wie viel Gewinn der Verlag mit «Blick»-Artikeln gemacht hat, in denen die Persönlichkeitsrechte von Jolanda Spiess-Hegglin verletzt wurden. Spiess-Hegglin hatte auf Gewinnherausgabe geklagt. Das Urteil des Zuger Kantonsgerichts könnte über den Einzelfall hinaus Folgen für die Schweizer Medien haben. Ringier prüft eine Anfechtung.
Frankreich: Urteile im «Bataclan»-Prozess: Der einzige Überlebende des Terrorkommandos, das 2015 in Paris 130 Menschen tötete, muss 30 Jahre ins Gefängnis, ohne Möglichkeit zur vorzeitigen Entlassung. Weitere 18 Angeklagte erhielten Strafen von 2 Jahren bis lebenslang.
Spanien: Bei einem Sturm auf die spanische Exklave Melilla sind laut Behördenangaben mindestens 23 Menschen gestorben; Menschenrechtsorganisationen sprechen von 37 toten Migranten und 2 toten marokkanischen Polizisten. Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez zog scharfe Kritik auf sich, weil er den Sicherheitskräften attestierte, sie hätten die Situation gut gelöst.
Norwegen: Bei einem Anschlag auf eine Bar in Oslo, die von einem queeren Publikum besucht wird, starben 2 Menschen, mehr als 20 wurden verletzt. Der mutmassliche Schütze wurde verhaftet. Der 42-Jährige war dem Geheimdienst als Sympathisant der Terrormiliz IS bekannt.
USA I: Am Samstag unterzeichnete Präsident Biden ein neues Gesetz, das den Zugang zu Waffen erschweren soll. Das Gesetz, auf das sich Abgeordnete beider Parteien verständigt hatten, bringt nur punktuelle Verschärfungen; trotzdem ist es der grösste Erfolg im jahrzehntelangen Kampf für strengere Waffenregelungen.
USA II: In der Nähe der Stadt San Antonio in Texas starben mehr als 50 Migrantinnen. Sie waren in einem Lastwagen von Mexiko in die USA gelangt. Seit Monaten steigt die Zahl der Menschen, die ohne gültige Papiere von Mexiko her in die USA einreisen wollen.
USA III: Im Fall Epstein ist dessen ehemalige Vertraute Ghislaine Maxwell zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie hatte Jeffrey Epstein beim Missbrauch von Minderjährigen unterstützt. Auch in einem anderen Missbrauchsfall wurde ein Urteil gesprochen: Der Sänger R. Kelly muss unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger 30 Jahre hinter Gitter.
Drogen: Der neueste «World Drug Report» der Uno stellt eine steigende Zahl von psychischen Erkrankungen durch den Konsum von Hanfprodukten mit hohem THC-Gehalt fest. Weitere Erkenntnisse: In den USA starben 2021 mehr als 100’000 Menschen an Opioid-Überdosen. Einen zunehmenden Missbrauch von Opioiden stellt der Report auch in Afrika und im Nahen Osten fest.
Die Top-Storys
Putschen, bis es kracht Bei einem kurzfristig angesetzten Hearing des January 6 Committee belastete eine damalige Angestellte des Weissen Hauses Ex-Präsident Trump schwer. Laut Cassidy Hutchinson wollte Trump während des Sturms auf das Kapitol unbedingt dorthin gebracht werden. Als seine Personenschützer das aus Sicherheitsgründen ablehnten und ihn zurück ins Weisse Haus fuhren, soll er dem Fahrer ins Lenkrad gegriffen haben. Hier die «Highlights» der verstörenden Aussagen.
Skandalfeld Leistungssport Eltern, die auch als Trainer und Richterinnen tätig sind und dabei ihre Kinder bevorteilen, Essverbote und Dehnen bis zum Muskelriss – eine Recherche von «SRF Investigativ» deckt Missstände im Schweizer Synchronschwimmen auf.
Der Autor und sein Leser Wie die Welt der Literatur durch die Digitalisierung betroffen ist, darüber schreibt Johannes Franzen in seinem Essay «Die Trennung von Publikum und Autor». Es geht um J. K. Rowling und Peter Handke, um twitternde Schriftsteller und rezensierende Social-Media-Nutzerinnen – und darum, wie der Wandel der literarischen Öffentlichkeit das Verhältnis von Autor und Publikum neu ordnet.
Illustration: Till Lauer