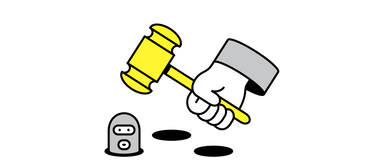
Ein Schweizer – nur nicht auf dem Papier
Er hat viel verbockt und ist ein Pechvogel. Nun soll er ausgeschafft werden – wegen seiner Straftaten. Aber auch, weil die Schweiz einst seiner Mutter das Bürgerrecht nahm.
Von Brigitte Hürlimann, 12.01.2022
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Im November 2010 nimmt der Schweizer Souverän die Ausschaffungsinitiative der SVP an. Sechs Jahre später wird der Volkswille konkretisiert, in Artikel 66a des Strafgesetzbuchs. Der Tatbestand regelt die obligatorische Landesverweisung – mit einem ellenlangen Katalog an Delikten, die zum Rauswurf aus der Schweiz führen sollen.
In der gleichen Norm wird aber auch der Härtefall festgehalten, der es den Gerichten ermöglicht, trotz Obligatorium den Einzelfall zu würdigen und damit die Landesverweisung verhältnismässig und völkerrechtskonform anzuwenden. Es muss stets abgewogen werden: die privaten Interessen der Betroffenen versus die Interessen des Staats, der gewisse Täter nicht mehr auf seinem Territorium dulden will. Die Situation von Secondos, also von Menschen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind, wird explizit erwähnt. Ihrer «besonderen Situation» sei «Rechnung zu tragen», so der Wortlaut. Und damit der Auftrag des Gesetzgebers an die Gerichte.
Was bedeutet das für einen 51-jährigen Mann, der nicht Schweizer geworden ist, weil das frühere Bürgerrecht Schweizer Frauen diskriminierte? Der hier geboren wurde, fast sein ganzes Leben lang in der Schweiz verbracht hat – wegen seiner Sucht und der damit verbundenen Delinquenz aber immer und immer wieder vor dem Strafrichter landet?
Ort: Kantonsgericht St. Gallen
Zeit: 21. Dezember 2021, 9.30 Uhr
Fall-Nr.: ST.2021.34
Thema: Landesverweisung
Er wird von Polizisten in den Gerichtssaal geführt, direkt aus dem Gefängnis, denn er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Sein Verteidiger wird später sagen, wie unangenehm es dem 51-Jährigen sei, dass man ihm nicht erlaubt habe, sich für den Prozess anständig anzuziehen und vorher zu duschen. Aber auch abgesehen von der unpassenden Kleidung (Trainerhosen) sieht man dem Mann die Spuren eines schwierigen Lebens allzu deutlich an – und wenn er spricht, versucht er nichts zu beschönigen.
Er gibt alles zu. Über seine Taten und die Strafe muss am Berufungsprozess nicht mehr gesprochen werden, das wird alles akzeptiert, von allen Seiten.
Das Kreisgericht Wil hat ihn im Dezember 2020 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 25 Monaten verurteilt. Plus zu einer Geldstrafe (20 Tagessätze à 30 Franken), einer Busse (500 Franken) sowie zu einer vollzugsbegleitenden, ambulanten Behandlung. Der Mann hat sich des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht, der Beschimpfung, der versuchten Gewalt und Drohung gegen Beamte, der Hinderung einer Amtshandlung, des Diebstahls (in einer Garage) und des Hausfriedensbruchs (in derselben Garage).
Aber eben: Darum geht es jetzt nicht.
Seine Strafe sitzt der mehrfach vorbestrafte Mann vorzeitig und klaglos ab. Er weiss, dass er es einmal mehr verbockt hat – allzu früh nach seiner letzten Verurteilung. Dass es so nicht weitergehen kann.
Eine «lebensentscheidende Frage»
Der Grund, warum er das vorinstanzliche Urteil vors Kantonsgericht St. Gallen gezogen hat, ist ein anderer. Es geht um seine Wurzeln, seine Existenz. Darum, dass er nicht endgültig den Halt im Leben verliert. Dass er nach verbüsster Strafe dorthin gehen kann, wo er Unterstützung und Wärme findet: zur Mutter und zum Stiefvater, die im Appenzellischen wohnen, mit Garten und Hunden; die auf ihn warten, ihn aufnehmen wollen. Beide haben das Pensionsalter längst überschritten und wären froh um eine zupackende Hand.
An diesem Prozess werde eine «lebensentscheidende Frage» verhandelt, wird der Verteidiger und St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner später im Plädoyer sagen.
Denn die Vorinstanz hat nicht nur eine unbedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen, sondern auch eine Landesverweisung von acht Jahren. Das ist das einzige Thema an der Berufungsverhandlung. Darf sich der gestrauchelte, von der jahrzehntelangen Drogensucht gezeichnete Mann fortan nicht mehr in der Schweiz aufhalten? Wegen seiner andauernden Delinquenz? Obwohl er hier geboren wurde und die meiste Zeit seines Lebens in der Schweiz verbracht hat?
Die Mutter sitzt im Gerichtssaal, direkt hinter ihrem Sohn. Vor dem Prozess hat sie Rechsteiner anvertraut, sie habe kaum geschlafen in der Nacht zuvor. Sie habe Angst um ihren Ältesten, mache sich die allergrössten Sorgen. Letzten Sommer ist einer ihrer drei Söhne unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen.
«Ich will nicht noch einen zweiten Sohn verlieren.»
Die sich sorgende Mutter ist Schweizerin, die Grossmutter, Urgrossmutter und Ururgrossmutter des Beschuldigten sind oder waren es ebenfalls. Wobei präzisiert werden muss: Sämtliche Frauen hatten zumindest vorübergehend ihr Schweizer Bürgerrecht verloren, weil sie italienische Staatsangehörige heirateten. Das war die Regel des früheren, diskriminierenden Bürgerrechts.
Durch Heirat ausgebürgert
Die Bündner Historikerin Silke Margherita Redolfi geht davon aus, dass zwischen 1885 und 1952 mehr als 85’000 Schweizerinnen ihr Bürgerrecht verloren. Ab 1953 kam es dann zu ersten Gesetzeslockerungen. Doch noch bis 1978 galt, dass Hiesige, die mit einem Ausländer verheiratet waren, ihr Schweizer Bürgerrecht nicht an die Kinder weitergeben konnten.
Der gestrauchelte Sohn wurde 1970 im Kantonsspital St. Gallen geboren, wie seine jüngeren Brüder auch. Die Mutter hat erst 1992 ihr Schweizer Bürgerrecht wiedererlangt. Sie sagt: «Mein Sohn ist nur auf dem Papier italienisch. Er ist Schweizer!»
Die Familie ist bitterarm, die Ehe der Eltern ein Desaster, und weil der Vater in der Schweiz seinen Job verliert, muss die fünfköpfige Familie Mitte der 1970er-Jahre vorübergehend zurück nach Italien.
Dort sei es «ganz schlimm» gewesen, berichtet die Mutter. Sie schildert in einem schriftlichen Bericht, der dem Gericht eingereicht wird, die gewalttätige Beziehung mit dem «Erzeuger», wie sie ihren Ex-Ehemann nennt. Sobald es möglich war, kehrte sie mit ihren drei Söhnen zurück in die Schweiz. Dort war sie alleinerziehende Mutter, musste arbeiten, bekam von niemandem finanzielle Unterstützung («auch vom Sozialamt nicht»), die Söhne wurden in verschiedenen Kinderheimen untergebracht.
Der Älteste, sagt die Mutter, habe die Vaterrolle für die jüngeren Brüder übernommen.
Doch in seiner frühen Jugendzeit rutscht der älteste Sohn in die St. Galler Drogenszene ab und beginnt straffällig zu werden. Auf eine Einbürgerung hat der süchtige Dauerdelinquent fortan keine Chance mehr. Der Secondo ist Italiener geblieben, und das wird ihm nun zum Verhängnis.
Kein Ladendieb, aber ein Dealer
Der heute 51-Jährige ist aber auch ein ausgesprochener Pechvogel. Das jüngste Strafverfahren wurde nur deshalb ausgelöst, weil man ihn fälschlicherweise des Ladendiebstahls verdächtigt hatte. In Panik rannte er im Dezember 2019 vor einer Kontrolle davon, lieferte sich ein Handgemenge mit einem Polizisten, warf ihm ein wüstes Schimpfwort nach – und wurde festgenommen.
Die Strafverfolger durchforsteten sein Handy und stiessen prompt auf einen Chatverlauf, der untrüglich auf einen Heroinhandel hinwies.
Der Mann hat innerhalb von vier Monaten mit über einem Kilogramm Heroingemisch gedealt, davon waren rund 250 Gramm reines Heroin. Er habe die Drogen für eine Freundin besorgt und etwa die Hälfte davon selbst konsumiert, beteuert er vor dem Kantonsgericht.
Er sei da reingerutscht.
Er sei ein Idiot gewesen.
«Hätte ich bloss Nein gesagt. Aber ich war wirklich nicht mehr auf der Gasse, ehrlich, und ich habe die Drogen nur für diese eine Freundin besorgt, nicht an andere weiterverkauft.»
Der Gerichtsvorsitzende Jürg Diggelmann fragt: «Verstehen Sie, dass die Schweiz ein Problem mit Ihnen hat? 2019 sind Sie vor diesem Gericht gestanden und haben Besserung gelobt. Damals haben wir auf eine Landesverweisung knapp verzichtet. Und nun sind Sie schon wieder hier.»
Der Beschuldigte: «Ich weiss nicht, warum ich einen italienischen Pass habe, ich habe niemanden in Italien, ich finde mich dort nicht zurecht. Ich will bei meinen Eltern bleiben, bei ihnen wohnen, ihnen helfen. Im August werde ich 52. Wo soll ich denn hin, wenn Sie mich ausweisen? Ich bin doch hier aufgewachsen!»
Es sei einfach nur zynisch, ergänzt Verteidiger Rechsteiner, bei seinem Mandanten von einer möglichen «Wiedereingliederung im Herkunftsland» zu sprechen, da er doch in der Schweiz geboren und mehrheitlich hier aufgewachsen sei. Deshalb und angesichts der eindrücklichen Familiengeschichte des Mannes sei es unerträglich, diskriminierend und menschenrechtsverletzend, ihn wegen seiner Delinquenz auszuschaffen.
Ein «unentziehbares Recht auf Heimat»?
Andreas Zünd, Ex-Bundesrichter und heute Schweizer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, hielt bereits 1992 in einem Aufsatz fest: Bei einem Ausländer der zweiten Generation scheine ihm «kein öffentliches Interesse vorstellbar, das eine Ausweisung zu rechtfertigen vermöchte. Ich meine, dass es ein unentziehbares ‹Recht auf Heimat› nicht nur des Staatsbürgers, sondern auch desjenigen gibt, der seine familiären, sozialen und kulturellen Beziehungen seit der Kindheit in einem bestimmten Land hat.»
Rechtsanwalt Rechsteiner zitiert aus dieser Schrift und reicht dem Kantonsgericht auch noch eine Stellungnahme der Bürgerrechtsspezialistin Barbara von Rütte ein, die derzeit am Europainstitut der Universität Basel forscht. Die promovierte Juristin hält unter anderem fest:
Der Fall des Beschuldigten zeige «exemplarisch, wie sich die bis 1992 vorherrschende Diskriminierung von Frauen im schweizerischen Bürgerrecht bis heute auswirkt».
Der Mann sei «von seiner Abstammung her klar Schweizer» und nach «heutigem Recht Schweizer Staatsangehöriger».
Der drohende Landesverweis sei «immer noch Folge der damaligen Diskriminierung der Frauen im Schweizer Bürgerrecht».
Der betroffene Sohn habe «aufgrund seiner Straffälligkeit nicht die Möglichkeit, das Schweizer Bürgerrecht zu erwerben». Eine Ausweisung würde die frühere Diskriminierung «erneut reproduzieren und schwerwiegend in das Recht auf Privatleben gemäss Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention eingreifen». Verletzt würde damit auch das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau, das von der Schweiz 1997 ratifiziert wurde.
Das dreiköpfige Gerichtsgremium hört sich die Ausführungen des Verteidigers an. Staatsanwalt Lukas Oberholzer beantragt die Abweisung der Berufung und die Bestätigung einer Landesverweisung von acht Jahren. Nicht der Mann sei diskriminiert worden, sagt er, sondern seine Mutter. Es bestehe eine sehr grosse Rückfallgefahr, der Täter habe in erheblichem Ausmass mit Heroin gehandelt, sei immer wieder rückfällig geworden.
Die Schweiz habe ein grosses Interesse daran, ihn des Landes zu verweisen. Und immerhin habe er ja ein paar Jugendjahre in Italien verbracht.
Bewegung auf dem politischen Parkett
Das Gericht will sich seinen Entscheid gründlich überlegen und verzichtet darauf, noch gleichentags ein Urteil zu eröffnen. Einen Tag später trifft das Urteilsdispositiv bei Verteidiger Rechsteiner ein. Die Berufung wird abgewiesen, die angefochtene Landesverweisung bestätigt. Eine Begründung steht noch aus.
Paul Rechsteiner sagt: «Dann geht der Fall halt ans Bundesgericht und notfalls bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg.»
Nur wenige Tage vor diesem Strafprozess hatte er in seiner Funktion als St. Galler SP-Ständerat die Einführung des ius soli gefordert – dass also jeder Mensch, der in der Schweiz zur Welt kommt, das Schweizer Bürgerrecht erhält; natürlich nur dann, wenn die Eltern Wohnsitz in der Schweiz haben. Nicht bei Touristen, wie es Justizministerin Karin Keller-Sutter bei der Beratung im Rat suggeriert hatte. Das ius soli gilt heute beispielsweise in den USA oder in Kanada.
Rechsteiners Vorstoss hatte keine Chance, er wurde in der kleinen Kammer mit 29 zu 13 Stimmen abgelehnt. Genauer prüfen will der Rat hingegen eine Motion der Grünen Genfer Ständerätin Lisa Mazzone, die Erleichterungen bei der Einbürgerung von Secondos verlangt.
Ein Verein mit dem Namen «Aktion Vierviertel» bereitet eine Initiative vor, um das Thema des ius soli auf der politischen Agenda zu verankern. Gefordert wird ein Grundrecht auf Einbürgerung. Um dem einen Viertel der Schweizer Bevölkerung die Teilhabe zu ermöglichen, von der er heute ausgeschlossen ist.
Und damit Menschen wie der «Italiener» mit dem Drogenproblem in Zukunft nicht mehr Gefahr laufen, ihre Heimat zu verlieren.
Illustration: Till Lauer