
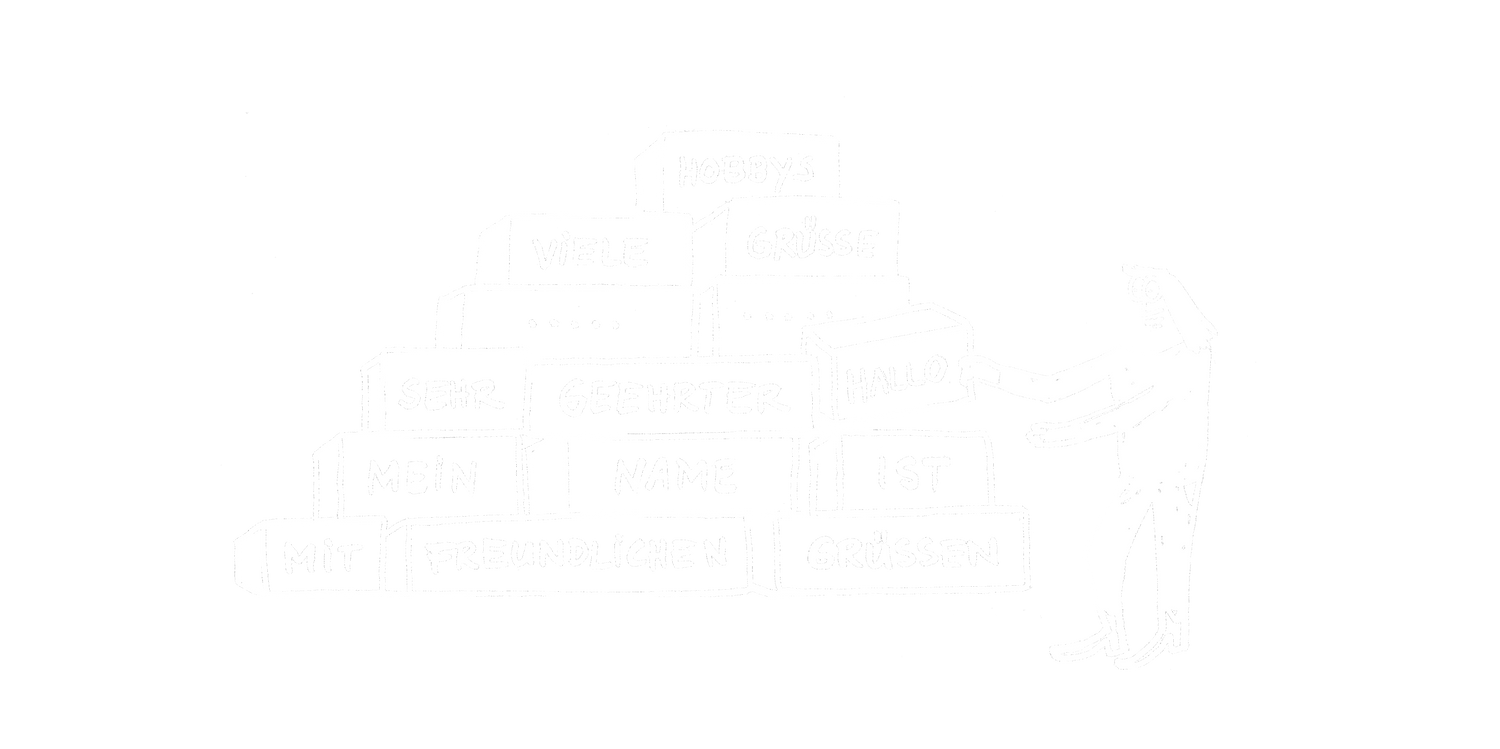
So wird die Jobsuche menschlicher, ehrlicher, bullshitfreier
Der Bewerbungsprozess funktioniert im Grunde noch immer wie vor Jahrzehnten. Es ist höchste Zeit, umzudenken – für alle Beteiligten. Willkommen zu «Humane Ressourcen».
Von Reto Hunziker (Text) und AHAOK (Illustration), 20.04.2021
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Lassen Sie mich drei Fragen in den Raum stellen:
Macht es Ihnen Spass, sich zu bewerben?
Fühlen Sie sich wohl dabei?
Haben Sie den Eindruck, sich gebührend zu verkaufen?
Egal, ob Sie beruflich fest im Sattel sitzen, immer mal wieder woanders arbeiten oder wegen der Corona-Krise sogar den Job verloren haben: Ich behaupte, Sie haben mindestens zwei dieser Fragen mit Nein beantwortet.
Das ist fatal – denn die Arbeit zählt zu den wichtigsten Faktoren, die unserem Leben Sinn geben und worüber wir uns in der Gesellschaft definieren. Umso wichtiger wäre es, dass wir uns bei der Jobsuche weder unwohl noch unfrei fühlten, sondern Motivation und im besten Fall sogar Freude verspürten.
Wie kommen wir da hin? Das soll «Humane Ressourcen» in den nächsten Wochen aus ganz verschiedenen Winkeln ausleuchten. Wie liesse sich der Bewerbungsprozess entstauben? Die Jobvermittlung auf dem Arbeitsamt weniger pauschal gestalten? Der Stellensuche ihr Schrecken nehmen? Wie könnte ein humaner Stellenmarkt funktionieren?
Klar, schon die eigenen Erwartungen machen es kompliziert, einen Job zu finden, den man gerne und gut macht. Und die Pandemie hat die Situation auf dem Stellenmarkt nochmals dramatisch zugespitzt. Die Zahl der Inserate ist abgesackt, die der Bewerberinnen in die Höhe geschnellt. Es gibt Menschen, die seit Monaten erfolglos Arbeit suchen.
Doch auch wenn derzeit einiges, was schiefläuft, unter «höhere Gewalt» einzustufen ist – es ist nötig, genauer hinzuschauen und den Status quo zu hinterfragen. Die Konventionen, Vorschriften, Erwartungen und Prozeduren: alles, was das Bewerben so verzwickt macht.
(Wenn Sie gleich direkt in die erste Folge einsteigen möchten, dann lesen Sie hier, warum Sie ab jetzt nie mehr «Bewerbungsbrief Muster» googeln sollten – und was stattdessen hilft, einen guten Motivationsbrief zu schreiben.)
Verstaubte Konventionen
Wir schreiben das Jahr 2021. Mit meinem Handy und einer Drohne kann ich ein Bewerbungsvideo aufnehmen, das früher nur ein zentnerschweres Juwel von Kamera aus einem Helikopter hinbekommen hätte. Auch im Berufsleben haben wir aufgerüstet; geht es darum, eine Stelle zu besetzen, kommen Bots, Algorithmen, Keywords und Video-Recruiting zum Einsatz.
Doch die Grundmechanismen im Bewerbungsprozess sind dieselben wie vor Jahrzehnten:
Bewerber treten als Bittsteller auf, Arbeitgeberinnen als Allmächtige – und die Arbeitsämter als Kontrolleure, die vor allem auf eins bedacht sind: die möglichst rasche Rückführung in den Arbeitsmarkt.
Firmen publizieren Stelleninserate, die so langweilig daherkommen wie die Statuten eines Kleintierzüchtervereins (no offense!). Oder so unrealistische Anforderungen enthalten, dass selbst die erfahrensten Expertinnen eingeschüchtert sind.
Stellensuchende verfassen A4-Motivationsschreiben in Arial 12, reizen jede Zeile aus, füllen sie mit den immer gleichen Phrasen, dazu den staubtrockenen Lebenslauf mit Passfoto und Kurzbeschrieb, der die Konkurrenz genauso gut abbildet wie einen selbst.
Potenzielle Vorgesetzte stellen Interviewfragen, die man heutzutage nicht mehr stellen müsste («Haben Sie Kinder?»). Oder dürfte («Möchten Sie Kinder?»).
Und am Ende kommt die obligate, vor Freundlichkeitsfloskeln strotzende und automatisch generierte Standardabsage.
Ein Beispiel dafür, wie verkrustet die Konventionen im Bewerbungsprozess sind: Immer wieder fragen Bewerbende, welche An- und Abrede man in einem Brief verwenden müsse. «Mit freundlichen Grüssen» sei ja total vieux jeu, sagte mir ein Stellensuchender in vollster Überzeugung, das könne, ja dürfe man nicht mehr schreiben, habe er gehört; heutzutage sei das modernere «freundliche Grüsse» zu verwenden. Wenn ich dann prustend und die Hände verwerfend antworte: «Schreiben Sie das hin, was Ihnen am besten gefällt oder am besten zu Ihnen passt», schauen mich die meisten an, als hätte ich gerade die Queen mit dem Filetiermesser skalpiert.
Klima der Angst
Was steckt hinter dem krampfhaften Festhalten an Konventionen? Aufseiten der Bewerbenden höchstwahrscheinlich: Angst. Angst, nicht zu gefallen. Angst, nicht zu genügen. Angst, es nicht richtig zu machen, deswegen keinen Job zu finden und am Ende ausgesteuert zu werden. Das ist absolut nachvollziehbar, aber leider auch sehr hinderlich. Denn wer Angst hat, traut sich nicht, sich auf eigene Überlegungen zu verlassen, Ecken und Kanten zu zeigen oder sonst ein Risiko einzugehen. Alles aber Punkte, die beim Bewerben hilfreich sein können.
Ich habe schon Bewerberinnen erlebt, die ihre Kinder aus dem Lebenslauf gestrichen haben. Weil sie deswegen schon unangenehme Fragen beantworten mussten oder ihre Chancen dadurch verschlechtert sahen.
Kinder. Gestrichen. Aus dem Lebenslauf.
Kürzlich stiess ich auf folgenden Artikel: «Welche Hobbys Sie im Lebenslauf erwähnen sollten – und welche nicht». Er zeigt exemplarisch, wie sehr sich Stellensuchende Orientierung wünschen. Ein Bewerbungscoach behauptet darin, man solle Hobbys dann im Lebenslauf angeben, wenn sie «für die Stelle benötigte Eigenschaften fördern». Jemandem, der Geige spielt, spreche man etwa eine hohe Frustrationstoleranz zu. Bei Führungskräften mache sich Leistungssport gut. Hobbys, die «gesellschaftlich zweifelhaft» seien, solle man lieber nicht aufführen.
Es könnte kaum bezeichnender sein: Aus Angst, es nicht richtig zu machen, klammern sich Bewerbende an Ratschläge, Empfehlungen, irgendwas Fassbares – bloss nicht an ihre eigenen Überzeugungen. Und liefern am Ende etwas ab, was sie gar nicht abbildet. Obwohl es gerade darum ginge.
Gefangen im Schema
Neben der Angst ist wahrscheinlich Bequemlichkeit das grösste Problem. Gerade bei den Arbeitgebern. Sie könnten viel dafür tun, dass mehr Empathie, Individualität und Originalität in den Bewerbungsprozess kommen.
Doch wie es scheint, haben sie es gar nicht nötig; irgendwer sucht ja immer einen Job. Statt die Besten abzuwerben, kann man ja auch einfach die Besten unter jenen auswählen, die sich melden. Nur wenige Arbeitgeber haben bisher gemerkt, dass sich Initiative auch ihrerseits auszahlt. Stattdessen verharren sie in ihrem komfortablen Bereitschaftszustand, in dem sie nur zu reagieren brauchen; die Nachfrage besteht ja ohnehin.
Unternehmen geben ein Vermögen aus, um sich Claims und Visionen ausarbeiten zu lassen. Stelleninserate hingegen reproduzieren sie, als wären es Quittungen. Vergleichbarkeit, Berechenbarkeit und Konkurrenzfähigkeit stehen im Vordergrund – statt Individualität und Originalität.
Dabei müssten die Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen, Mut zum Unkonventionellen beweisen. Dadurch könnten sie sogar ihr Image stärken. Zumal es ein Leichtes wäre, innovativer zu sein als das gängige Schema F.
Das erwartet Sie in «Humane Ressourcen»
Zugegeben, der Arbeitsmarkt ist vielfältig. Branche ist nicht gleich Branche und KMU nicht gleich KMU. Manche Arbeitgeber kommunizieren mit ihren Bewerberinnen auf Augenhöhe, ja machen ihnen fast schon den Hof. Andere schicken nicht mal eine Absage. Gleichzeitig werden unzählige Menschen mit völlig uninspirierten Dossiers zu Gesprächen eingeladen, während mindestens genauso viele, die sich bei einer Bewerbung enorm viel Mühe geben, keinen Erfolg haben.
Trotzdem: Ein zeitgemässeres Recruiting-Verfahren tut not. Nicht eines, das sich an Google orientiert – mit Anmelde-Masken und Keyword-Algorithmen –, sondern eines, das der Pluralität in unserer Gesellschaft gerecht wird. Mit menschlicheren Abläufen und einem sozialeren Umgang.
Firmen und Arbeitskräfte sollen sich füreinander entscheiden können wie für einen guten Wein: Er muss uns schmecken und zum Menü passen. Da ist es nicht hilfreich, wenn auf der Etikette bloss «rot» oder «weiss» steht.
Wie der Weg dahin aussehen könnte – welche Konventionen die Firmen und Stellensuchenden über Bord werfen müssen und was die Arbeitsämter anders machen könnten –, all das wollen wir ausloten. Und Ihnen den einen oder anderen hoffentlich nützlichen Tipp mitgeben. Die ersten finden Sie bereits in Folge 1: Warum Musterbewerbungen eher schaden – und wie es besser geht.
Ausserdem freuen wir uns auf Ihre Inputs, Rückmeldungen, Perspektiven und Fragen. Was haben Sie auf dem Stellenmarkt erlebt? Mit welchen Schwierigkeiten sind Sie konfrontiert? Und was würden Sie anderen raten? Schreiben Sie es ins Dialogforum!