
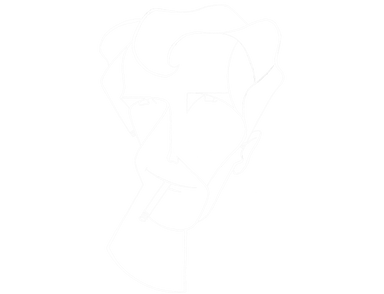
Der, der du niemals sein wirst
Entscheidung
Die ADHS-Kolumne, Folge 9 – Wie man überlebt: in Gruppen. Im Gymnasium. Mithilfe seiner Mutter. Und bei Flugzeugabstürzen.
Von Constantin Seibt, 02.07.2020
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
1980.
Für die Welt begann damit das Orwell-Jahrzehnt.
In Wahrheit begann das Jahrzehnt von drei Revolutionen: dem konservativen Backlash, dem Aufstieg der Manager und von Punk. Es war das Jahrzehnt von Ronald Reagan, der Firmen-Raider, der Zürcher Krawalle.
Jahre später schrieb ich über das alles. Aber damals bekam ich nicht das Geringste mit.
Für mich war 1980 das Jahr der ersten wirklichen Entscheidung meines Lebens. Sie würde mich für immer prägen.
Aber davon wusste ich ebenso wenig wie von allem anderen in der Welt.
Ich war 14. Beim Turnen stand ich noch als Zweitkleinster in der Reihe. Ich hatte eine flaschenbodendicke Brille und eine Schwäche für Logik: Den grössten Spass und die besten Noten hatte ich in Mathematik und Latein.
So kam es, dass ich mich im Gymnasium anders als meine Kollegen entschied, mit denen ich zwei Jahre die Mittagspause geteilt hatte. Und im Typus B blieb: mit Latein. Es war keine Frage, dass das das Richtige war.
Doch schon nach der ersten Turnstunde wusste ich, dass es ein unverzeihlicher Fehler gewesen war. Vier meiner künftigen Klassenkameraden zerrten einen weiteren unter eine kalte Dusche. Es war ein papierdünner Junge mit rötlichen Haaren. Danach überredeten sie ihn, ein Stück Seife zu schlucken.
Ich wusste zwar nichts von der Welt, aber dieses Spiel kannte ich. Vom ersten Tag an knisterte eine boshafte Spannung in der Klasse. Es gab mehrere Bullys, stille Mädchen und eine Auswahl an Opfern. Ich war zurück in der Primarschule.
Was das anging, war ich ein Profi. Ich hatte sechs Jahre Erfahrung, mich auf dem Schulweg zu fürchten. Zwar waren die Bullys mir gegenüber noch freundlich, aber ich wusste, dass das nicht so bleiben würde. Weil sie nie aufhören würden. Sie hatten noch viereinhalb Jahre Zeit.
Dazu wusste ich, dass es letztlich egal war, ob man mich verschonte oder nicht: Bei Demütigungen zuzusehen, tötet deine Seele nur unwesentlich weniger, als wenn du selbst das Opfer bist. Und ich wusste, dass ich das nicht noch einmal überleben würde.
Ich musste da raus. Und ich setzte Himmel und Hölle in Bewegung.
Bis heute halte ich es für das grösste Wunder meines Lebens, dass ich es schaffte. Flucht war eigentlich unmöglich. Die einzige Chance bestand darin, den Typus zu wechseln – vom klassischen B zum neusprachlichen D. Weil dort alle meine ehemaligen Kollegen sassen.
Bis heute verstehe ich nicht, warum sich meine Mutter darauf einliess: Sie war eigentlich für Durchhalten und solide Bildung. Und Typus D mit dem Schwerpunkt Französisch, Englisch und Italienisch war für mich die schlechteste Wahl. Erstens hatte ich weder Talent noch Interesse für Fremdsprachen. Zweitens gab es zu dieser Zeit ohne Latein keinen Uni-Abschluss.
Und bis heute ist mir ein Rätsel, warum sich die Kantonsschule darauf einliess. Es war erst das zweite Jahr, dass Winterthur den Typus D anbot. Und die Schule liess keinen Zweifel, dass sie das als Besudelung ihrer humanistischen Tradition ansah. An einer Orientierungsveranstaltung, die meine Mutter besucht hatte, hatte der Rektor gesagt, Typus D sei im Grunde nur geeignet «für Mädchen, die nach der Schule heiraten wollen».
Es war eine tief konservative Schule. Und es gab keinen Präzedenzfall. Doch meine Mutter schaffte es. Sie muss gekämpft haben wie eine Löwin – und das gegen alle ihre Überzeugungen.
Jedenfalls betrat ich fünf Wochen nach Start mit einem schiefen Lächeln und einem dunklen Plan die neue Klasse, in der mehrere bekannte Gesichter mit einem ebenso schiefen Lächeln antworteten.
Die fünf Wochen Rückstand holte ich in den nächsten fast fünf Jahren nicht mehr auf. Mein Englisch holpert noch heute. Mein Französisch ist eine Schande. Und mein Italienisch nicht einmal das.
Meine Noten sausten in den Keller und blieben dort gelagert.
Aber darum ging es nicht mehr.
Komik, Bastard der Logik
Der Plan, mit dem ich meine neue Klasse betrat, war: Ich wollte nie im Leben wieder als Opfer auf einem Tablett serviert werden. Es reichte für immer.
Und deshalb hatte ich beschlossen, meine Ausbildung um 180 Grad anders anzugehen. Bisher hatte ich die Schule für den Stoff, die Lehrer und die Noten besucht. Nun würde ich für meine Mitschüler hingehen.
Mir wurde schnell klar, dass in meinem Fall die Stelle des Klassenclowns am geeignetsten war. Sie versprach am meisten Freiheit im Kollektiv.
Zwar hatte ich bisher die meisten Lacher unfreiwillig bekommen: für Dinge, die ich ernst meinte. (Und ehrlich gesagt, daran hat sich wenig geändert. Ich schreibe hin, was ich fühle oder sehe – und die Leute finden es witzig.) Aber gerade das bewies mir, dass die Rolle passte. Ich musste nur noch genauer zielen lernen.
Ich ging die Sache systematisch an. Ich investierte für mehrere Monate mein Essensgeld in Taschenbücher von Ephraim Kishon. Der – etwas biedere – Humorist wurde der erste Autor, dessen Gesamtwerk ich las.
Ich ging weiterhin jeden Morgen mit Neugier in die Schule, um zu lernen. Nur tat ich das nun weniger in den Lektionen als in den Pausen. Ich übte, wie man Pointen macht. Ich lernte quasi ein klassisches Handwerk: Denn Witz ist weniger eine Frage der Inspiration als der Konstruktion. Im Prinzip funktioniert Komik wie Latein oder eben Mathematik: Sie ist eine Frage der Logik. Nur, dass man statt eines passenden X ein möglichst unpassendes Y finden muss.
Ich hatte doppeltes Anfängerglück. Zum Ersten, weil die Kantonsschule Winterthur den Typus D als Abfalleimer benutzte. Sie teilte unserer Klasse die jüngsten, verbrauchtesten, verzweifeltsten, unbegabtesten, exzentrischsten, sadistischsten und verträumtesten Lehrer zu. (Nur der Klassenlehrer für Geschichte hatte unzweifelhaft Format.)
Meine Lehrerinnen philosophierten, drohten, rezitierten selbst verfasste erotische Gedichte (über nackte Göttinnen oder die Schönheit ihrer Schülerinnen), hielten selbstquälerische Monologe, klebten Panzerbilder auf ihr Lehrbuch oder bekamen vor Wut epileptische Anfälle. Einige liebte ich, andere hasste ich, Dritte blieben mir fern. Aber alle waren hervorragendes Material für einen Klassenclown.
Zum Zweiten sass schräg hinter mir Martin L.: ein Junge voller schwarzer Haare, mit strahlenden Zähnen, einem fröhlichen Herzen. Er lachte so leicht wie gern. Seine Lachanfälle waren laut, nicht stoppbar und der Untergang jeden geordneten Unterrichts.
Wenn je jemand geboren wurde, um die Einschlagskraft von Witzen zu testen, war das Martin. Ich entwickelte den Ehrgeiz, dass er zumindest einmal pro Monat aus dem Schulzimmer geschmissen wurde.
Einmal etwa teilte unser wohlbeleibter Französischlehrer uns mit, dass Familiennamen aus der Bretagne oft mit -ac endeten.
Er dozierte: «Balzac … Rastignac … Armagnac …»
Worauf ich nach hinten zischte: «Fettsack.»
Worauf jede sinnvolle Lehrtätigkeit unmöglich wurde, sogar nach Martins Rausschmiss. Kein Wunder, dachte ich an diesem Tag, dass ich das Gymnasium nicht vergeblich besuchte. Meine Ausbildung machte eindeutig Fortschritte.
Ich wurde kürzer, schneller, böser.
Und das war wichtig für mein Überleben. Denn Komik ist alles andere als harmlos: Sie ist ein Duell. Lacht dein Publikum nicht, bist du selber der Witz. Wer je eine Karriere als Klassenclown gemacht hat, weiss, dass man schnell Schlagfertigkeit lernen muss, wenn einem das Leben lieb ist. Damit deine Freunde deinetwegen lachen und nicht über dich.
Denn die Versuchung ist gross, dass, wer Witze macht, als Witz behandelt wird. Die einzige Antwort darauf ist, allen, die in Versuchung kommen, schnell und trocken einen Witz über die Rübe zu ziehen. Und dann unschuldig in ihre Augen zu sehen. Bis sie damit aufhören.
So veränderte ich mein Leben also mit 14 zum ersten Mal.
Der Preis
Von Zeit zu Zeit rede ich mit meiner Mutter über diese Zeit. Der Dialog verläuft dann öfter wie folgt.
Ich: «Du hast mir das Leben gerettet. Gegen deine Überzeugungen. Ich liebe dich.»
Sie: «Heute denke ich, das war ein Fehler.»
Ich: «Ehrlich?»
Sie: «Du hattest Potenzial. Hättest du durchgehalten, hätte aus dir etwas werden können.»
Ich ahne sehr genau, was sie meint. Sowohl die Kantonsschule Winterthur wie meine Mutter hatten allen Anlass, den Bruch ihrer Prinzipien zu bereuen.
Die Schule verlor einen guten Schüler und erhielt eine üble Nervensäge.
Meine Mutter verlor einen guten Sohn und bekam einen guten Lügner.
Bis 14 war ich unfähig, zu lügen. Versuchte ich es trotzdem, wurde mein Gesicht rot und mein Körper ein Knoten. Selbst ein Toter hätte mich durchschauen können.
Doch über Nacht änderte sich das. Ich begann, für meine Eltern ein Parallelleben zu erfinden. In den Erzählungen zu Hause war ich weiter der aufmerksame Schüler, ein Liebling seiner Lehrer. Der Trick war, die Lügen a) so nah an die Ereignisse zu schmiegen wie möglich und b) sie ausgewalzt und leiernd vorzutragen.
Das klappte fast immer. Langeweile wurde von meiner Familie traditionell mit Themawechsel bestraft.
Nur von Zeit zu Zeit brach das Gebäude ein. Meine Mutter erschien zuverlässig bei jedem Besuchstag, elegant und mit kurzem Schottenrock. Ich starb hundert Tode, während sie sich offenbar fasziniert mit dem Ekel von Lehrer unterhielt.
Derartige Besuche hatten in unserer Familie Tradition. Etwa bei meinem Grossonkel Louis. Er war nach dem Ersten Weltkrieg Pilot in der österreichischen Luftwaffe. Sein Auftrag war ein Postflug von Wien nach Salzburg. Stattdessen flog er nach Linz, weil meine Urgrossmutter Geburtstag hatte. Dort kreiste er mit dem Doppeldecker über der Familienvilla, bis meine Urgrossmutter auf den Balkon trat. Sie winkte. Er winkte. Und liess dabei das Steuer los.
Das Geburtstagsgeschenk meiner Urgrossmutter war ein brennendes Flugzeugwrack im Garten.
Grossonkel Louis überlebte – mit nichts als ein paar Prellungen. Als meine Urgrossmutter sich von seinem Wohl überzeugt hatte, zog sie ihr elegantestes Abendkleid an und setzte sich in den Zug nach Wien. Dort angekommen verlangte sie, mit Louis’ vorgesetztem Offizier zu sprechen. Er bat sie hinein. Sie setzte sich und sagte: «Er ist so ein guter Sohn!» Worauf der Offizier erwiderte: «Ich kann ihn vollständig verstehen, gnä Frau – bei so einer Mutter!»
Onkel Louis blieb Pilot. Er bekam nicht einmal einen Verweis.
Ein halbes Jahrhundert später war nun die Reihe an meiner Mutter, meinen Lehrern gegenüberzusitzen. Sie hörte sich ihre zahlreichen Klagen an und antwortete: «Constantin erzählt zu Hause sehr viel von Ihnen! Und immer nur Gutes!»
Das wirkte. Meine Benotung stieg nach jedem Besuch meiner Mutter für mehrere Wochen deutlich an.
Danach trottete ich neben ihr nach Hause.
«Du hast im letzten Deutschaufsatz eine Zwei bekommen», sagte sie.
Ich nickte.
«Warum hast du mir nichts davon erzählt?»
«Ich dachte, es würde dich nicht erfreuen.»
«Das tut es auch nicht. Aber sag mal, was ist denn dieser Lehrer für ein komischer Mensch?»
Worauf eine Schilderung der Seltsamkeit des Lehrers in einer derartigen Präzision und Farbigkeit folgte, dass ich mir dachte, dass ich an Kühnheit noch einiges lernen konnte.
Und das tat ich auch. Was mich am allermeisten beeindruckte, war, dass meine Mutter mir gegenüber eigentlich den Grundsatz vertrat: «Der Lehrer hat immer recht. Auch wenn er nicht recht hat!» Und trotzdem ignorierte sie ihr eigenes Prinzip ohne Zögern, sobald sie den Lehrer gesehen hatte.
Ich kenne keinen anderen Menschen, der seine Augen so sehr über seine Vorurteile stellt wie meine Mutter. Es ist unmöglich, sie dafür nicht zu lieben. Auch wenn sie zuweilen wenig Begeisterung dafür hat, dass ich im Journalismus landete – von niemand habe ich so viel darüber gelernt wie von ihr.
In den besten Momenten in meinem Beruf spüre ich die Unverschämtheit ihres Blicks. Und wenn ich wirklich in Form bin, schreibe ich im Stil, in dem mein Vater Kolumnen schrieb: so trocken und endgültig wie ein Skelett.
Auch dann, wenn ich am weitesten weg bin, bin ich ein treuer Sohn.
Feigheit und Fähigkeit
Warum belog ich meine Eltern trotzdem?
Wie so oft bei Lügen waren es diese zwei Gründe: Stolz und Schwäche.
Meine Agenda hatte sich über Nacht um 180 Grad verschoben zu der meiner Mutter. Und ich war überzeugt, dass die Aufgabe, die ich zu lösen hatte, nicht die Noten waren, sondern die Menschen.
Eine Kindheit lang hatte ich mir die Nase an der Scheibe platt gedrückt, während andere Jungs Fussball oder Räuber spielten, lässig und anerkannt. Warum sie dazu gehörten – und ich und mein Bruder nicht –, war mir ein Rätsel. Und komplett unverständlich blieb mir, warum Leute einzeln sich ganz anders verhielten als in einer Gruppe.
Ich fühlte mich noch zu schwach, um meiner Mutter das auseinanderzusetzen. Sie hätte, wie ich fürchtete, das Problem nicht verstanden. Meiner Vermutung nach hätte sie gesagt: Die anderen sind doch unerheblich. Und auch mein Vater, ahnte ich, wäre hier ihrer Meinung gewesen: Man interessierte sich in meiner Familie für Originalität, nicht für das Rudel.
Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich den Mut zu Wahrheit und Kampf gehabt hätte. Aber ich fürchtete mich davor, eine Enttäuschung zu sein. Und noch mehr davor, zurückgeholt zu werden. Und fühlte mich als Verräter.
Anderseits war das mein Spiel. Ich hatte, nach Jahren des Nachdenkens und Scheiterns, endlich die Lösung des Gruppenproblems gefunden: Du musst eine Rolle spielen. Tust du das, bist du sicher. Verweigerst du es, werden sie sich zusammenrotten und dich jagen.
Ich jedenfalls hätte nun wenig dagegen gehabt, mich zu jagen. Wie auch später nach fast jeder wirklichen Entscheidung betrachtete ich mein soeben verlassenes, viel unschuldigeres Ich ohne Sympathie. Ich hatte es satt. Sein Unglück sprach gegen es.
Es war ein echter Triumph. Ich hatte ein Stück Leben begriffen. Ich war zum Jungen unter Jungs geworden und heulte mit ihnen in Richtung eines bedeutungslosen Himmels.
Wieder zu Hause, wenn der Mond durch das Dachfenster schien, bedrückte nur eins: dass ich, sobald ich das erste beinahe unlösbare Rätsel gelöst hatte, mir sofort zwei neue, noch viel unlösbarere Rätsel eingehandelt hatte: Ich wollte vor meinem Tod wenigstens ein Buch schreiben. Und wenigstens einmal mit einem Mädchen schlafen.
PS: Schön, dass Sie sich durch sieben Jahre Gymnasium bis hier heruntergekämpft haben. Eigentlich sollte hier der Hauptteil stehen: eine Strategie, wie man sich mit ADHS auf lange Sicht auf Kurs halten kann. Aber irgendwie kamen ein paar Ideen dazwischen.
PPS: Also Entschuldigung. Und bis demnächst.
PPPS: Andererseits sollten Sie sich beim Lesen einer ADHS-Kolumne nicht wundern, wenn etwas abgeschweift wird.
PPPPS: Ephraim Kishon habe ich ein paar Jahre später tatsächlich einmal getroffen. Er wollte mich verhaften lassen.
PPPPPS: Warum verhaften? Für heute ist genug. Falls Sie wollen, schreib ich es in den Kommentaren zu diesem Artikel.
Illustration: Alex Solman