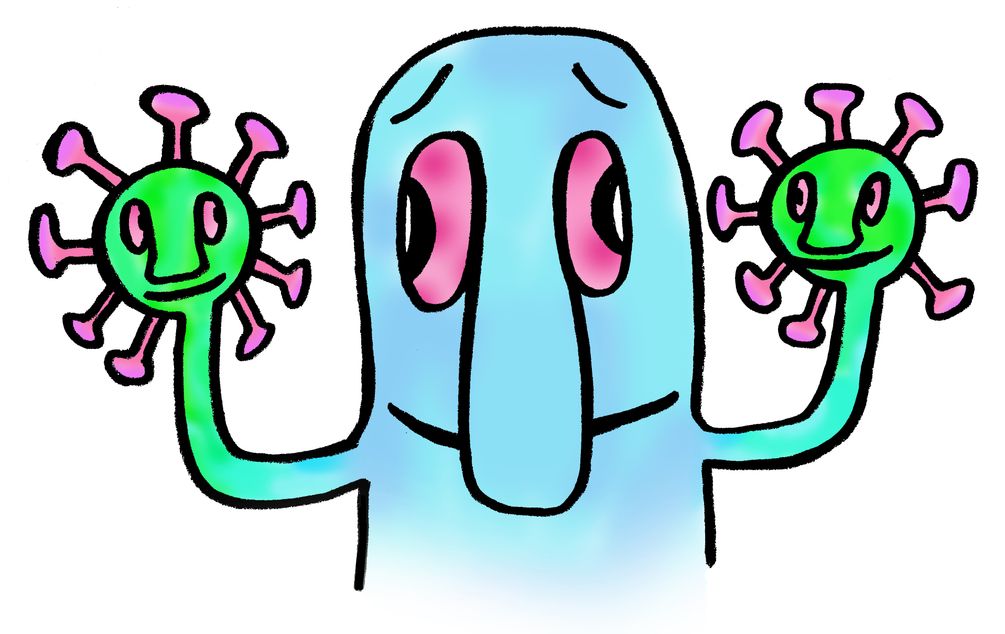
Hello again, Sars-CoV2
Vor drei Monaten hat ein Proteinhäufchen unser Leben aus der Bahn geworfen. Was gibt es seither zu berichten? Was wissen wir jetzt über die Krankheit? War der Lockdown unnötig? Zeit für ein zweites Date. Ay, Corona! – das Sequel.
Von Ronja Beck, Marie-José Kolly (Text) und Martin Fengel (Illustrationen), 18.05.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Sonntag, der 10. Mai, Punkt 11 Uhr, wir rufen Marcel Salathé an, wie wir es damals taten, im Februar. Wir sprechen mit dem Epidemiologen der ETH Lausanne über Kinder und Raucherinnen, über den Lockdown und die Lockerungen.
Und dann sagt er plötzlich: «Wisst ihr, was mich am meisten erstaunt? Ich denke gerade an den Februar zurück. Man wusste damals eigentlich schon wahnsinnig viel.»
Damals. Es scheint ewig her zu sein. Der Stand des Wissens, die Schätzungen, die Vermutungen – alles basierte auf dem ersten grossen Ausbruch in China.
Mehr Daten aus mehr Ländern haben dieses Wissen verdichtet, präzisiert, bestätigt. Aber nichts musste radikal über den Haufen geworfen werden.
Das ist die Pandemie aus der Vogelperspektive – aus der Sicht eines Epidemiologen.
Was ist, wenn wir die Perspektive auf den einzelnen Menschen verschieben? Wir fragen auch dafür einen Spezialisten, Thierry Fumeaux. Er ist geschäftsführender Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin.
Manche seiner Fachkollegen sähen tatsächlich eine neue Krankheit, sagt er. Er sehe aber einfach schwer kranke Patientinnen (und sehr viele davon). Mit Komplikationen, wie sie auf Intensivstationen üblich seien. Dass das aber lediglich seine Erfahrung sei, sagt er auch. Und: «L’expérience ne remplace pas la science. Lasst uns auf mehr Daten warten.»
Wir Laien aber, wir haben das Gefühl, in den vergangenen zwei Monaten unheimlich viel Neues über dieses Häuflein organische Chemie dazugelernt zu haben. Antworten – vollständige, zum Teil, ansatzweise – auf viele Fragen gefunden zu haben. Und genau so möchten wir sie Ihnen beantworten.
Fragen sind in vier Teile gegliedert:
Was macht das Virus mit seinen Wirten? (Fragen 1–5)
Was wissen wir über die erste Welle? (Fragen 6–9)
Was kann ich jetzt tun und erwarten? (Fragen 10–15)
Wie war das noch mal mit der Fledermaus? (Frage 16)
«Bitte geraten Sie jetzt nicht in Panik. Aber Sie müssen damit rechnen, dass Sie das Virus erwischt.» Das haben wir Ende Februar geschrieben. Nun ist es Mitte Mai, und wir fragen: Was ist, wenn es so weit kommt?
1. Was passiert in meinem Körper, falls mich Sars-CoV-2 erwischt?
Das Virus Sars-CoV-2 gelangt via Mund, Nase oder Augen in den Körper, hängt sich via ganz bestimmte Rezeptoren an Zellen und dringt in diese ein. Besonders gut gelingt das im Nasen-Rachen-Raum (und später auch in der Lunge): Dort sind Zellen mit vielen solchen Rezeptoren. Eigentlich ist es ganz einfach: «Das Virus greift als Erstes das Einfallstor an», sagt Thierry Fumeaux, der Spezialist für Intensivmedizin.
Im Innern der Zelle verwendet das Virus unbemerkt die Werkzeuge der Zelle, um seine eigene genetische Information zu kopieren. So vermehrt es sich. Immer mehr Viruspartikel befallen Nachbarzellen und Nachbarsnachbarzellen.
Diese rasche Verbreitung, teilweise noch vor dem Auftreten erster Symptome, kann relativ unbemerkt vor sich gehen. «Was dann passiert, hängt davon ab, wie viele Viren Sie erwischt haben», sagt Fumeaux. «Und davon, wie Ihr Körper darauf reagiert.»
Vielleicht spüren Sie – nichts.
Oder: Ihr Körper reagiert mit Husten, Fieber, Kopf- oder Halsschmerzen. Vielleicht gelingt es dem Immunsystem, das Virus so zu stoppen. Und Sie werden gesund.
1a. Was passiert, wenn die Infektion einen schweren Verlauf nimmt?
Vielleicht befällt das Virus nach der ersten Phase als Nächstes die Zellen in Ihrer Lunge. Nun stört die Antwort des Immunsystems den Sauerstoffaustausch in der Lunge: Immunzellen töten vom Virus befallene Zellen und hinterlassen dort Material – tote Zellen, Eiter, Schleim –, das die Lungenbläschen verstopft. Das erschwert die Sauerstoffzufuhr.
Vielleicht erholen Sie sich aber auch davon – und werden wieder gesund.
Und vielleicht kommt es stattdessen noch heftiger. Denn bei der Krankheit Covid-19 können verschiedenste Organe zu Schaden kommen: Lunge, Herz, Blutgefässe, Nieren, Leber, Darm, Gehirn, Nervensystem.
Was bei Covid-19-Kranken exakt passiert, weiss man häufig nicht so genau. Manchmal steckt hinter einem beschädigten Organ das Virus selbst, denn die Rezeptoren, an die es auf dem Weg in die Zellen andockt, sind vielerorts vorhanden. Und manchmal ist es die Abwehrreaktion des Körpers, die den grössten Schaden anrichtet.
Das nennt man Sepsis – eine typische Komplikation bei Infektionskrankheiten. Das geschwächte Immunsystem erkennt plötzlich, wie stark der Körper von Viren befallen ist, und bekämpft die Infektion nicht mehr nur lokal. Es reagiert im ganzen Körper – und das viel zu heftig – und greift die eigenen Gewebe und Organe an. So hinterlässt es mehr Schaden als die Infektion, die es eigentlich hatte loswerden wollen.
Diese Überreaktion kann, gemäss manchen Forschern, einen sogenannten Zytokinsturm auslösen, ein schwierig zu behandelndes Phänomen, das im schlimmsten Fall zum Organversagen führt. Zytokine sind Moleküle, die normalerweise eine gesunde Immunantwort auslösen mit dem Ziel, ein Virus zu beseitigen. Aber bei einem Sturm schüttet das Immunsystem viel mehr Zytokin aus, als nötig wäre. Immunzellen greifen auch gesunde Zellen an, in lebenswichtigen Organen, die schliesslich versagen können. Und Ärztinnen müssen die Antwort des Immunsystems mit Medikamenten eindämmen. Das ist nicht ungefährlich – denn wer hält dann das Virus in Schach?
Viele der Covid-19-Toten starben an einem septischen Schock. Andere an akutem Lungenversagen (möglicherweise haben Sie in diesem Zusammenhang schon von ARDS gelesen: Acute Respiratory Distress Syndrome). Sie ringen nach Atem, die Sauerstoffversorgung im Blut stürzt ab. Dann muss sie das Pflegepersonal künstlich beatmen. Wenn sie nicht gesunden, hört ihr Herz irgendwann auf zu schlagen, weil ihm der Sauerstoff fehlt.
Was kann noch passieren?
Bei vielen Patientinnen entstehen mit Covid-19 Herzprobleme (auch wenn sie vorher keine hatten). Manche haben Symptome, die man von Herzinfarkten her kennt – aber keinen Herzinfarkt. Wie Covid-19 zu Herzproblemen führt, ist noch ungeklärt – man ist nicht sicher, ob das Virus Zellen im Herzmuskel infiziert oder ob die Reaktion des Körpers das Herz angreift. Im schlimmsten Fall kommt es zum Herzstillstand.
Bei anderen Patienten verengen sich die Blutgefässe: In Fingern, Zehen oder der Lunge fliesst das Blut nur noch langsam. Patienten ringen dann nicht nach Atem, weil die Lungenbläschen nicht betroffen sind, aber der Sauerstoffgehalt im Blut ist zu niedrig. Patienten mit Konditionen, welche die Blutgefässe tangieren – Diabetes, Übergewicht, hoher Blutdruck, Alter –, haben häufig schwere Krankheitsverläufe.
Bei noch anderen entstehen Gerinnsel im Blut, die dann die Blutbahnen blockieren. Dann kann ein Beatmungsgerät zwar noch Sauerstoff in die Lunge befördern, dieser wird aber nicht mehr via Blutbahnen im Rest des Körpers verteilt. Landen die Gerinnsel in der Lunge, droht eine Lungenembolie, landen sie im Gehirn, ein Schlaganfall.
Möglicherweise greift das Virus sogar Zellen im Nervensystem an, etwa den Riechnerv. Das könnte erklären, weshalb manche Patientinnen einen Verlust des Geschmacks- und des Geruchssinns erleiden.
All das seien für Intensivstationen eigentlich keine ungewöhnlichen Erfahrungen, sagt Intensivmediziner Thierry Fumeaux. Ungewöhnlich sei die sehr hohe Zahl der Fälle und damit auch die sehr hohe Zahl der schweren Verläufe. «Wir sehen auf der Intensivstation kritisch kranke Patienten, deren Körper gegen einen schweren viralen Infekt kämpft – wie er das bei anderen Infektionskrankheiten auch tut.»
Der Anteil derer, die ein akutes Lungenversagen mit Komplikationen in Gehirn oder Nieren erlitten, sei seiner Erfahrung nach ähnlich wie bei akutem Lungenversagen ohne Covid-19.
Was Fumeaux aber auch sagt: Es gebe andere Ärzte, die Covid-19 durchaus als eine eigene, besondere Krankheit betrachteten. Und: Seine Erfahrung würde es nicht erlauben, eine statistisch zuverlässige Aussage zu machen. «Auch wenn wir die Ungewissheit nur schlecht ertragen können: Wir müssen abwarten, was uns später die Daten sagen werden.»
2. Warum trifft es manche Patienten so viel stärker als andere?
Der Krankheitsverlauf unterscheidet sich von Patientin zu Patientin. «Die Variabilität ist tatsächlich sehr hoch», sagt auch Thierry Fumeaux. Und wenn sich eine Krankheit bei verschiedenen Menschen so unterschiedlich verhalte, dann, sagt er: «C’est pas le virus. C’est le patient.»
Ein Körper kann sich effizienter oder weniger effizient gegen ein Virus zur Wehr setzen – je nach Alter, Vorerkrankung, Lebensgewohnheiten, Genen und weiteren Aspekten der Immunkompetenz: Wir sind unterschiedlich gut gewappnet.
Der grösste Risikofaktor für einen schweren Verlauf scheint nach allem, was wir bisher wissen, das Alter zu sein. Dann chronische Krankheiten – Diabetes, Herz-Kreislauf-Störungen wie Bluthochdruck oder ein Herzinfarkt sowie deutliches Übergewicht, Lungenkrankheiten, Krebserkrankungen, Nierenerkrankungen.
Es gibt aber erst wenige Untersuchungen zu den Faktoren, die unabhängig mit einem schweren oder tödlichen Covid-Verlauf einhergehen. Viele Risikofaktoren hängen nämlich zusammen: So haben etwa ältere Personen häufiger Vorerkrankungen. Statistische Analysen konnten aber zeigen, dass ältere Patienten auch unabhängig von Vorerkrankungen schwerer erkrankten.
Das Immunsystem eines Menschen wird mitgeprägt von der Umgebung, in der er aufwächst und lebt, und damit von seiner Ernährung, von der Luftqualität, von seinem Zugang zum Gesundheitssystem, von Stressfaktoren. «Entbehrung» ist also auch ein Risikofaktor. So ist die Sterberate, zumindest in den USA, besonders hoch bei Patientinnen, die ethnischen Minderheiten angehören, und bei Patienten mit einem niedrigen sozioökonomischen Status.
Es gibt aber auch Patienten, die mit sehr ähnlichen Bedingungen unterschiedlich stark erkranken. «Manchmal versteht man es einfach nicht. Aber je mehr Informationen wir haben werden, desto besser werden wir es verstehen», sagt Intensivmediziner Fumeaux. Jedoch wisse man auch seit langem, dass genetische Faktoren eine Rolle spielten dafür, wie der Körper auf Krankheitserreger reagiere. Bei manchen Patienten erklären die Gene, weshalb ihr Immunsystem überreagiert. Oder bei einer jungen Person, weshalb sie an Covid-19 stirbt.
Wer an Covid-19 schwer erkrankt, das sind also häufig diejenigen, die auch an anderen Krankheiten schwer erkranken.
Aber auch die Virusladung, der ein Patient ausgesetzt ist, könnte den Verlauf der Krankheit mitbestimmen – für Sars-CoV-1 konnten Wissenschaftlerinnen einen Zusammenhang nachweisen, für Sars-CoV-2 erforscht man derzeit einen möglichen Zusammenhang. Damit könnte man erklären, weshalb es gerade beim Gesundheitspersonal und auch bei jungen Ärztinnen und Pflegern schwer Erkrankte gab. Forschende beobachteten bei chinesischen Patientinnen mit schweren Krankheitsverläufen bedeutend höhere Virusladungen als bei denjenigen mit milden Symptomen.
2a. Hat das Geschlecht einen Einfluss auf den Verlauf?
In Italien oder China, aber auch in der Schweiz zeigen die Daten eine erhöhte Sterblichkeit bei Männern:
Bisher starben bedeutend mehr Männer als Frauen an Covid-19
Anteil der positiv Getesteten, die verstorben sind; in Prozent
Quelle: Bundesamt für Gesundheit. Stand: 14. Mai 2020.
Warum das so ist, ist bis jetzt nicht vollständig geklärt. Männer rauchen eher, waschen ihre Hände seltener und gehen weniger schnell zum Arzt – all dies könnten mögliche Gründe sein. Zudem haben Frauen ein vergleichsweise robusteres Immunsystem als Männer.
In den USA werden deshalb zurzeit Sexualhormone, die primär bei Frauen vorkommen, als mögliche Heilsbringer getestet. Bei Progesteron haben Wissenschaftler antientzündliche Eigenschaften festgestellt. Das Hormon, gemeinsam mit Östrogen, kommt in besonders hohen Anteilen bei Schwangeren vor. Bei diesen wurde in den USA meist nur ein milder Krankheitsverlauf beobachtet, obwohl ihr Immunsystem in der Regel geschwächt ist. Ob die Hormone den Unterschied ausmachen, ist jedoch bisher nichts weiter als eine These. Die Resultate der klinischen Studien werden in den kommenden Monaten erwartet.
Zu den Medikamenten lesen Sie bei Punkt 12 mehr.
3. Welche Langzeitschäden kann Covid-19 verursachen?
Es sind erst etwas mehr als vier Monate vergangen seit den ersten Covid-Diagnosen. Für Langzeitstudien, die uns eine Antwort geben könnten, ist es schlichtweg noch zu früh. Ein Blick auf Sars und Mers – beides Atemwegserkrankungen, die ebenfalls von Coronaviren verursacht werden – lässt immerhin eine vage Prognose zu. Und die sieht leider nicht sehr gut aus.
Nachfolgestudien zu Mers zeigten, dass ein Drittel der untersuchten Genesenen fünf Jahre nach ihrer Erkrankung an einer Lungenfibrose litt. Ihr Lungengewebe war unwiderruflich vernarbt. Eine Langzeitstudie mit ehemaligen Sars-Patienten zeigte, wie ihre Lungen noch Jahre später beeinträchtigt waren. Im Verlauf von 15 Jahren gingen die meisten Symptome jedoch zurück.
Ärzte weltweit fürchten nun, dass es Covid-19-Erkrankten ähnlich gehen wird. Es gibt bereits erste Anzeichen von möglichen bleibenden Schäden an einer Vielzahl von Organen – an Lunge, Nieren, Herz oder Hirn. Wer beispielsweise ein akutes Lungenversagen (ARDS) erleidet, muss mit jahrelangen Schädigungen rechnen. ARDS ist, im Gegensatz zu Covid-19, gut erforscht.
Grundsätzlich gilt: Wer einen schweren Verlauf erlebt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden muss, erleidet mit höherer Wahrscheinlichkeit Langzeitschäden. Das gilt für Covid-19-Patienten wie auch für andere Lungenerkrankte. Für Patienten, die nur milde Symptome zeigen – was gemäss einer grossen chinesischen Studie bei bis zu 80 Prozent der Covid-Fälle zutrifft –, bleibt das Risiko jedoch gering, sagt zum Beispiel Shu-Yuan Xiao, Professor für Pathologie an der Universität Chicago.
4. Wer hatte Covid-19 in der Schweiz schon? Wen trifft es besonders hart?
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat, nach kräftiger Kritik, die Daten gebündelt und öffentlich zugänglich gemacht. Die Zahlen werden täglich aktualisiert. An ihnen lässt sich ablesen, wie ab einem gewissen Alter das Risiko eines tödlichen Krankheitsverlaufes in die Höhe schnellt: Mit 1109 von gesamthaft 1595 Todesfällen sind die über 80-Jährigen die am heftigsten betroffene Altersgruppe. Im Schnitt stirbt jeder Vierte von ihnen, der positiv auf Covid-19 getestet wurde:
Bei den mehr als 80-Jährigen ist das Sterberisiko am höchsten
Anteil der positiv Getesteten, die verstorben sind; in Prozent
Quelle: Bundesamt für Gesundheit. Stand: 14. Mai 2020.
Bei den unter 30-Jährigen hingegen gibt es in der Schweiz bisher keine Todesfälle, bei den unter 50-Jährigen lassen sie sich an zwei Händen abzählen. Was nicht bedeutet, dass junge Menschen gegen einen schweren Krankheitsverlauf gefeit sind.
Was die Daten nicht zeigen: Wie viele Menschen in der Schweiz tatsächlich an Covid-19 erkrankt sind. Nur wer sich testen lässt, fällt logischerweise in die Statistik. Was wir wissen: Bis zum 15. Mai wurden in der Schweiz mehr als 330’000 Tests auf Covid-19 durchgeführt. Im Schnitt sind es über 36 Tests auf 1000 Einwohnerinnen.
Neue Hochrechnungen legen nahe: Das könnte ein kleiner Teil der tatsächlichen Erkrankten sein. Forscher der London School of Hygiene and Tropical Medicine schätzen die eigentlichen Fallzahlen in der Schweiz auf zwischen 95’000 und 160’000. Und das sollen nur diejenigen sein, die Symptome zeigen.
Wir haben mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gesprochen – dort ist das Modell bekannt. Die zugrunde liegenden Annahmen seien aber nicht unbedingt auf die Schweiz und andere Länder übertragbar. Und zwar, weil sie auf der Situation in Wuhan basierten.
Gemäss dem BAG ist eine schweizweite Studie zur sogenannten Seroprävalenz vorgesehen. Die Untersuchung soll feststellen, wie viele Menschen bereits mit dem Virus infiziert waren.
5. Und was ist jetzt mit den Kindern – spielen sie eine Rolle?
Seit einer Woche sitzen in der Schweiz Lehrer und Schüler mit verschiedenen Schutzmassnahmen in ihren Klassenzimmern. Physische Distanz dürfte nicht so leicht durchzusetzen sein. Wird deshalb die Zahl der Infektionen wieder hochschnellen?
Wichtig hierfür ist:
wie häufig sich Kinder infizieren;
wie infektiös sie sind;
wie krank sie werden;
wie viel Kontakt sie haben.
Restlos geklärt sind diese Fragen noch nicht, und die Forschungslage dazu, wie stark Kinder das Virus verbreiten, ist noch relativ dünn.
Was wir bisher wissen:
Unter Kindern gibt es gemäss einer Studie aus der medizinischen Fachzeitschrift «The Lancet» nicht weniger Infizierte als unter Erwachsenen. Das Fazit des Autorenteams: «Das Infektionsrisiko ist bei Kindern ähnlich wie bei der Gesamtbevölkerung – es ist aber bei Kindern weniger wahrscheinlich, dass sie schwere Symptome entwickeln.» Man solle also die Verbreitung durch Kinder mitberücksichtigen, wenn man das Virus eindämmen wolle. Ein Antikörper-Experiment vom Universitätsspital Genf, das noch nicht wissenschaftlich begutachtet wurde, zeigt ebenfalls: Kinder und Erwachsene wurden gleich häufig infiziert. Jedoch finden andere Untersuchungen bei Erwachsenen ein höheres Infektionsrisiko. Die Methoden der Studien unterscheiden sich. Fazit: Die Frage muss noch offen bleiben.
Ein neues Experiment aus dem Labor des deutschen Virologen Christian Drosten zeigt, dass sich die Viruslast im Rachen von Kindern nicht signifikant von der im Rachen von Erwachsenen unterscheidet. Die bisher ebenfalls noch nicht peer-reviewten Resultate bestätigen, was andere Wissenschaftler gefunden hatten: Kinder könnten genauso infektiös sein wie Erwachsene.
Allerdings werden mit dem Virus infizierte Kinder nur selten schwer krank – die meisten haben nur milde Symptome. Sie niesen und husten also weniger stark und geben so weniger infiziertes Material weiter.
Dafür haben Kinder aber viel mehr Kontakt mit ihren Mitmenschen als Erwachsene, dabei oft auch engeren Körperkontakt.
Und dennoch scheinen Kinder das Virus seltener zu übertragen als Erwachsene, das folgert die wissenschaftliche Taskforce, die den Bund in dieser Frage berät, aus mehreren Studien, und das folgert auch der Epidemiologe Marcel Salathé: «Dass Kinder das Virus übertragen können, bezweifelt kaum jemand ernsthaft. Aber wenn sie massgebliche Treiber der Epidemie wären, sollte das aus den Ansteckungsketten verschiedener Länder hervorgehen. Das tut es aber nicht.»
Nun gaben am Anfang der Epidemie vor allem junge Erwachsene das Virus weiter – die Personen, die sich am meisten bewegen. Es waren nicht die Kinder, die das Virus in die Haushalte einschleppten, sagt auch der Virologe Christian Drosten im Norddeutschen Rundfunk. Aber wenn die Kinder tatsächlich gleich infektiös seien wie Erwachsene, dann könne sich das mit der Wiedereröffnung der Schulen und Kitas durchaus wieder ändern. Und auch die Schweizer Taskforce schreibt: «Die Absenz von Evidenz ist nicht die Evidenz von Absenz: Man kann nicht davon ausgehen, dass Kinder das Virus nicht übertragen.»
6. Wie steht es um die Sterberate, oder: Ist Covid-19 wirklich schlimmer als eine Grippe?
Die Infektionssterblichkeit beschreibt, wie viele der Angesteckten an der Krankheit sterben, die das Virus verursacht. Wissenschaftler rechnen hierbei mit ein, dass viele der Infizierten nie getestet wurden (die Fallsterblichkeit – positiv Getestete, die sterben – liegt höher).
Für Sars-CoV-2 schätzten Wissenschaftlerinnen aufgrund der Daten aus China im Februar die Infektionssterblichkeit auf etwa 1 Prozent. Mittlerweile sind viel mehr Daten aus viel mehr Ländern verfügbar. Und – sie haben diese frühen Schätzungen untermauert. Bei Influenzaviren, welche die Grippe verursachen, liegt der obere Bereich der Sterberate bei 0,1 Prozent.
Natürlich variieren die Zahlen, die man verschiedenen Studien entnehmen kann. Denn es sterben prozentual mehr Menschen, wo mehr ältere Menschen wohnen oder wo der Weg zum Spital weiter ist – oder wo das Gesundheitssystem überlastet ist.
Es gibt also bei Covid-19 wie bei der Grippe eine gewisse Bandbreite der Sterberaten. Und wir sitzen noch mitten im Pandemie-Schlamassel – «präzise Werte werden wir erst berechnen können, wenn wir viel mehr Daten haben», sagt Epidemiologe Marcel Salathé. «Aber wie und wo auch immer man es betrachtet: Die Sterberate ist bei Covid-19 rund zehnmal höher als bei der Grippe.»
Man sieht das zum Beispiel an der sogenannten Übersterblichkeit: Im Frühling 2020 gab es in der Schweiz – und in zahlreichen anderen Ländern – viel mehr Todesfälle, als aufgrund von Vergleichen mit anderen Jahren zu erwarten gewesen wären:
Trotz Lockdown: Hohe Übersterblichkeit im April
Anzahl Todesfälle pro Woche
Quelle: Bundesamt für Statistik. Unter die Übersterblichkeit fallen möglicherweise nicht ausschliesslich Covid-19-Todesfälle, sondern etwa auch Menschen mit einem Herzinfarkt, die wegen Covid-19 einen Spitalbesuch hinauszögerten. In der Schweiz entspricht die Zahl der Übersterblichkeit fast der Zahl der Covid-19-Todesfälle. In den Wintern 2015 und 2017 gab es starke Grippewellen.
Nebst verschiedenen Kennzahlen zur Sterberate gibt es unterdessen zahllose Berichte und Bilder aus der ganzen Welt, die anschaulich illustrieren, wie heftig dieses Virus auf die Menschen und die Gesundheitssysteme trifft. Zum Beispiel vom gekühlten Lastwagen, der in New York vor einem Spital stand: Im Gebäude gab es nicht mehr genügend Lagerkapazität für die Leichen der verstorbenen Covid-19-Patienten. Oder von den Massengräbern, die im Amazonasgebiet für Corona-Tote ausgehoben wurden.
7. Wären die meisten dieser Personen nicht so oder so bald gestorben – wenn nicht an Covid-19, dann an etwas anderem?
Die meisten Verstorbenen, Sie haben es weiter oben gelesen, sind alt und leiden zudem an einer Vorerkrankung. Sagen wir, eine 92-Jährige mit einer Herzerkrankung stirbt an Covid-19. Was ist nun schuld an ihrem Tod: das Virus – oder ihr Herz?
Ob jemand auch ohne das Virus bald gestorben wäre, werden wir wohl nie genau wissen. Aber es gibt Schätzungen. An solchen haben sich Forscher der Universität Glasgow in Zusammenarbeit mit der schottischen Gesundheitsbehörde versucht. Sie verglichen anhand von Daten aus Italien und Grossbritannien das Sterbealter von Covid-Patienten mit der generellen Lebenserwartung, wie sie die WHO berechnet. Und kamen zum Schluss: Wer 80 oder älter und gesund ist, verliert im Schnitt über 10 Lebensjahre, wenn er an Covid-19 erkrankt und stirbt. Bei drei Vorerkrankungen verliert er ungefähr 6 Jahre.
Die Studie, die noch kein Peer-Review durchlaufen hat, hat aber auch Limitationen, wie die Autoren selber zugeben. Massgeblich für die Lebenserwartung ist zum Beispiel, wie schwer eine Grunderkrankung ist. Dazu fehlen jedoch die Daten. Genauso ist aufgrund einer dünnen Datenlage unklar, wie stark gewisse Grunderkrankungen miteinander korrelieren, sich zum Beispiel verstärken und damit die Lebenserwartung nochmals senken. Doch auch wenn man annehme, sie korrelierten stark: An den erwarteten Lebensjahren ändere sich kaum etwas, schreiben die Forscher.
Auch das britische Office for National Statistics hat sich die Todesfälle genauer angesehen. Bei den fast 4000 Menschen, die in England und Wales im März mit Covid-19 verstorben sind, kommen die Statistiker zum Schluss: In 86 Prozent der Fälle war nicht eine Grunderkrankung, sondern das Virus die grundlegende Todesursache. Dies zeigten die Einträge der behandelnden Ärztinnen. 9 von 10 Verstorbenen litten jedoch an mindestens einer weiteren Erkrankung, was einen tödlichen Verlauf wahrscheinlicher machte.
8. Wie stark ist die berüchtigte Kurve in der Schweiz abgeflacht?
Hier können wir beherzt schreiben: stark.
Egal, ob man die Zahl der positiv Getesteten, den Anteil positiver Tests oder die Todesfälle betrachtet – man sieht in den Daten das Muster einer Schweiz, welche die Epidemie bremsen konnte. Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle pro Tag liegt seit rund einer Woche im zweistelligen Bereich, im März dagegen waren es oft vierstellige Werte.
Wissenschaftler beschreiben das Tempo, mit dem sich ein Virus verbreitet, wenn keinerlei Massnahmen das Virus eindämmen, mit dem Wert R0: Eine infizierte Person steckt im Schnitt R0 weitere Personen an. Bei Sars-CoV-2 liegt R0 gemäss Schätzungen aus der Wissenschaft zwischen 2 und 3.
Dieser Reproduktionswert verändert sich aber mit Hygiene- oder Distanzmassnahmen. Von da an nennen wir ihn Rt.
Ist Rt > 1, verbreitet sich die Epidemie exponentiell.
Ist Rt = 1, bleibt sie konstant.
Und ist Rt < 1, geht ihre Verbreitung zurück. Das peilen wir an, seit uns das Coronavirus im Februar hochgeschreckt hat.
Modelle von verschiedenen Forschungsgruppen zeigen nun:
Rt ging schon vor dem «Lockdown light» zurück – als der Bundesrat zu Social Distancing und zum Händewaschen aufgerufen sowie Grossveranstaltungen untersagt hatte.
Rt stabilisierte sich aber erst während des Lockdown unter 1.
Das ist nicht weiter erstaunlich: Man weiss aus verschiedenen Studien, dass etwa das Händewaschen die Verbreitung von Atemwegserkrankungen verringern kann – um 6 bis 44 Prozent. Mit zusätzlichen Massnahmen und dem Lockdown ging aber die Verbreitung von Sars-CoV-2 noch stärker zurück: In Grossbritannien vermutlich um mehr als 70 Prozent, in der Schweiz um mehr als 80 Prozent.
Wie weit liegt nun Rt unter 1? Und steckt das Händewaschen oder geschlossene Schulen dahinter?
Das ETH-Team um die Biostatistikerin Tanja Stadler errechnet Anfang April ein Rt von 0,6–0,8. Das Team der Universität Bern um den Epidemiologen Christian Althaus kommt am 24. April auf ein Rt von 0,2–0,5. Und ein Bericht des Imperial College London kommt für die Schweiz zum Schluss, dass Rt von gut 3 Anfang März während des Lockdown auf unter 1 sank. (Wissenschaftlich begutachtet wurde nur die ETH-Studie.)
Die Teams modellieren diese Werte aufgrund verschiedener Datensätze, Kennzahlen und Methoden, und so unterscheiden sich ihre exakten Schätzwerte für Rt. Aber es sind eben Schätzwerte. Wichtig (und hilfreich) ist, dass sie zu derselben Schlussfolgerung kommen: Der Reproduktionswert sank vor dem Lockdown, während des Lockdown sank er unter 1.
Welche Massnahme wie viel genützt hat, ist sehr schwierig zu ermitteln. Insbesondere, da viele Massnahmen gleichzeitig eingeführt wurden und man die Situationen nicht wie bei einem Experiment einfach wiederholen kann. Epidemiologe Salathé sagt aber, es sei klar geworden, dass das Bewusstsein für Handhygiene und Social Distancing schon viel bewirkt habe.
9. Okay, die Kurve ist abgeflacht. Wie schwer hat es die Spitäler nun getroffen?
Aus der Deutschschweiz, der Romandie und aus dem Tessin bekommen wir dieselbe Antwort: nicht so schwer, wie wir befürchtet hatten.
Beim Inselspital Bern habe man, wie uns die Medienstelle schreibt, «keine eigentliche Welle erlebt, wie sie vorhergesagt worden war». Auch im Zürcher Unispital liess sich die Situation «gut bewältigen». Seit Ende April hat man gemäss der Medienstelle wieder begonnen, eigens eröffnete Covid-Stationen zu schliessen und in den Normalbetrieb überzugehen.
Auch in der Nordwestschweiz zieht die Direktion eine günstige Bilanz: Die Kapazitäten wurden nicht überstrapaziert. «Dank den Massnahmen des Bundesrates, inklusive der Absage der Fasnacht», wie uns der ärztliche Direktor des Unispitals Basel, Christoph A. Meier, schreibt. Seit der zweiten Aprilhälfte habe sich die Situation entspannt.
Gleiches aus Genf. Waren Anfang April – «am Höhepunkt der Krise» – noch 424 Covid-Patienten im Unispital hospitalisiert, sind es Ende April nur noch 272. Auf der Intensivstation hat sich die Patientenzahl inzwischen um mehr als zwei Drittel verringert.
Das Tessin hat es, gemessen an der Bevölkerungszahl, am schwersten getroffen. Und es sei knapp geworden, sagt Paolo Merlani, Chef der Intensivmedizin in den Kantonsspitälern, zur Republik: «Der Höhepunkt war am 28. März: Von 100 Intensivplätzen waren noch 6 frei, und am Vortag allein waren 15 Patienten hinzugekommen.» Von da an nahm die Zahl der Covid-Patienten glücklicherweise ab. «Wäre der Lockdown nur zwei Tage später gekommen, hätten wir das Limit überstiegen», sagt Merlani.
Seit drei Wochen sei die Situation im Südkanton etwas entspannter. Im Moment lägen nur 10 Patienten auf der Intensivstation, sagt Merlani Mitte Mai. Man laufe im Moment fast wieder im Normalbetrieb. Die Krisenstruktur, die man sich in den Spitälern wegen der Pandemie aufgebaut habe, bleibe momentan aber noch bestehen. Wegen einer möglichen zweiten Welle. Aber dazu mehr bei der nächsten Frage.
Thierry Fumeaux, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin, bestätigt das Echo aus den Spitälern. Und sagt zudem: «Wir waren nicht überwältigt, weil wir entsprechende Massnahmen getroffen haben, die eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern sollten. Wir haben ein gut ausgebautes Gesundheitssystem, wir haben Handlungsspielraum. Deshalb konnten wir uns anpassen und vorbereiten.»
Sein Fazit: «Wenn wir die Kapazitäten nicht erhöht und die Anzahl der elektiven Eingriffe nicht reduziert hätten, wären wir überfordert gewesen.»
10. Wie geht es jetzt weiter – kommt mit den Lockerungen eine zweite Welle?
Das kann noch niemand genau sagen. Denn falls die Ansteckungen seit dem vergangenen Montag (mit den vielen Lockerungen) wieder zunehmen, wird das erst verzögert in den Daten sichtbar werden.
Modelle von Forschenden der EPFL und der Johns Hopkins University zeigen, wie schwierig es werden könnte, Rt < 1 auch nach den Lockerungen beizubehalten. Aber trotz verschiedener Datensätze und Kennzahlen, trotz verschiedener Modellierungsmethoden und trotz jahre- oder jahrzehntelanger Erfahrung sind bei Prognosen auch Epidemiologinnen unsicher. Auch sie berufen sich auf Bauchgefühl oder Hoffnung:
«Ich habe da ein mulmiges Gefühl», sagte etwa Tanja Stadler, Biostatistikerin an der ETH, vor einer Woche in der Sendung «10 vor 10».
Marcel Salathé ist etwas optimistischer. Am Sonntag vor einer Woche – bevor dann am Montag schweizweit Schulen, Restaurants und Ladengeschäfte wieder öffnen sollten – sagte er zur Republik: «Ich begrüsse diese Öffnung, in der Hoffnung, dass die Schutzkonzepte greifen.»
Der Lockdown habe wirklich gut funktioniert, die Fallzahlen seien rapide gesunken. «Es sollte also – hoffentlich – gut kommen, wenn die Kantone das momentan noch analoge Contact-Tracing bewältigen können und wenn sich die Menschen weiterhin an Hygieneregeln und physische Distanz halten.»
Aber wie die Taskforce, die den Bund in Sachen «Daten und Modellierung» berät, wie die EPFL-Forschenden und wie Tanja Stadler treibt ihn der Gedanke an eine zweite Welle um. Dieses Szenario wäre sehr unangenehm, sagt er, «ich hoffe sehr, dass wir da nicht hineingeraten». Denn eine zweite Welle bedeutet:
entweder erneut einschneidende Massnahmen, um die noch nicht infizierten Personen zu schützen,
oder eine Überlastung des Gesundheitssystems und viele, viele Todesfälle.
Natürlich wollen auch die Epidemiologen die sogenannte Herdenimmunität erreichen, mit der die Epidemie abklingt. «Die Frage ist, wie», sagt Salathé, und da seien sich die meisten einig: «Durch Impfung, nicht durch unkontrollierte Infektionen. Rt muss unter 1 bleiben.»
11. Soll ich mir eine Maske kaufen oder basteln?
Das ist wohl eine der umstrittensten Fragen seit Ausbruch der Pandemie. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, was wir in unserem ersten Explainer geschrieben haben: Eine Maske ist wenig sinnvoll, weil sie Sie kaum schützt.
Lagen wir falsch?
Die WHO sagte damals und sagt auch heute, dass Menschen, die selbst nicht erkrankt sind, keine Maske tragen müssen. Ausser sie kümmern sich um einen Covid-Patienten. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC stimmte zu – bis zum 3. April. Dann revidierte sie ihre Direktive und riet zur Maske. Weil die WHO an ihrer Haltung festhielt, trotz Kritik aus Fachkreisen, wurde sie in den vergangenen Monaten hart gescholten.
Und so gilt in vielen Ländern weltweit heute eine Maskenpflicht, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr oder in Geschäften. In der Schweiz bleiben solche Vorschriften für die breite Öffentlichkeit bisher aus. Das Tragen einer Maske kann jedoch bei gewissen Dienstleistungen, bei denen ein Abstand von zwei Metern nicht gewahrt werden kann – bei einem Coiffeurbesuch zum Beispiel – Pflicht sein.
Ob Pflicht oder nicht: Schützt mich eine Maske denn jetzt vor einer Ansteckung?
Für viele Epidemiologen, darunter auch Marcel Salathé von der EPFL, ist nun klar: Wenn das Tragen einer Maske andere Menschen vor einer Ansteckung schützt, und sei es auch nur zu einem geringeren Prozentsatz, kann das in einer Pandemie nur von Vorteil sein.
Und weil bis zu einem Viertel aller Erkrankten keine oder noch keine Symptome zeigen, diese Menschen aber trotzdem bereits ansteckend sind, kann schon eine einfache Zugfahrt zum russischen Roulette werden: Ist mein Sitznachbar vielleicht krank und weiss er es einfach nicht?
Sollen Sie nun also nur noch mit einer Gesichtsmaske Ihr Haus verlassen? Sie müssen es nicht. Aber vielleicht ist ein Mundschutz für eine Reise im vollen Zug nicht die schlechteste Idee.
12. Gibt es ein Medikament, das gegen Covid-19 hilft?
Es ist wie so oft in der Corona-Pandemie: So genau weiss man das bisher nicht. Manche Studien zeigen, dass eine gewisse Therapie anschlägt. Andere widersprechen. Das ist per se nichts Ungewöhnliches. Speziell nicht, wenn es sich um ein neues Phänomen handelt, zu dem die Welt schnell viele Informationen benötigt.
Was wir wissen: Insgesamt werden gemäss dem Milken Institute zurzeit über 200 Behandlungen auf ihre potenzielle Wirkung gegen das Coronavirus untersucht. Die Spannbreite reicht von Stammzellentherapien über Blutplasmainfusionen bis hin zu antiviralen Medikamenten. Einige der vielversprechendsten Arzneien hat die WHO für ihre globale klinische Studie «Solidarity» ausgewählt.
Teil der Studie ist das Medikament Remdesivir des amerikanischen Biotech-Unternehmens Gilead. Remdesivir war ursprünglich zur Behandlung von Ebola und Hepatitis entwickelt worden. Bei diesen Erkrankungen hatte sich das Medikament jedoch praktisch wirkungslos gezeigt. Umso grösser ist die Hoffnung von Forschern bei Covid-19: In früheren Labortests mit anderen Coronaviren hatte sich Remdesivir als Virenkiller offenbart.
Eine landesweite, nicht peer-reviewte Studie in den USA zeigte kürzlich, wie das Medikament auch bei schwer erkrankten Covid-Patienten tatsächlich anschlug. Wenn auch nicht so gut, dass es die Todesrate statistisch signifikant verringert hätte. In einer anderen Studie an Patientinnen in China, publiziert Ende April im renommierten Wissenschaftsmagazin «The Lancet», zeigte sich Remdesivir hingegen wirkungslos. Am 1. Mai hat die US-Arzneimittelbehörde FDA das Medikament trotz allem notfallmässig zur Behandlung von Covid-19 zugelassen. Auch in der Schweiz darf das Medikament in Notfällen verschrieben werden. Die Wirkung bleibt umstritten.
Ein weiteres potenzielles Medikament ist Hydroxychloroquin. Das Medikament wurde ebenfalls von der FDA zur Behandlung von Covid-19 zugelassen und ist Teil der WHO-Studie. Über keine potenzielle Covid-Behandlung ist in den vergangenen Wochen mehr berichtet worden. US-Präsident Donald Trump hat das Malariamedikament – trotz Einwänden seines Chef-Immunologen Anthony Fauci – als game changer betitelt. Sein brasilianischer Amtskollege Jair Bolsonaro tat es ihm gleich.
Und dennoch gilt auch hier: Ob Hydroxychloroquin gegen Covid-19 hilft, ist bis heute unklar. Die Hoffnungen auf das Medikament stammen primär, wie bei Remdesivir, aus einer Laborstudie. Oder aus klinischen Studien von zweifelhafter Methodik und mit zu wenigen Patienten, um wirklich aussagekräftig zu sein.
Eine Studie in Brasilien mit Hydroxychloroquin musste Ende April sogar abgebrochen werden: Covid-Patientinnen waren verstorben, nachdem man ihnen hohe Dosen des Medikaments in Kombination mit einem Antibiotikum verabreicht hatte. Wegen vermehrter Meldungen zu Herzrhythmusstörungen nach der Einnahme warnt inzwischen auch die FDA Ärztinnen davor, das Medikament ausserhalb eines Spitals oder einer klinischen Studie zu verabreichen.
In neueren, nicht peer-reviewten Studien zeigte das Medikament keine Wirkung gegen Covid-19.
Im Rennen um ein Medikament mahnen Experten zur Geduld: Es muss weitere Studie geben, die Therapien müssen in verschiedenen Stadien der Krankheit verabreicht werden und an andere Patientengruppen. Erst dann werden wir wissen, ob eine Behandlung tatsächlich ein game changer ist.
13. Ich hatte Covid-19 und bin wieder gesund. Bin ich jetzt immun?
Das kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt niemand mit Sicherheit beantworten.
Schritt zurück: Wer sich mit einem Virus infiziert hat, dessen Immunsystem produziert meistens Antikörper. Und zwar verschiedene Typen von Antikörpern zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf der Krankheit. Manche bleiben auch dann im Blut, wenn die Infektion vorbei ist, und erkennen künftig das Virus, das sie ausgelöst hatte. Manche davon wiederum neutralisieren künftig das Virus (das heisst, sie hindern das Virus daran, sich in den menschlichen Zellen zu vermehren).
Wenn alles gut geht, machen die richtigen Antikörper einen also gegen dieses Virus immun.
Wie lange? Das hängt vom Virus ab. Die Spannbreite reicht von gar nicht bis lebenslang.
Und bei Sars-CoV-2? Das werden wir erst noch herausfinden müssen. Wissenschaftler hoffen aufgrund ihrer Erfahrung mit verwandten Coronaviren, dass man nach einer Infektion mindestens ein Jahr immun ist. Aber es wird viel Zeit vergehen, bis sie solche Aussagen mit mehr Sicherheit treffen können.
Vielleicht haben auch Sie von Patientinnen gelesen, die neu infiziert wurden, nachdem sie von Covid-19 geheilt waren. Das wäre eigentlich Evidenz gegen die Annahme, dass man nach einer Heilung immun ist – hat aber vermutlich mit falschen Testresultaten zu tun:
Ein erster (positiver) Test hat bei diesen Patientinnen die Infektion bestätigt.
Ein zweiter (negativer) Test hat die Heilung bestätigt.
Ein dritter (positiver) Test hat die Reinfektion bestätigt.
Aber das zweite Testresultat war in diesen Fällen vermutlich falsch, denn die Rate der falschen negativen Resultate (der Test sagt, man sei gesund, in Wahrheit ist man aber infiziert) dürfte bei Covid-19-Tests besonders hoch sein.
14. Warum sind wir nicht längst mit Antikörpertests und Immunitätsnachweisen versorgt?
Antikörper kann man nachweisen: Serologische Tests messen sie im Blut. Mithilfe dieser Tests kann man abschätzen, welcher Anteil der Bevölkerung das Coronavirus schon hatte. Und – so hofft man – herausfinden, ob eine bestimmte Person schon infiziert war.
Aber – was Sie langsam nicht mehr überraschen dürfte – so einfach ist das nicht.
Nicht alle Serologietests erwischen dieselben Typen von Antikörpern. Und nicht alle geben an, wie stark die Antikörper einer Person sind. Findet der Test also Antikörper, so weiss man nicht, ob diese lediglich dazu da sind, das Virus zu erkennen, oder ob sie seine schädliche Wirkung schmälern können – oder es gar komplett ausschalten. Hinzu kommt das Problem mit der Zuverlässigkeit:
Viele Tests sind auf dem Markt, aber die meisten davon sind zu ungenau. Sie müssten sensitiver sein, oder spezifischer. Dazu gleich mehr.
Stellen Sie sich vor, Sie liessen sich heute testen. Vier Situationen sind möglich:
Sie haben Antikörper, und der Test zeigt sie an (richtiges positives Resultat).
Sie haben keine Antikörper, aber der Test zeigt welche an (falsches positives Resultat).
Sie haben Antikörper, aber der Test zeigt keine an (falsches negatives Resultat).
Sie haben keine Antikörper, und der Test zeigt auch keine an (richtiges negatives Resultat).
Ein sensitiver Test identifiziert so häufig wie möglich das, was er identifizieren soll – in diesem Fall Antikörper gegen Sars-CoV-2. Bei einer Sensitivität von 98 Prozent identifiziert ein Test 98 Prozent derer, die das Virus schon hatten, als (richtiges) positives Resultat. Aber 2 Prozent identifiziert er fälschlicherweise als negativ.
Ein spezifischer Test erwischt das, was er nicht identifizieren soll, möglichst selten als Beifang – etwa Antikörper, die durch eine Erkältung von einem anderen Coronavirus, also nicht Sars-CoV-2, herrühren. Ein zu 95 Prozent spezifischer Test identifiziert 95 Prozent derer, die das Virus noch nicht hatten, als (richtiges) negatives Resultat. Aber 5 Prozent identifiziert er fälschlicherweise als positiv.
98 Prozent sensitiv und 95 Prozent spezifisch, das klingt erst mal nicht schlecht. Tatsächlich produziert ein solcher Test fast so viele falsche wie richtige positive Resultate – wenn wir annehmen, dass sich bisher 5 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit Sars-CoV-2 infiziert haben.*
* Wir testen 10’000 Schweizerinnen und Schweizer (500 davon waren bisher infiziert, 9500 noch nicht). Wir erhalten:
– 0,98 × 500 = 490 richtige positive Resultate
– 0,05 × 9500 = 475 falsche positive Resultate
– 0,02 × 500 = 10 falsche negative Resultate
– 0,95 × 9500 = 9025 richtige negative Resultate
Das ist typisch für Tests auf wenig verbreitete Krankheiten wie etwa HIV-Tests: Je niedriger die Infektionsrate, desto grösser die Verzerrung durch falsche positive Resultate.
Mit einem falschen negativen Resultat würden Sie sich vermutlich vorsichtiger verhalten als nötig. Mit einem falschen positiven Resultat aber würden Sie sich wahrscheinlich so verhalten, als wären Sie immun – nur sind Sie es nicht. Das ist, gelinde gesagt, nicht ideal.
Wenn Wissenschaftler eine repräsentative Stichprobe testen, um die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung zu ermitteln, dann können sie solche Effekte herausrechnen. Aber für Entwarnungen bei Einzelpersonen sind präzisere Tests notwendig. Nur sind die meisten Tests auf dem Markt weniger zuverlässig als unser fiktiver Test. Die WHO warnt noch vor Serologietests und empfiehlt, sie lediglich in der Forschung und für das Monitoring der Krankheit in der Bevölkerung anzuwenden – nicht aber um die mögliche Immunität von Einzelpersonen zu testen.
Nun will aber das Schweizer Pharmaunternehmen Roche noch im Mai einen Test auf den Markt bringen, der gemäss dem CEO sehr spezifisch (99,8 Prozent) und maximal sensitiv (100 Prozent) ist. Damit wäre das Risiko von falschen Positiven bedeutend niedriger als bei Tests von Konkurrenten.
15. Wann wird es einen Impfstoff geben?
Gemäss dem Milken Institute, einem kalifornischen Thinktank, sind zurzeit über 100 Projekte weltweit im Gang, um einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 zu entwickeln. Acht potenzielle Antigene werden zurzeit an Menschen getestet. Am weitesten fortgeschritten ist das Team um den Vakzinologen Adrian Hill am Jenner Institute der Universität Oxford.
Die Gruppe hat bereits im April mit der klinischen Phase, also mit Tests an Menschen, begonnen. Dank vorhergehender Forschung konnten sie den Entwicklungsprozess massiv beschleunigen. Bereits bis Ende Mai sollen 6000 Erkrankte den Impfstoff gespritzt bekommen. Ein Versuch mit Rhesusaffen in den USA hat bereits im März vielversprechende Ergebnisse geliefert: Alle sechs Affen blieben gesund, obwohl sie dem Virus in hohen Dosen ausgesetzt waren. Sollte in den kommenden Testphasen alles gut gehen und die Behörden eine Notfallgenehmigung erlassen, könnte der Impfstoff bereits im September erhältlich sein, sagen die Forscher.
Auch ein Schweizer schürt zurzeit weltweit Hoffnung. Martin Bachmann, Immunologe am Berner Inselspital, will im Oktober seinen Impfstoff unter die Leute bringen. Die Phase der klinischen Tests soll im Juli beginnen. Ein entsprechendes Gesuch dafür sei noch nicht eingegangen, sagt die Zulassungsbehörde Swissmedic. Martin Bachmann hat auf eine Anfrage der Republik bisher nicht geantwortet.
Ob wir bereits dieses Jahr einen Impfstoff auf dem Markt haben werden, bleibt, allen Beschleunigungen zum Trotz, ungewiss. Wenn die Testphasen nicht die gewünschten Ergebnisse liefern, beginnt der Entwicklungsprozess von vorne. Und die Erfolgsrate bei klinischen Tests liegt bei unter 10 Prozent. Namhafte Vertreter der Pharmabranche, darunter Roche-CEO Severin Schwan oder Emma Walmsley, Chefin des weltweit grössten Impfstoff-Herstellers GlaxoSmithKline, rechnen weiterhin nicht mit einem Impfstoff vor 2021.
16. Zum Schluss zurück zum Start: Weiss man inzwischen, woher das Virus stammt?
Räumen wir das Wichtigste gleich zu Beginn aus dem Weg: Mit der grössten Wahrscheinlichkeit ist dieses Virus nicht von Menschen künstlich geschaffen worden.
Gegen die Theorie, wonach Sars-CoV-2 eine menschengemachte Biowaffe sein soll, arbeitet eine Armada an Wissenschaftlerinnen seit Monaten an. So zeigt unter anderem eine im Magazin «Nature» publizierte Studie des Immunologen Kristian Andersen und seines Teams am Scripps-Forschungsinstitut: Die stachelförmigen Proteine an der Aussenwand des Virus, die sogenannten Spikes, binden es nicht optimal an die Wirtszelle. «Das ist ein starker Beweis dafür, dass Sars-CoV-2 nicht das Produkt einer gezielten Manipulation ist», schreiben die Forscher. Ein Team an der Universität von Ohio kommt zum selben Schluss: Das Genom des Virus zeige keine Hinweise auf eine genetische Modifizierung. Und auch das Direktorium der Nationalen Geheimdienste der USA schreibt: «Die Geheimdienst-Community geht mit dem breiten wissenschaftlichen Konsens überein, dass das Covid-19-Virus nicht menschengemacht oder genetisch modifiziert ist.»
Also, woher kommt das Ding?
Bisher deutet vieles auf Fledermäuse als wahrscheinlichsten Ursprung von Sars-CoV-2 hin. Das Virus-Genom entspricht zu 96 Prozent jenem von RaTG13, einem für Menschen ungefährlichen Erreger, den Forscher 2013 bei Fledermäusen identifiziert haben. Wenn auch die 4 Prozent Unterschied von wesentlicher Bedeutung sind – aber dazu später.
Virologinnen gehen nun davon aus, dass das Virus über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergesprungen ist. Wo dieser Übersprung geschah, ist nicht vollständig geklärt. Da ein grosser Teil der ersten offiziell Erkrankten in China im Dezember 2019 Kontakt zum Fischmarkt in Wuhan gehabt hat, war er in den Fokus von Behörden und Wissenschaft gerückt. Jüngere Berichte zeigen jedoch, dass das Virus möglicherweise bereits im November zirkulierte. Stammte das Virus also gar nicht vom Fischmarkt? Auf der Suche nach dem ersten Erkrankten, dem Patienten 0, wurde rasch eine neue Theorie geboren: Das Virus ist einem Labor in Wuhan entsprungen.
In Wuhan stehen zwei Labore, in denen an Coronaviren geforscht wird: Das Wuhan Center for Disease Control and Prevention und das Institut für Virologie, kurz WIV. Ersteres befindet sich in der Schutzstufe 2 für Laboratorien, die an biologischen Stoffen forschen. Letzteres – als einziges Labor in China – in der Schutzstufe 4, der höchsten überhaupt. Das WIV hatte unter anderem am Fledermauserreger RaTG13 geforscht.
Ist bei den Arbeiten etwas schiefgelaufen? Konnte das Virus im Labor auf eine Forscherin überspringen und hat diese es in die Welt getragen?
Vertreter der sogenannten Labor-Theorie – darunter US-Präsident Donald Trump und sein Aussenminister Mike Pompeo – sehen sich unter anderem durch die «Washington Post» unterstützt: US-Diplomaten hätten 2018 auf Sicherheitsmängel im WIV hingewiesen, zeigten verschlüsselte Telegramme, die der Zeitung vorlagen.
Mindestens zwei wichtige Argumente sprechen nun gegen die Labor-Theorie:
Sars-CoV-2 entspricht zu 96 Prozent dem Fledermausvirus RaTG13, an dem in Wuhan geforscht wurde. Das klingt nach viel, in Wahrheit sind die 4 Prozent Unterschied jedoch wesentlich. Gemäss dem Virologen Edward Holmes von der Universität Sydney kommen sie einer evolutionären Entwicklung von mindestens 20 Jahren gleich. Will sagen: Die beiden Viren liegen Jahrzehnte auseinander. Und RaTG13 ist damit nicht der, wenn man so will, direkte Vorfahre von Sars-CoV-2.
Es gibt bis heute auch keinen Beweis dafür, dass die Forscher im Institut für Virologie in Wuhan an einem Virus geforscht haben, dessen Genom sich mit dem von Sars-CoV-2 deckt. Forscher des Instituts und die chinesischen Behörden haben das bestätigt. Auch zahlreiche ausländische Kolleginnen, die das Labor kennen, sehen keinen Grund für eine solche Annahme.
Das alles macht die Labor-Theorie zwar nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich.