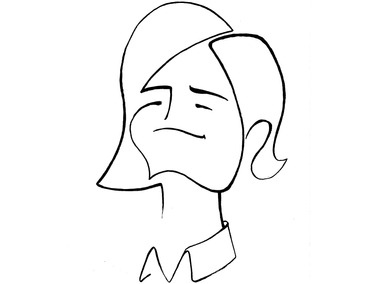
Risikoangst schlägt Rechtsstaat
Der Fall Mike zeigt: In der Strafjustiz wird der Präventionsgedanke immer wichtiger. Die Motive dafür sind legitim – die Folgen hoch problematisch.
Von Daniel Binswanger, 09.11.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Diesen Mittwoch wurde Mike zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 9 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 10 Franken verurteilt. Er wird zum Subjekt stationärer therapeutischer Massnahmen werden, also eine «kleine Verwahrung» antreten. Seine Prognose ist düster. Die Republik-Kolleginnen Brigitte Hürlimann und Elia Blülle haben sich mit der gebotenen Dossierkenntnis mit dem Fall von Mike auseinandergesetzt – nicht nur mit der Strafsache, über die nun ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist, sondern mit der ganzen schwierigen und den jungen Mann bis heute prägenden Geschichte seiner Kindheit und Adoleszenz. Dieser Aufarbeitung des Falls ist nichts hinzuzufügen.
Aber Mikes Geschichte steht nicht nur für die Tragödie eines jungen Wiederholungstäters, der das Schweizer Justizsystem an seine Grenzen bringt. Sie steht auch für den fundamentalen Wertewandel, den das allgemeine Rechtsempfinden in den vergangenen zwanzig, dreissig Jahren durchgemacht und der die Rechtspraxis verändert hat. Beispielhaft steht sie dafür, dass wir heute bereit sind, tragende Säulen moderner Rechtsstaatlichkeit stark zu relativieren – wenn nicht ein Stück weit einfach aufzugeben.
Die Strafjustiz unterliegt zunehmend einem Paradigmenwandel: von der Strafe zur Prävention. Immer stärker wird das Bedürfnis, nicht nur begangene Straftaten mit staatlichen Zwangsmitteln zu sanktionieren, sondern dem Risiko, dass Straftaten überhaupt begangen werden könnten, mit allen Mitteln vorzubeugen. Zwar ist das zeitweilige Aus-dem-Verkehr-Ziehen überführter Delinquenten auch im klassischen Strafrecht eine der Funktionen des Freiheitsentzugs. Von der Sanktion für begangenes Unrecht wird es jedoch nicht getrennt.
Mittlerweile ist die Sanktion jedoch nur noch eine Teilaufgabe der Strafjustiz. Mindestens so wichtig wird das Wegsperren von potenziellen Tätern. Die Rekonstruktion eines Tatherganges kann für den Freiheitsentzug faktisch weniger relevant sein als die Prognose der Therapiefähigkeit. Die Beweisführung des Staatsanwalts kann weniger Gewicht haben als das Gutachten des Psychiaters. Strafjustiz war im Kern immer eine Form der Vergangenheitsbewältigung. Heute verhandelt sie mehr und mehr die Zukunft.
Natürlich sind die Gründe für diese Entwicklung bestens nachvollziehbar und an sich legitim. Es geht darum, Wiederholungstäter in Schach zu halten und Rückfälle möglichst zu unterbinden. Gerade bei Schwerstdelikten wie Vergewaltigungen und Tötungsdelikten ist einsichtig, dass der Schutz potenzieller Opfer als erste Priorität des staatlichen Handelns betrachtet wird. Erklärungsbedürftig ist allerdings, weshalb in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten die Dringlichkeit dieser Schutzmassnahmen plötzlich massiv höher bewertet wird.
In den meisten westlichen Ländern ist es seit den 1990er-Jahren zu einer Verschärfung und häufigeren Anwendung präventiver Massnahmen wie der Verwahrung gekommen. In Frankreich beispielsweise hat Nicolas Sarkozy, der schon als Innenminister Massnahmen zur Fichierung und Überwachung von Pädophilen ergriff, gegen stärkste verfassungsrechtliche Bedenken die rétention de sûreté eingeführt – eine Verwahrung auf Lebenszeit von als gefährlich erkannten Sexualstraftätern. Gerhard Schröder prägte 2001, als er zur gesetzlichen Verschärfung der Sicherungsverwahrung für Sexualstraftäter befragt wurde, sein berühmt-berüchtigtes «Wegschliessen – und zwar für immer». In den USA verbreiteten sich in den 1990er-Jahren die öffentlich zugänglichen Register von sex offenders. Und die Schweizer Justizlandschaft? Sie wurde seit den 1990er-Jahren aufgrund des abscheulichen Mordes von Erich Hauert an der Pfadiführerin Pasquale Brumann und des messianischen Wirkens des Zürcher Gerichtspsychiaters Frank Urbaniok vollkommen umgepflügt. Mit aller Entschiedenheit – aber eigentlich nur dem Zeitgeist folgend.
Dass Regierungen ihre Bürger vor schweren Gewalt- und Sexualstraftaten schützen wollen und dass die Bürger diesen Schutz einfordern, ist legitim. Zwar wird in der juristischen Sprachregelung zwischen Strafe und Massnahme streng unterschieden. Die Prävention kann nur psychiatrisch begründet werden und soll deshalb von einer strafrechtlichen Sanktion möglichst getrennt werden. De facto aber gehört beides zusammen: Ein Freiheitsentzug ist ein Freiheitsentzug. Für die Betroffenen macht es hauptsächlich insofern einen Unterschied, ob sie eine Strafe absitzen oder einer Verwahrung unterliegen, als es sehr viel schwieriger ist, sich gegen Letztere zur Wehr zu setzen.
Das immer stärkere Präventionsbedürfnis führt zu einer tiefgehenden Veränderung der Rechtskultur:
Einer der fundamentalsten Rechtsgrundsätze wird sang- und klanglos ausser Kraft gesetzt: Nulla poena sine lege (keine Strafe ohne Gesetz) heisst eines der wichtigsten Prinzipien aufklärerischer Rechtskultur. Nur was unter Strafe gestellt worden ist, darf auch bestraft werden. Es hat ein unmittelbares Korollar: nulla poena sine crimine (keine Strafe ohne Delikt). Nur dort, wo auch gegen ein Gesetz verstossen worden ist, darf eine Sanktion erfolgen. Alles andere ist Willkür – und genau diese Willkür ist die Gefahr der Präventionsjustiz, die sich ja um Taten dreht, welche (noch) nicht begangen worden sind.
Nicht weniger gravierend ist, dass ein zweites vermeintlich geheiligtes Prinzip unserer Rechtskultur mit Füssen getreten wird: im Zweifel für den Angeklagten. Die Präventionsjustiz verdreht es in sein exaktes Gegenteil: im Zweifel gegen den Angeklagten. Die forensische Psychiatrie kann keine gesicherten Aussagen dazu machen, ob ein Delinquent mit einschlägiger Vorgeschichte in Zukunft wieder Straftaten begehen wird oder nicht. Das Beste, was sie zu bieten hat, sind Bewertungen der Wahrscheinlichkeit (durch welchen Grad der Verlässlichkeit sich Aussagen zu Rückfall-Wahrscheinlichkeiten dann auszeichnen, sei einmal dahingestellt). Im Prinzip muss es deshalb genügen, dass Zweifel an seiner künftigen Straffreiheit bestehen, um einen Verdächtigten unbegrenzt wegzuschliessen.
Es wird ein neuer Graubereich des juristischen Ermessens geschaffen, weil die präventive Beurteilung nicht auf einem Tatbestand und seiner juristischen Beurteilung beruhen kann, sondern einschätzen muss – oder durch Experten beurteilen lassen muss –, als wie pathologisch ein Straftäter zu betrachten ist. Die harte Unterscheidung zwischen gesetzlich und ungesetzlich muss ersetzt werden durch die unscharfe Unterscheidung zwischen pathologisch und nicht pathologisch. Letztlich stellt sich die Frage, ob sich ein entlassener Straftäter einigermassen normenkonform wird verhalten können oder nicht. Das ist umso problematischer, als ja nicht nur Gewalt- oder Sexualstraftäter mit vergleichsweise klar umrissenem Gefährdungspotenzial von stationären Massnahmen betroffen sein können, sondern zum Beispiel auch Querulanten oder Delinquenten mit stark asozialem Verhalten. Die Justiz sollte sich an Gesetzen und nicht an sozialen Normen ausrichten. Dass Erstere durch Letztere überlagert werden, lässt sich im Bereich des Massnahmenvollzugs aber kaum verhindern. Michel Foucault hat bereits in den 1970er-Jahren die These entwickelt, dass in der heutigen Gesellschaft das Recht immer stärker durch nicht rechtliche soziale Normen kolonisiert werde. Die jüngere Entwicklung des Strafrechts scheint dies zu bestätigen.
Der Massnahmenvollzug dürfte im Strafrecht weiter an Terrain gewinnen. Das lässt sich auch dann als Quasi-Gewissheit bezeichnen, wenn man nicht die futurologische Diagnosefähigkeit der forensischen Psychiatrie für sich in Anspruch nimmt. Zwar gibt es keinen Grund, in Zweifel zu ziehen, dass die Schweizer Richterschaft aus Juristen besteht, die versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit Umsicht und Fairness zu handeln. Aber die Anreizstruktur ist ein fatales Problem: Ein Richter, der es unterlässt, eine Verwahrung oder eine stationäre Massnahme anzuordnen, setzt Ruf und Karriere aufs Spiel. Irgendwann wird ein Täter rückfällig werden, und man wird ihn dafür verantwortlich machen. Ein Richter hingegen, der eine Verwahrung anordnet, kann niemals eines Fehlers überführt werden. Ob ein weggesperrter Straftäter, wenn er in Freiheit gelassen worden wäre, auch keine Straftaten mehr begangen hätte, wird man niemals wissen. Dass die Richter sich für solche Entscheide auf psychiatrische Begutachtungen stützen, entschärft das Problem nur sehr begrenzt. Die Gerichtspsychiater unterliegen derselben Risikoasymmetrie.
Bereits heute lässt sich feststellen, dass der Massnahmenvollzug zunehmend auf ein unbegrenztes Wegsperren herausläuft. Zwar ist die lebenslängliche Verwahrung in der Schweiz bisher nur einmal rechtskräftig verhängt worden, aber auch Entlassungen aus der ordentlichen Verwahrung sind selten. Die extrem hitzigen Debatten um die lebenslängliche Verwahrung hätte sich die Schweiz eigentlich sparen können: De facto wird in der überwiegenden Zahl der Fälle ohnehin praktisch lebenslänglich verwahrt. Eine analoge Entwicklung lässt sich bei den stationären Massnahmen beobachten. Diese werden zwar für höchstens fünf Jahre verfügt, können aber bei Ablauf jeweils um weitere fünf Jahre verlängert werden. Strafverteidiger und selbst Gerichtspsychiater beklagen, dass immer mehr Delinquenten aufgrund einer «blossen» stationären Massnahme die Freiheit de facto unbegrenzt entzogen wird, weil einerseits nicht die Bereitschaft besteht, sie zu entlassen, andererseits aber aufgrund der Geringfügigkeit ihrer Delikte eine Verwahrung gar nicht angeordnet werden kann. Eine Präventionsjustiz mit Nullrisikomentalität kann gar nicht anders, als schwierigen Fällen mit Wegsperren zu begegnen.
Warum hat das Sicherheitsbedürfnis so massiv zugenommen? Der Fall Mike ist ohne Zweifel der schlagende Beweis dafür, dass die Medien eine verheerende Rolle spielen. Eine Justiz, die dem Diktat der letzten «Blick»-Schlagzeile unterliegt, wird unweigerlich die Vermeidung jedes Risikos zur obersten Handlungsmaxime erheben. Die Journalisten, die damals die mediale Hetzjagd antrieben, haben ihre Karrieren unbeschadet weiterverfolgt. Eine aggressive Boulevardpresse gab es allerdings auch schon in den 1970er- und 1980er-Jahren. Die gesellschaftlichen Kräfte, die den Siegeszug der Präventionsjustiz herbeigeführt haben, sind grundsätzlicher Natur.
Frappierend ist, dass ausgerechnet in den 1990er- und in den Nullerjahren, in einer Phase des Start-up-Kultes, der allgegenwärtigen Valorisierung von Risikobereitschaft und des permanenten Lobpreisens der Eigenverantwortung, im Bereich des Strafrechts eine Vollkaskomentalität voranschritt. Es liegt nahe, einen Kompensationsmechanismus darin zu erblicken.
Es war Gerhard Schröder, der mit Hartz IV die radikalste sozialpolitische Kehrtwende in der Geschichte der Bundesrepublik verantwortete, der den radikalen Rückbau staatlicher Sicherungssysteme vorantrieb – und gleichzeitig beim Ausbau der präventiven Sicherungshaft scheinbar gar keine Schranken mehr anerkennen wollte. Es war Nicolas Sarkozy, der sein politisches Kapital einsetzte, um die französische Staatsquote zurückzufahren, gleichzeitig aber die staatliche Justiz mit stark erweiterten Zwangsmitteln gegenüber Sexualverbrechern ausstattete.
Es ist kein neues Phänomen, dass die staatsskeptische Rechte den autoritären Nachtwächterstaat propagiert. In einer Welt, in der die Bürger zunehmend schutzlos den Kräften des Marktes ausgesetzt sind, soll wenigstens im Bereich der Verbrechensbekämpfung der Staat als Schutzmacht zelebriert werden.
Illustration: Alex Solman