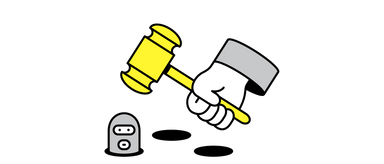
Die Basler Polizei bleibt unbelehrbar
In Polizeigewahrsam wird eine Frau gezwungen, sich vollständig auszuziehen. War das wirklich notwendig? Und vor allem: verhältnismässig?
Von Anina Ritscher, 06.03.2024
Wenn die Polizei jemanden in Gewahrsam nimmt, kann sie eine «Leibesvisitation» vornehmen. In der Strafprozessordnung steht dazu: «Die Durchsuchung von Personen umfasst die Kontrolle der Kleider, der mitgeführten Gegenstände, Behältnisse und Fahrzeuge, der Körperoberfläche und der einsehbaren Körperöffnungen und Körperhöhlen.» Mit der Massnahme soll vor allem verhindert werden, dass Menschen in Gewahrsam sich selbst oder die Beamten verletzen.
Das Bundesgericht hat sich schon mehrfach mit der Frage beschäftigt, unter welchen Umständen eine solche Untersuchung erlaubt ist.
In einem Urteil von 1991 zu einem Mann, der festgenommen und einer Leibesvisitation unterzogen wurde, nachdem er während einer Demonstration Steine in Richtung der Polizei geworfen hatte, kam das Bundesgericht zum Schluss: «Ein Abtasten hätte genügt.» Das Entkleiden sei unverhältnismässig gewesen.
In einem Fall aus dem Jahr 2014 wurde ein Mann von der Polizei mitgenommen, weil er sich gegen eine Identitätskontrolle zur Wehr gesetzt hatte. Die anschliessende Leibesvisitation war ebenfalls unverhältnismässig, fand das Bundesgericht: «Für den Ausschluss einer Selbstgefährdung hätte es (…) genügt, den Beschwerdeführer (…) über den Kleidern abzutasten und ihm gegebenenfalls den Gürtel und die Schnürsenkel wegzunehmen.»
In einem Fall aus dem Jahr 2018 hält das Bundesgericht schliesslich mit Verweis auf rechtliche Grundlagentexte fest: «Die Polizeibeamten dürfen nicht systematisch eine Leibesvisitation mit Entkleidung durchführen.» Es müsse von Fall zu Fall entschieden werden, ob die Untersuchung erforderlich sei.
Diesen höchstrichterlichen Urteilen zum Trotz zwangen drei Polizeibeamte in Basel-Stadt eine Frau in Gewahrsam dazu, sich nackt auszuziehen. Vor Gericht müssen sie sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten.
Ort: Appellationsgericht Basel-Stadt
Zeit: 6. Februar 2024, 8.30 Uhr
Fall-Nr.: SB.2021.57
Thema: Amtsmissbrauch
An einem Abend im März 2017 klingelte das Telefon bei der Kantonspolizei Basel-Stadt. Ein Mann war am anderen Ende der Leitung. Er habe sich mit seiner Ehefrau gestritten. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, und sie habe nicht nur eine Lampe zu Boden geworfen, sondern ihn auch körperlich attackiert.
Als die Polizei in der Wohnung aufkreuzte, fand sie die Ehefrau des Anrufers, Barbara Kündig (sie heisst in Wahrheit anders), in ihrem Bett, mit einem Glas Rotwein in der Hand. Die Beamten nahmen sie mit, «zwecks Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung», wie es in einem Urteil später heissen wird.
Auf dem Polizeiposten hätten zwei Polizistinnen Kündig gegen ihren Willen ausgezogen, so schildert sie es später. Laut Kündigs Aussage drückten die Polizistinnen anschliessend ihren Oberkörper nach unten oder gaben ihr einen Schubs in die Kniekehle, um den Intimbereich sehen zu können. Die Polizistinnen bestreiten diesen Hergang. Kündig sei nicht körperlich angegangen worden. Sie sagten aber später aus, «man habe auch die Körperöffnungen unten anschauen müssen».
Kündig empfand das Prozedere als reine Demütigung. Sie zeigte die Beamten wegen Amtsmissbrauchs an: den Einsatzleiter, der die Untersuchung an diesem Abend anordnete, sowie die beiden Polizistinnen, die sie durchführten.
Die Staatsanwaltschaft wollte die Sache eigentlich nicht zur Anklage bringen. Sie erliess zwei Mal eine Einstellungsverfügung. Zwei Mal reichte die Privatklägerin dagegen Beschwerde ein, und beide Male entschied das Appellationsgericht: Die Staatsanwaltschaft muss weiter untersuchen.
Sie hätten sich doch nur an die Vorschriften gehalten
So kam es im März 2021, vier Jahre nach dem Vorfall, doch noch zu einer Verhandlung vor dem Strafgericht Basel-Stadt.
Dieses musste zum einen klären, ob das Vorgehen der Polizistinnen und des Einsatzleiters verhältnismässig war. Und zum anderen, ob der Vorwurf des Amtsmissbrauchs zutrifft.
Die Staatsanwaltschaft plädierte auf Freispruch.
Die beschuldigten Polizisten rechtfertigten ihr Handeln in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung damit, «dass eine Kleiderdurchsuchung mit vollständiger Entkleidung inklusive Visionierung der Körperöffnungen zwecks Abwehr einer Selbstgefährdung zwingend notwendig sei». Denn: «Die Person könne eine Rasierklinge im Mund versteckt haben und sich damit in der Zelle etwas antun.»
Diese Begründung überzeugte das Strafgericht nicht.
Es kam zum Schluss: Das Vorgehen der Beamten sei unverhältnismässig gewesen. Es sei in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob eine solche Untersuchung notwendig und zumutbar sei. Sie sei nicht «nach Schema F» bei jeder Person in Polizeigewahrsam durchzuführen.
Angesichts der Tatsache, dass Kündig im Schlafanzug abgeholt worden sei, sei es zudem «völlig lebensfremd», davon auszugehen, sie könne eine Rasierklinge im Mund versteckt haben. Sie habe «weder Zeit noch Gelegenheit» gehabt, sonstige Substanzen oder Gegenstände in Körperöffnungen zu verstecken.
Auch die basel-städtische Dienstvorschrift hält fest: «Bei Personenkontrollen, Anhaltungen und Polizeigewahrsam ist eine vollständige Entkleidung nur dann zulässig, wenn es konkrete Verdachtsmomente und Hinweise auf eine Selbst- und Fremdgefährdung gibt und die Massnahme verhältnismässig ist.»
Demnach sei der Vorwurf des Amtsmissbrauchs, so das Strafgericht, objektiv erfüllt.
Aber: Für einen Schuldspruch müsste der Vorwurf auch subjektiv erfüllt sein. «Der Täter muss in Kenntnis seiner Sondereigenschaft bewusst die Amtsgewalt missbrauchen», wie es im erstinstanzlichen Urteil heisst.
Die drei Beschuldigten, so das Strafgericht, hätten jedoch «glaubhaft und übereinstimmend» zu Protokoll gegeben, dass sie die «geltende Dienstvorschrift befolgt» hätten. Sie hätten geglaubt, ihr Vorgehen stehe im Einklang mit dem Polizeigesetz. Es liege daher kein vorsätzliches Handeln vor. Der Schubs in die Kniekehle und das Herunterdrücken des Oberkörpers seien ferner nicht erstellt.
Die Privatklägerin Kündig legte Berufung ein, weshalb der Fall Anfang Februar dieses Jahres vor dem zweitinstanzlichen Appellationsgericht erneut verhandelt wird.
Was sagen die Beschuldigten zum Vorfall? Nichts
Ungewöhnlich viel Publikum setzt sich an diesem Tag auf die Besucherbänke des Gerichtssaals, in einem dunklen, holzvertäfelten Raum in der Basler Innenstadt. Die meisten sind Berufskollegen der Beschuldigten.
Die drei machen von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Sie sagen zum Vorfall: nichts.
Nur eine Frage des dreiköpfigen Gremiums, dem Gerichtspräsident Christian Hoenen vorsitzt, beantworten sie. Ob die basel-städtische Polizei bei Untersuchungen von Personen in Gewahrsam auch heute, rund sieben Jahre nach den hier zu verhandelnden Geschehnissen und drei Jahre nach den deutlichen Worten im erstinstanzlichen Urteil, immer noch so vorgehe wie damals?
Ohne Einzelfallprüfung?
«Ja, wir machen das immer so», sagt der Einsatzleiter. «Wir haben eine Obhutspflicht und müssen für die Sicherheit der Menschen sorgen.»
«Das heisst, das volle Programm wird immer wieder durchgezogen, egal, ob das im Einzelfall angebracht ist», stellt Hoenen fest. «Da besteht Schulungsbedarf bei der Polizei.»
Die drei Verteidigerinnen betonen, die Beschuldigten hätten «nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt», sie stuften ihr Vorgehen bis heute als verhältnismässig ein. Die Polizisten hätten in der Überzeugung gehandelt, sich an die Vorschriften zu halten. Daher könne ihnen kein bewusstes Missbrauchen der Amtsgewalt vorgeworfen werden.
Der Rechtsvertreter der Privatklägerin, Nicolas Roulet, findet das nicht einleuchtend. «Jeder denkt von seinem Verhalten, es sei verhältnismässig», sagt er in seinem Plädoyer. Das Gericht müsse aber prüfen, ob objektiv unverhältnismässig gehandelt wurde.
«Nachdem meine Mandantin zunächst nicht kooperativ war, ging es den Beamten offensichtlich darum, sie zu demütigen», sagt Roulet nach dem Verfahren im Gespräch mit der Republik. «Nach dem Motto: Der zeigen wir es jetzt!»
Das vorsätzliche Handeln der Polizisten sei erstellt.
Ganz kurz nur kommt vor Gericht das Social-Media-Profil des beschuldigten Einsatzleiters zur Sprache. Sein Auftreten dort sei «martialisch», wie Barbara Kündig in einer Befragung zu Protokoll gegeben hat. Die entsprechenden Screenshots wurden den Akten beigefügt.
Auf einem dieser Bilder ist das Auto des Polizisten zu sehen. Die Flanke ziert eine US-amerikanische Südstaatenflagge, Symbol der amerikanischen Rechten. Darunter das Hashtag «thinblueline». Eine Anspielung auf die Vorstellung, dass einzig die Polizei die Gesellschaft vor dem Abrutschen in die Barbarei schütze. Der Slogan wird oft kritisiert, weil er Polizeigewalt rechtfertige. Im Basler Berufungsprozess gegen die drei Beschuldigten spielt das alles jedoch keine Rolle.
«Nein!»
Das Dreiergericht folgt dem Urteil der Vorinstanz und kommt ebenfalls zum Schluss: Der Tatbestand des Amtsmissbrauchs sei nicht erstellt. Es fehle am Vorsatz. Zudem hätten sich die Beschuldigten mit ihrem Handeln keinen Vorteil verschafft.
Gerichtspräsident Christian Hoenen hält aber fest: Das Gericht habe eine «beispiellose Unbelehrbarkeit der drei Personen auf der Anklagebank» festgestellt. Sie hätten ausgesagt, es sei damals alles richtig abgelaufen, sie würden auch in Zukunft so vorgehen.
Das kann der Appellationsrichter nicht akzeptieren. «Nein!», ruft Hoenen in den Saal. Es sei stets die Verhältnismässigkeit zu prüfen.
Der Polizei müsse «langsam, aber sicher klar werden», dass solche Kontrollen demütigend seien. Er erwarte zudem, dass sich die Auffassung der Gerichte unter den Beamten endlich herumspreche – und die Polizei ihr Vorgehen anpasse.
Sonst werde er bei der Beurteilung ähnlicher Fälle in Zukunft von einem «Eventualvorsatz» ausgehen müssen.
Illustration: Till Lauer