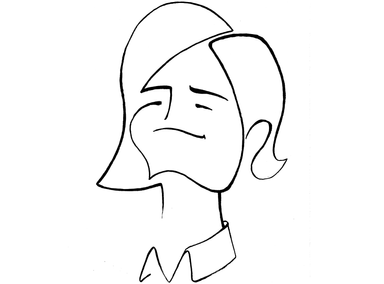
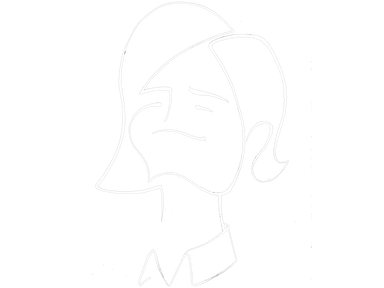
Wer zerstört das Vertrauen?
Die SVP fordert den Rücktritt von Alain Berset, die Geschäftsprüfungskommissionen lancieren eine Untersuchung. Doch bedroht wird die Schweizer Demokratie nicht durch Indiskretionen.
Von Daniel Binswanger, 28.01.2023
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Man fühlt sich an die Tage der Trump-Präsidentschaft erinnert. An das Spektakel von immer neuen, immer noch groteskeren Enthüllungen, an ergebnislose Untersuchungen von Sonderermittlern, an das alles dominierende Gefühl, die Polarisierung und Enthemmtheit der politischen Auseinandersetzung habe das amerikanische Staatswesen irreversibel beschädigt.
Ganz so extrem wie in Washington geht es in Bern zwar noch nicht zu und her. Aber die sogenannte Corona-Leaks-Affäre setzt eine neue Benchmark der Schäbigkeit. Und belegt auf beunruhigende Weise, dass es keine Institution mehr gibt in unserem Land, die nicht für machtpolitische Intrigen missbraucht werden könnte. Es müssen nur die Einsätze gross genug sein. In diesem Wahljahr sind sie es.
Die Faktenlage bei den Corona-Leaks ist nach wie vor verworren. Fest steht, dass Alain Bersets Kommunikationschef Peter Lauener während der Corona-Zeit Marc Walder, den CEO des Medienkonzerns Ringier, mit Vorabinformationen zur bundesrätlichen Pandemiepolitik versorgt hat. Ob dies wirklich eine Amtsgeheimnisverletzung im strafrechtlichen Sinn darstellt oder nicht, ist schon sehr viel weniger klar. Dass Bundesrat Berset über die Aktionen seines Kommunikationschefs informiert war, ist wahrscheinlich, kann bisher aber ebenfalls nicht belegt werden.
Offensichtlich scheint, dass die Indiskretionen eine Systematik und ein Ausmass hatten, das für hiesige Verhältnisse sehr unüblich ist. Allerdings kann niemand bestreiten, dass in der Pandemiesituation auch unübliche Verhältnisse herrschten: Alle Medienhäuser wurden von diversen Amtsstellen permanent mit Vorabinformationen gefüttert. Dass sich die rechtsbürgerliche Presse nun auf Berset und seinen Kommunikationschef einschiesst, ist von schwer zu überbietender Verlogenheit. Noch immer gilt die bündige Formel, mit der Alt-FDP-Bundesrat Pascal Couchepin die Leaks-Anfälligkeit der Schweizer Regierung auf den Begriff brachte: «Indiskretionen sind Teil des Systems.»
Was zerstört das Vertrauen in die Regierung? Moralpredigten mit Pinocchio-Nase. Wir sind gerade dabei, die Schweizer Demokratie sehr massiv zu beschädigen.
Die Strafuntersuchung von Sonderermittler Peter Marti, der mit äusserst harschen Methoden gegen Lauener vorgegangen ist, wirft vorderhand viel mehr Fragen auf, als dass sie Antworten gibt. Das beginnt bei der absurden Tatsache, dass Teile dieser Strafuntersuchung über illegale Indiskretionen durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit gelangten, die vermutlich ihrerseits eine Amtsgeheimnisverletzung darstellt.
Auf den Sonderermittler musste folglich ein weiterer Sonderermittler angesetzt werden, der nun abklären soll, wer die Akten zu den Berset-Leaks geleakt hat. Ganz zu schweigen von einem weiteren Sonderermittler, der mandatiert wurde, weil Peter Martis Strafuntersuchung juristisch dermassen unzulässig und missbräuchlich erscheint (oder nur überfordert und dilettantisch?), dass dem eidgenössischen Justizdepartement wenig anderes übrig blieb, als gegen Sonderermittler Marti eine zusätzliche Sonderermittlung wegen Amtsmissbrauchs zu autorisieren.
Mit sehr viel gutem Willen mag man diese Kaskade von Sonderermittlern als Ausdruck der Gründlichkeit des helvetischen Justizwesens deuten. Aber es ist schwer, sich gegen den Eindruck zu wehren, sie sei die Folge einer Politisierung und Verluderung, der nicht mehr beizukommen ist. Eine Justiz, die sich nicht strikt an ihre Verfahrensregeln hält und deren Amtsträger eine politische Agenda zu verfolgen scheinen, kann ihre Glaubwürdigkeit auch durch das Auftürmen von Sonderverfahren nicht wiederherstellen.
Je mehr Details zu Martis Untersuchung an die Öffentlichkeit geraten, desto erklärungsbedürftiger erscheint jedenfalls die Vorgehensweise des pensionierten Zürcher Oberrichters, den man für seine Rolle als Sonderermittler aus dem Ruhestand zurückgeholt hat. Es gibt nichts an diesen Sonderuntersuchungen, was von namhaften Juristen und Strafrechtsexpertinnen nicht als zweifelhaft und problematisch bezeichnet würde: dass er seine Untersuchungen überhaupt aufnahm und so lange fortführte; dass er sie ausdehnte auf Verdächtige ausserhalb der Bundesanwaltschaft, der seine Abklärungen hätten gelten sollen; dass eine Ausdehnung des Verfahrens, das den Crypto-Leaks gegolten hat, auf den «Beifang» der Corona-Leaks bewilligt wurde.
Noch nicht einmal, ob Marti die geleakten E-Mails von Peter Lauener für seine Strafuntersuchung überhaupt verwenden darf, das heisst, ob ihre Beschaffung zulässig gewesen ist, konnte bisher geklärt werden. Auch hier gibt es grösste Zweifel.
So weit die Seite der Strafuntersuchung. Sehr viel nachvollziehbarer werden die Vorgänge jedoch, wenn man sie politisch betrachtet. Es ist nicht ganz einfach, an einen Zufall zu glauben: Was juristisch so befremdlich wirkt, wird plötzlich sinnfällig, wenn man es vor dem Hintergrund der kommenden Wahlen betrachtet.
Die eidgenössischen Wahlen im nächsten Oktober könnten machtpolitisch zum bedeutendsten Urnengang werden, seit 1959 die Zauberformel durchgesetzt wurde und die SP mit zwei Bundesräten in die Regierung einzog. Im Oktober wird es darum gehen, ob die Sozialdemokraten einen dieser beiden Sitze wieder verlieren.
Die Grünen hätten schon heute einen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat, und sollten sie bei den Parlamentswahlen im Herbst nicht einbrechen, dürfte es zunehmend schwierig werden, diesen Anspruch zu ignorieren. Wenn der grüne Sitz kommt, muss er entweder auf Kosten der SP oder auf Kosten der FDP gehen. Dass die Mitte ihren Sitz abgeben muss, wäre ebenfalls denkbar und könnte dafür verantwortlich sein, dass sie sich gegenüber der Ratsrechten gelegentlich äusserst handzahm zeigt. Diese Variante steht momentan aber nicht im Vordergrund.
Eine Regierung mit zwei SP-Bundesrätinnen und einem von den Grünen würde einen fast revolutionären Linksrutsch darstellen. Eine Regierung mit je einem SP- und einem grünen Bundesrat würde die Linke im Vergleich zur heutigen Situation hingegen deutlich schwächen. Es könnte im nächsten Herbst deshalb zu einer fundamentalen politischen Weichenstellung kommen, welche über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte die Machtverhältnisse bestimmt.
Allerdings wird es schwierig bis unmöglich werden, der SP einen Sitz wegzunehmen, solange ihre Bundesrätin oder ihr Bundesrat nicht zurücktritt. Ist es eine blosse Koinzidenz, dass vor diesem Hintergrund nun Justizintrigen, Leaks und Medienkampagnen die Berichterstattung beherrschen? Auch die Geschäftsprüfungskommissionen wollen sich an dem Kesseltreiben beteiligen, obwohl ihr Mandat völlig unklar ist und ungewiss bleibt, wie ihre Untersuchung am Justizverfahren vorbeikommen soll und zu welchen Akten oder Verdächtigen die Parlamentsvertreterinnen Zugang haben werden. Hauptsache, es werden irgendwelche Aktivitäten entfaltet.
Was immer Alain Berset potenziell beschädigt, scheint willkommen. Er muss weg, damit SVP und FDP ihre Bundesratsmehrheit sichern können.
Die Intrigen um die Bundesratsersatzwahlen und die Departementszuteilung haben uns bereits einen Vorgeschmack gegeben, mit welch harten Bandagen die Parteien den Kampf um ihre Regierungssitze austragen werden. Es dürfte weitergehen in diesem Stil.
Natürlich stellen sich nun eine ganze Reihe von Fragen: Warum überhaupt wird ausgerechnet Peter Marti, ein notorischer Hardliner und ehemaliger SVP-Kantonsrat, mit einer so explosiven Ermittlung betraut, die nicht nur skrupulöses Vorgehen, sondern Augenmass erfordern würde? Lag es daran, dass er ursprünglich ja nur die Crypto-Leaks aufklären sollte und dass nicht vorauszusehen war, auf welch delikates politisches Terrain er seinen Ermittlungsfuror tragen könnte?
Warum wurde es Marti von der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft erlaubt, seine Untersuchungen auf die mit den Crypto-Leaks kaum verbundenen Corona-Leaks auszudehnen? Das Argument der Verfahrenseinheit scheint weitgehend an den Haaren herbeigezogen. Hat es vielleicht damit zu tun, dass die Aufsichtsbehörde von der SVP-Richterin Alexia Heine präsidiert wird, der Frau von Alexander Segert?
Segert ist bekanntlich der Werber, der seit über zwanzig Jahren für die SVP-Plakatkampagnen verantwortlich zeichnet, der Guru der rechtspopulistischen Propaganda, ein professioneller Scharfmacher. Er pflegt auch vielfältige Beziehungen zu AfD und FPÖ, stand wegen Volksverhetzung vor Gericht. Da ist die juristische Expertise seiner Ehefrau sicher äusserst hilfreich gewesen. Aber braucht die Eidgenossenschaft allen Ernstes eine Justizaufsicht aus dieser Ecke?
Positiv ist zu vermerken, dass die Schweizer Medien ihren Job machen und dass Republik, WOZ und die Tamedia-Zeitungen über die Hintergründe nun schon so einiges zutage gebracht haben. Nicht überraschend ist, dass die rechtsbürgerlichen Publikationen – «Nebelspalter», «Weltwoche» – sich konsequent darum bemühen, Bersets Rücktritt wenn nicht zu fordern, so doch als beinahe unausweichlich darzustellen. Die NZZ belässt es dabei, «Aufklärung bis in den dunkelsten Winkel» zu fordern.
Eine Enttäuschung stellen nur die CH-Media-Titel dar, die sich unter Chefredaktor Patrik Müller von biederen, aber gemässigten Publikationen mehr und mehr zum parteipolitischen Sturmgeschütz entwickeln. Müller wirft sich in die Pose des um Aufklärung bemühten Journalisten, doch Aufklärung über den politischen Hintergrund der Affäre und darüber, weshalb die Lauener-E-Mails an ihn geleakt worden sind, scheint sein Anliegen nicht zu sein. Ob Leaks nun gut oder skandalös sind, hängt für Müller offensichtlich davon ab, wem sie schaden.
Nicht nur die Verhaftung von Peter Lauener war unverhältnismässig und für Schweizer Verhältnisse sehr, sehr ungewöhnlich. Die ganze Affäre belegt, dass die politische Auseinandersetzung in diesem Land mit neuer Härte geführt wird. Dass man ausserordentlich kreativ geworden ist darin, die Justiz gegen seine Gegner einzusetzen. Und dass nicht nur Vorabinformationen geleakt werden – sondern Dokumente, mit denen man den Gegner vernichten will.
Es wird ein hässliches Wahljahr werden. Wir stehen erst am Anfang.
Illustration: Alex Solman