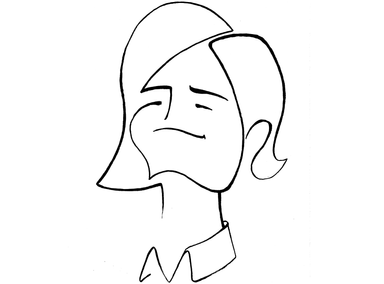
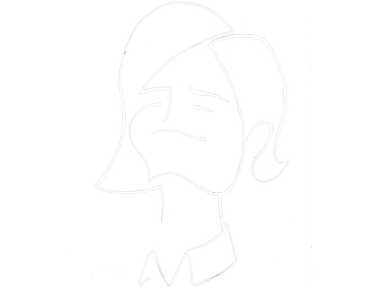
Operation «Linke spalten»
Die FDP will ihre beiden Sitze retten, die SVP den Bundesrat beherrschen. Diese Woche hat sich gezeigt: Sie haben offenbar einen Plan.
Von Daniel Binswanger, 10.12.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Die Bundesratswahlen brachten eine sogenannte Überraschung. Die Schweizer Medien, die in ihrer überwältigenden Mehrheit rein gar nichts haben kommen sehen, machten sich – seien wir ehrlich – ein wenig zum Gespött. In ihrer Hilflosigkeit taten sie halt, wovon sie nicht überfordert sind: Sie schwadronierten über «Gmögigkeit».
Derweil geschehen in Bern sehr ernsthafte Dinge, die eigentlich beim Namen genannt werden sollten: Die ersten drei Jahre der laufenden Legislatur waren geprägt von einem aussergewöhnlich zerstrittenen und dysfunktionalen Bundesrat. Doch die neu zusammengesetzte Landesregierung hat sich noch einmal deutlich weiter entfernt vom Geist der Konkordanz. Das ist das Erstaunliche an der aktuellen Departementsverteilung, nicht einmal so sehr, dass mit den Finanzen und der Umwelt nun zwei Schlüsseldepartemente in rechtsbürgerlicher Hand sind. In Bern herrscht jetzt ein Machtkartell, das Viergespann der SVP- und FDP-Magistraten, das bis anhin in dieser Form nicht existierte.
Die Freisinnigen sind dabei allerdings nur in der Position der Schutzbefohlenen: Um ihren bedrohten zweiten Sitz zu halten, sind sie angewiesen auf die Volkspartei. Das war schon in den letzten drei Jahren spürbar, nimmt heute aber eine neue Qualität an. Es geht so weit, dass die FDP Albert Rösti im Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) installiert.
Die zentrale Frage ist dabei noch nicht einmal, ob der neue SVP-Bundesrat nun tatsächlich ein klimapolitischer Reiter der Apokalypse oder vielleicht sogar ein gar nicht so schlechter Umweltminister ist, weil er die Fähigkeit hat, im Gegenlager Unterstützung zu sichern und Mehrheiten zu schaffen (was im konkreten Fall zwar wie eine sehr gewagte Schutzbehauptung wirkt, aber ein argumentatives Grundmuster des konkordanten Schöntrinkens darstellt). Entscheidend ist, dass FDP und SVP nun offensichtlich entschlossen sind, die Kollegialbehörde gemeinsam per Diktat zu beherrschen.
Besonnene bürgerliche Stimmen haben sehr eindringlich vor dieser Entwicklung gewarnt: «Ein SVP-FDP-Päckli, das sich nimmt, was es will, und die anderen mit dem Rest abspeist: Das wäre wohl der denkbar schlechteste Start für den neuen Bundesrat», schrieb die NZZ zwei Tage vor der Bundesratswahl. «Man kann nur hoffen, dass die Gerüchte um eine bürgerliche Machtdemonstration übertrieben sind.»
Nun, sie sind nicht übertrieben. Der Wille zur Macht – unter Missachtung der Anciennität, unter Missachtung der Kollegialität, unter Missachtung der realen Wählerstärke – geht sogar noch weit über alles hinaus, was selbst die NZZ vermutet hätte. Er wurde besiegelt durch die «Überraschungswahl» von Elisabeth Baume-Schneider.
Die Puzzleteile beginnen, sich zusammenzufügen. Es sieht allmählich danach aus, als habe eine ganze Reihe von Manövern ein gemeinsames Ziel: den zweiten FDP-Sitz sichern und die Bedingungen herstellen, um den unabweisbar werdenden Anspruch der Grünen auf eine Bundesratsvertretung auf Kosten der SP zu erfüllen. Das Planspiel hat mehrere Etappen – und könnte sogar aufgehen.
Erstens ist nun statt Eva Herzog die neuerdings unter dem Kürzel EBS geführte Elisabeth Baume-Schneider gewählt worden. Die FDP hat, wie unterdessen zahlreiche Medienberichte und Quellen in Bern bestätigen, ein Doppelspiel gespielt. Öffentlich hat sie sich gegen EBS ausgesprochen – weil dann die lateinische Schweiz übervertreten sei –, hinter den Kulissen hat Thierry Burkart aktiv für die Verhinderung von Eva Herzog geweibelt.
Damit wurde zunächst verhindert, dass KKS (Karin Keller-Sutter) eine kompetente Gegenspielerin bekommt, die einen begründeten Anspruch auf das Finanzdepartement erheben könnte. Allerdings hätte man zur Not auch Herzog im Justizdepartement entsorgen können. Wichtiger ist: Berset muss sturmreif geschossen werden, damit die SP-Vakanz mit einem Grünen besetzt werden kann. Eine Westschweizer Übervertretung erhöht den Druck auf den Freiburger Bundesrat, so früh wie möglich zurückzutreten. Nach Wunsch der Strippenzieher bereits bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen im Dezember 2023.
Zweitens wurde Berset deshalb mit demütigend mageren 140 Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt. Eine weitere symbolische Massnahme, um bei der Vergrämung des Innenministers möglichst schnelle Fortschritte zu erzielen.
Drittens wird Berset nun gegen seinen Willen – und ganz offensichtlich unter dem Diktat des FDP-SVP-Machtkartells – dazu gezwungen, im Innendepartement zu bleiben. Zugleich ist in zahlreichen Medien der ganz und gar nicht selbstevidente Diskurs befeuert worden, dass Berset entweder das Departement wechseln oder baldigst ausscheiden müsse. Berset ist nun der Mann, den es loszuwerden gilt.
Viertens wird mit Albert Rösti das absolute anti-ökologische Schreckgespenst im sogenannten Departement für Umwelt installiert. Erinnern Sie sich noch an die Basisbefragung zur Klimapolitik, die FDP-Präsidentin Petra Gössi im Wahljahr 2019 organisierte, an das forcierte freisinnige Bemühen, sich einen grünen Anstrich zu verleihen? Falls nicht: Das können Sie getrost vergessen. Heute ist die FDP die Partei, die gemeinsam mit der SVP den Erdöllobbyisten an die Schalthebel setzt.
Das bekräftigt zum einen den zunehmend vorbehaltlosen Pakt, den der Freisinn mit der Volkspartei zu schliessen bereit ist. Zum anderen, auch dies durchaus beabsichtigt, dürfte es die Grünen stärken.
Nichts ist wertvoller für einen erfolgreichen Wahlkampf als ein möglichst monströses Feindbild. Nur zehn Minuten nach der Bekanntgabe von Röstis Ernennung lancierten die Grünen in den sozialen Netzwerken eine vorbereitete Kampagne mit dem Konterfei des neuen Umweltministers. Der Slogan: «Der Ölbaron übernimmt das UVEK. (…) Jetzt Grüne stärken.»
Warum ist das im Interesse der Rechtsbürgerlichen? Weil es wiederum hauptsächlich auf Kosten der Sozialdemokraten gehen dürfte, wenn die Grünen im nächsten Oktober Wähleranteile erobern. Hier liegt das strategische Ziel: Die SP muss möglichst schlecht abschneiden, idealerweise so schlecht, dass sie unter den Stimmenanteil der FDP sinkt. Nur dann gibt es ein unanfechtbares Argument, weshalb die Grünen einen SP- und nicht einen FDP-Sitz bekommen sollen. Die Freisinnigen sehen in diesem Plan inzwischen einen gangbaren Weg der Besitzstandswahrung.
Und auch die SVP hat die Vorzüge des Viererpaktes entdeckt. Erinnern Sie sich noch? Gleich im Anschluss an die Parlamentswahlen 2019 hat Blocher eine Debatte über die sogenannte Blocher-Formel lanciert: Sie müsse die Zauberformel ersetzen. Im Bundesrat sollten mittelfristig nur noch die SVP mit zwei, SP, FDP, Mitte, Grüne und Grünliberale mit je einem Sitz repräsentiert sein. «Teile und herrsche!» schien damals für Blocher die vielversprechendste Strategie zu sein.
Im Lauf der Legislatur entdeckte die Volkspartei jedoch, was für einen Luxus es darstellt, zwei von Abwahl bedrohte FDP-Bundesrätinnen als Partner zu haben, die sich anbiedern müssen, sich permanent gegenseitig auszustechen versuchen und der SVP in der Landesregierung eine rechtsbürgerliche Mehrheit garantieren. Noch im letzten Herbst waren die Abwahlängste von Keller-Sutter und Ignazio Cassis das bestimmende Moment der Machtdynamik im Bundesrat.
Inzwischen jedoch sind die Umfragewerte der Freisinnigen wieder deutlich besser, und Keller-Sutter spannt mit Cassis zusammen. Beide setzen nun darauf, gemeinsam mit der SVP ihre Sitze zu halten – auch wenn das natürlich nur um den Preis einer noch engeren politischen Allianz möglich ist. Die ist schon länger manifest in der Europapolitik – und könnte sich nun auch in der Klimapolitik sehr deutlich bemerkbar machen.
So weit der schöne Plan – und auch wer von diesen Aussichten ganz und gar nicht erfreut ist, muss beinahe anerkennend feststellen, dass es in Bern trotz aller Wirren und Zufälligkeiten wenigstens ein paar Strateginnen gibt, die zu wissen scheinen, was sie tun – und sogar damit durchkommen könnten.
Allerdings hat dieser Plan auch zwei potenzielle Schwachpunkte.
Der eine sind die Grünliberalen – bezeichnenderweise die einzige Fraktion, die sich klar für die Wahl von Eva Herzog aussprach. Rösti im Uvek wird den Grünen nützen und dadurch potenziell der SP schaden. Aber auch die Grünliberalen werden profitieren – und dadurch die FDP weiter schwächen. Es würde nicht verwundern, wenn letzterer Effekt noch deutlicher ins Gewicht fällt. Die FDP muss für den Ölbaron im Uvek jetzt wohl oder übel geradestehen. Für umweltbewusste Wählerinnen mit bürgerlicher Gesinnung dürfte das zum Problem werden. Ein forcierter Exodus zu den Grünliberalen wäre eine nur logische Folge. Und auch die GLP könnte schon bald ihren Bundesratsanspruch geltend machen.
Der andere potenzielle Schwachpunkt sind die Grünen. Nichts dürfte entscheidender sein, als wie sie sich positionieren werden – und vorderhand ist es offen. Wenn die Grünen schliesslich doch bereit sind, die SP anzugreifen, hat der rechtsbürgerliche Plan eine Chance. Wenn die linke Allianz hält, sieht es anders aus.
Während beim Sommaruga-Rücktritt die Ansage der Grünen noch glasklar gewesen ist, sind bereits heute die Signale wesentlich diffuser. Es wird die wohl alles entscheidende Frage des letzten Jahres dieser Legislatur: Lassen sich die Linken auseinanderdividieren? Wenn ja, könnten FDP und SVP weiterhin zwar nur über etwa 40 Prozent der Wähleranteile, aber über die Kontrolle der Landesregierung verfügen: ein machiavellistischer Geniestreich. Für die Klimapolitik jedoch – und nicht nur für die Klimapolitik – wären das keine guten Aussichten.
Illustration: Alex Solman