
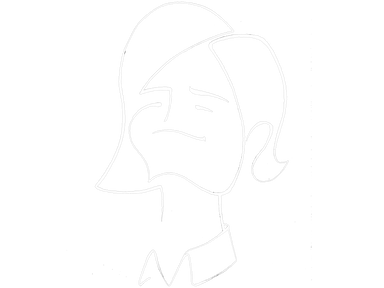
Urschweiz reicht nicht
Trotz politischer Sommerpause hat die offizielle Aufarbeitung der Pandemiepolitik begonnen. Das Mantra: Die Schweiz muss bleiben, wie sie ist, dann kommt alles gut. Tatsächlich? Der nächste Herbst kommt bestimmt.
Von Daniel Binswanger, 24.07.2021
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Rückschau, Sommerferien, Nostalgie. Katastrophenprognosen, Hektik, Grossalarm. Die letzte Woche war eine Woche der grossen Schizophrenie. Beziehungsweise eines neuen Kipppunkts der Corona-Pandemie.
Am härtesten prallten die Gemütszustände am Dienstag zusammen. Im «Club» des Schweizer Fernsehens vereinte man eine illustre Runde zum «Weisch no»-Talk über «das aussergewöhnliche Corona-Jahr». Ex-Mister-Corona Daniel Koch etwa geriet in euphorisches Schwärmen über die «wahnsinnige Leistung» des Bundesrats. Auch was die «kantonalen Behörden» gemacht hätten, verlange «extrem hohen Respekt», sagte Koch mit huldigendem Blick auf Lukas Engelberger, den etwas verblüfft aus der Wäsche blickenden Präsidenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Um Missverständnissen vorsorglich vorzubeugen, beeilte sich der heute als Berater beim europäischen Fussballverband Uefa tätige Koch sofort zu präzisieren, es sei nicht seinetwegen, dass dieses Heldenstück vollbracht worden sei.
Am anderen Ende der Skala: Ebenfalls am Dienstag erschien das «Wissenschaftliche Update» der Taskforce des Bundesrats, das in aller Nüchternheit ein bedrohliches Bild der Pandemielage zeichnet. Die Ansteckungskurve nimmt wieder einen steil exponentiellen Verlauf, und die Entwicklung der Epidemie in Grossbritannien führt vor, wie nach einer gewissen Frist auch die Zahl der Hospitalisationen anzusteigen beginnt – potenziell mit etwa derselben exponentiellen Dynamik wie die Fallzahlen.
Die Konklusion des Taskforce-Berichts ist nicht überraschend: Die wichtigste Massnahme, um einen Katastrophenherbst zu verhindern oder wenigstens zu mildern, ist eine möglichst hohe Durchimpfung. Und genau hier steht die Schweiz schlecht da. Alle Nachbarländer haben heute einen signifikant höheren Anteil der Bevölkerung mit mindestens einer Erstimpfung. Und auch bei der Impfgeschwindigkeit liegt die Schweiz inzwischen hinter sämtlichen Nachbarn zurück. Noch beunruhigender ist jedoch ein anderes Behördenversagen: Grossbritannien hat es geschafft, dass nur rund 2 Prozent der über 70-Jährigen (also der exponiertesten Alterskategorie) nicht geimpft sind. In der Schweiz ist dieser Prozentsatz fast zehnmal so hoch – und könnte in dieser Gruppe zu einer fast zehnmal so hohen Covid-Sterblichkeit führen.
Niemand kann mit Sicherheit voraussagen, wie sehr sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten zuspitzen wird. Doch der Boden für ein neues Drama im Herbst ist gelegt.
Ermutigend ist immerhin, dass sich nun auch offizielle Bemühungen zu einer sinnvollen Aufarbeitung der bisherigen Pandemiepolitik entwickeln – auch unter Berücksichtigung von Systemversagen und Fehlern.
Der Schweizer Bundeskanzler Walter Thurnherr gab diese Woche dem «Tages-Anzeiger» ein bemerkenswertes Interview, das selbstkritische Analysen mit neuer Deutlichkeit ertönen liess. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil nichts dringlicher sein könnte, als dass die Behörden aus der bisherigen Pandemiebewältigung die richtigen Lehren ziehen, sondern auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen und staatspolitischen Konsequenzen der Jahrhundertkrise. Was bedeutet Corona politisch? Und wie wird dieses polarisierte, gespaltene Land Corona längerfristig verarbeiten?
Die Antwort des Bundeskanzlers ist sowohl extrem erwartbar als auch extrem überraschend. Im Grunde lautet die Botschaft: Die Eidgenossenschaft muss bleiben, was sie immer war – und dann wird alles gut. Sie muss nur ihre beiden Kardinaltugenden hochhalten: den Föderalismus und die direkte Demokratie. Man wird ein solches Traditionsbekenntnis einer Schweizer Magistratsperson kaum übel nehmen können – und dennoch ist es irritierend. Wenn uns die Pandemie schliesslich etwas dramatisch vor Augen geführt hat, dann sind es die Grenzen der «urhelvetischen» Wesenszüge.
Thurnherr ist sich dessen wohl bewusst und gibt eine Reihe von Begründungen: «Der grosse Vorzug des Föderalismus ist nicht seine Effizienz, sondern seine Identifikationskraft. (…) Peter von Matt hat einmal gesagt, der Föderalismus sei wie ein Huhn, das man nicht umbringen könne, ohne auf seine Eier zu verzichten. Und gleichzeitig kann man es nicht leben lassen, ohne dass es stinkt.» Es ist ein hübsches Zitat, mit dem hierzulande stets stechenden bäuerlichen Referenzrahmen.
Gleichzeitig ist es eine Aussage von erstaunlicher Kaltschnäuzigkeit. Die Hühner stinken? Knapp 8000 Mitbürgerinnen sind in der zweiten Welle gestorben, und es ist unbestritten, dass die Todeszahlen viel, viel niedriger sein könnten, wenn erstens früher und entschiedener reagiert worden wäre und wenn zweitens das föderale Verantwortlichkeitschaos nicht zu enormen Verzögerungen, ständigen Widersprüchen und lausiger Implementierung geführt hätte. Wir müssen den Gestank ertragen – den Verwesungsgeruch?
Der Bundeskanzler macht kein Geheimnis aus dem Grund für sein irritierendes Plädoyer: Der Föderalismus ist die entscheidende Quelle der politischen Identifikationskraft. Was hält dieses Land zusammen? Dass alle relativ autonom agieren können – auch wenn es gigantischen Schaden anrichtet. Historisch mag diese Antwort ihre Berechtigung haben. Aber ist sie den heutigen Polarisierungstendenzen angemessen?
Wie in allen westlichen Demokratien schreitet die Polarisierung auch in der Schweiz voran und ist durch die Pandemie verstärkt worden. Die klassischen Gräben haben sich noch einmal vertieft: zwischen Stadt und Land (bezüglich Impfbereitschaft), zwischen den Sprachregionen (Betroffenheit, Aktionismus der Behörden), zwischen links und rechts (Unterstützungsleistungen, Massnahmenakzeptanz).
Die parteipolitische Fraktionierung nimmt weiter zu, demnächst wohl mit Folgen für die Zusammensetzung der Schweizer Landesregierung. Die politischen Felder, in denen sinnvolle Kompromissbildung kaum mehr möglich zu sein scheint, werden zahlreicher. Renten, Europa, Klima – und jetzt mit potenziell dramatischen Konsequenzen: das Impfen. Wenn der Föderalismus tatsächlich unsere beste Hoffnung ist, ist das nach heutigem Stand vermutlich keine gute Nachricht.
Natürlich gibt es auch noch die zweite helvetische Urtugend: die direkte Demokratie. Bundeskanzler Thurnherr findet die momentane Zunahme von Referenden unbedenklich, spricht sich gegen eine Erhöhung der zu sammelnden Unterschriftenzahl aus, ist nach wie vor überzeugt von der pazifierenden Wirkung des direktdemokratischen Vetorechts. Wenigstens in einer Hinsicht ist ihm zuzustimmen: Abstimmungen sind bisher für die Mängel des Pandemiemanagements jedenfalls nicht direkt verantwortlich zu machen.
Eine andere Frage ist jedoch, wie sich die starke Zunahme der referendumsfähigen Akteure letztlich auswirken wird. Die Schlagkraft von temporären, themenbezogenen Interessenkoalitionen wird grösser, auch Abstimmungssiege sind immer wieder drin. Das zweite Referendum gegen das Covid-Gesetz werden die «Freunde der Verfassung» voraussichtlich zwar ebenfalls verlieren – aber bei vielen anderen Vorlagen (zum Beispiel dem Medienförderungsgesetz) könnten sie die entscheidende Kraft sein, welche die Mehrheitsverhältnisse dreht.
Direktdemokratische Partizipation sollte nicht nur ein Unmutsventil sein, das immer dann seine Wirkung tut, wenn zu viel gesellschaftlicher Druck im Kessel ist, sondern die Bürgerinnen auch binden an institutionalisierte Akteure wie Parteien und Verbände. Von Mobilisierungsmächten, die plötzlich aus dem Nichts kommen, wird diese Funktion unterminiert. Sie erfüllen keine Vermittlungsfunktion. Sie lassen Konflikte aufschäumen.
Natürlich sollen und müssen demokratische Systeme diese Konflikte auffangen, aber das entscheidende können sie nicht leisten. Um gemeinsame Ziele stiften zu können, braucht es nicht bloss vernünftige politische Systeme. Es braucht ein Mindestmass an politischer Vernunft. Nicht die demokratischen Prozesse per se, sondern eine konsensfähige Basis von Fakten und Werten schafft letztlich politische Identität.
Die Pandemie hat nun gezeigt, dass diese Basis weiter schwindet, ohne dass die Schweiz darauf eine Antwort hätte. Dieser Entwicklung muss begegnet werden – auch jenseits der Traditionspflege.
Jetzt sollten wir allerdings erst einmal schauen, dass wir einigermassen über die nächsten Monate kommen.
Illustration: Alex Solman