
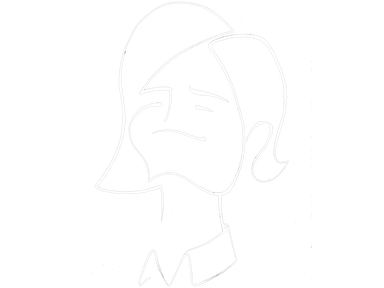
Sommer des bösen Erwachens
Die politischen Konsequenzen des Nein zum CO2-Gesetz dürften weitreichend sein. Umso mehr, als gerade ja so einiges schiefläuft.
Von Daniel Binswanger, 19.06.2021
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Jetzt erleben auch noch Frisurenwitze eine Renaissance. Natürlich wegen der Fussballer im Nationalteam, die am Mittwochabend im EM-Spiel gegen Italien so jämmerlich untergegangen sind – nicht nur sang- und klanglos, sondern auch noch frisch blondiert. Allerdings wurden sie auch begleitet von aggressiver Häme und ätzendem Ressentiment, wie sie für die biedere Schweizer Sportberichterstattung eigentlich ungewöhnlich sind.
Es mag daran liegen, dass die Leistung der Nationalelf tatsächlich äusserst bescheiden war. Oder daran, dass es Fernsehzuschauer und Durchschnittsbürgerinnen zunehmend schwierig finden, mit Einkommensmillionären und Lamborghini-Fahrern Nachsicht zu üben. Oder auch daran, dass die postmigrantische Diversität der Schweizer Mannschaft das Aufkommen von hässlichen Gefühlen leider stärker fördert als behindert. Vielleicht liegt es aber auch schlicht daran, dass die Schweizer Gesellschaft insgesamt gerade brutal damit konfrontiert wird, inzwischen alles andere als ein Erfolgsteam zu sein. Es hätte der Sommer des postpandemischen Aufbruchs werden sollen. Es ist die Saison des bösen Erwachens.
Die meisten Kommentatorinnen, sofern sie nicht dem stramm rechten Lager angehören, wissen schon gar nicht mehr, an welche Niederlage sie sich halten sollen – Rahmenabkommen, CO2-Gesetz, PMT –, und reden irgendwie von allen gleichzeitig. Das ist der Situation auch angemessen. Das Schweizer Erfolgsrezept war immer die inkrementelle Reform, der zähe Kompromiss, der Fortschritt in bedachtsamen und bescheidenen Schritten. Doch auch die Desaster kommen klein portioniert – und summieren sich plötzlich zur Epochenwende.
Sicherlich, man kann das Argument bringen, dass dies alles nicht ausserordentlich und unvorhersehbar war, dass es in seiner konkreten Genese auf eine Reihe unglücklicher Umstände zurückgeführt werden kann, dass sich die Dinge unter etwas günstigeren Bedingungen wieder korrigieren lassen. Das CO2-Gesetz zum Beispiel wäre vermutlich durchgekommen, wenn die Abstimmung nicht gemeinsam mit den beiden Agrarinitiativen stattgefunden hätte, wenn das Ja-Lager eine effizientere Kampagne gemacht hätte, wenn die befürwortenden Parteien etwas weniger siegesgewiss und engagierter in die Schlacht gezogen wären. Die SVP hat schon mehrfach bewiesen, dass sie ökologischen Vorlagen mit dem Kostenargument gefährlich werden kann. Dieses Mal ist ihr im Schlepptau der finanzstarken Erdölvereinigung Avenergy der Abschuss bequem gelungen. Business as usual? Da sind doch ein paar Zweifel angezeigt.
Zum einen tickt die Uhr immer lauter und wird die Einhaltung der Klimaziele des Pariser Abkommens ständig schwieriger, teurer, unrealistischer. Obwohl die Akzeptanz gegenüber der Klimapolitik viel stärker werden müsste, nimmt vorderhand vor allem das Konfliktpotenzial zu. Zum anderen dürfte für die SVP und andere konservative Kräfte die Versuchung steigen, die Klimapolitik zum neuen identitätspolitischen Marker zu machen.
In den USA ist der aktive Widerstand gegen jede Form von Umweltpolitik und das tumbe Bestreiten der menschengemachten Klimaerwärmung einer der zentralen Glaubensartikel des MAGA-Republikanismus. In der Schweiz sind wir nicht an diesem Punkt. Die Gegner des CO2-Gesetzes haben es in dieser Kampagne sorgfältig vermieden, die Klimaerwärmung infrage zu stellen, und verlegten sich stattdessen auf die Behauptung, Innovation, Wasserstofftechnologie und der entfesselte freie Markt würden die Einhaltung des Pariser Abkommens ganz von selber garantieren. Das ist intellektuell kaum ansprechender als die schlichte Leugnung der Klimaerwärmung. Aber es zieht.
Für die SVP ist das ein Göttergeschenk: Ihre beiden Kernthemen, Migration und Europa, dürften in nächster Zeit wenig ergiebig sein. Die Chance, den Die-Kleinen-gegen-die-Eliten-Affekt jetzt auf dem Feld der Klimapolitik beackern zu können, wird sie zu nutzen versuchen. Umso mehr, als es relativ einfach ist, die Evergreens der klassischen SVP-Botschaften klimapolitisch zu kodieren.
Die Verteidigung der Neutralität (und die Verweigerung von internationaler Kooperation zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil) verwandelt sich in das Argument, die Schweiz sei ohnehin zu klein, um auf das Weltklima einen Einfluss zu haben. Warum mitmachen, wenn es Geld kostet und auf uns gar nicht ankommt? Der Kampf gegen alle Formen der Migration wiederum findet eine Ecopop-artige Neuauflage mit der ständig wiederholten Aussage, die CO2-Bilanz der richtigen Schweizerinnen sei eigentlich brillant und werde lediglich von der Zuwanderung ruiniert. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen entstand der Eindruck, als müsste die Klimapolitik den Rechtspopulismus über kurz oder lang in die Defensive bringen. Jetzt sieht es ganz so aus, als würde sie zu seinem neuen Kampffeld.
Diese Entwicklung scheint umso plausibler, als die FDP auch heute wieder reagiert, wie sie die letzten dreissig Jahre immer reagiert hat auf die Herausforderung durch den Rechtspopulismus: unsicher, gespalten, glücklos. Der Rücktritt von Petra Gössi ist in seiner symbolischen Tragweite gar nicht zu überschätzen. Er könnte sich als die definitive Besiegelung des freisinnigen Niedergangs erweisen.
Gössi war die Präsidentin, die versucht hat, das Ruder herumzureissen. Jetzt scheint der Beweis geführt: Es war zu spät. Gössi hat ihr ganzes politisches Kapital für den ökologischen Kurswechsel eingesetzt – und ist gescheitert. Die wirtschaftsnahe Partei mit gemässigter ökologischer Agenda wird in der Schweiz die GLP sein, nicht die FDP. Schon in den Achtzigerjahren haben weitsichtige freisinnige Politikerinnen wie Elisabeth Kopp die FDP auf einen grüneren Kurs bringen wollen. Vierzig Jahre später folgt die freisinnige Basis immer noch den Wasserfallens und Leuteneggers. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber irgendwann ist Schluss.
Natürlich hat sich die Parteileitung redlich bemüht, und gibt es Figuren wie FDP-Ständerat Ruedi Noser, der zu den Unterstützern der Gletscherinitiative gehört. Im bezeichnenden Fall von Noser verlaufen die den Freisinn seit Jahrzehnten paralysierenden Widersprüche allerdings direkt durch seine eigene Person hindurch: Ist er nun Glencore-Lobbyist oder Gletscheraktivist? Irgendwie alles gleichzeitig. Die Unbeeindrucktheit der Basis ist nachvollziehbar.
Das fundamentalere Problem dürfte sein, dass es in der FDP-Wählerschaft zwei diametral entgegengesetzte Vorbehalte gegenüber dem CO2-Gesetz gegeben hat: Zum einen stiess man sich an der «staatlichen Umverteilung» des Klimafonds und hätte ganz nach wirtschaftsliberalem Lehrbuch eine reine Lenkungsabgabe vorgezogen. Zum anderen war ein grosser Teil der bürgerlichen Nein-Stimmen durch die Angst der Hauseigentümer vor hohen Anpassungsinvestitionen motiviert.
Das CO2-Nein – da ist Rudolf Strahm recht zu geben – hat auch eine sozialpolitische Komponente: Bescheidener situierte Hausbesitzerinnen, durchaus ein FDP-Wählersegment, hatten Angst vor den Kosten. Dieser Widerstand wird kaum zu überwinden sein ohne die Bereitschaft zu starker staatlicher Unterstützung. Der Hauseigentümerverband oder die reine liberale Lehre? Die FDP müsste sich entscheiden.
Und jetzt? Wird man eben hastig eine CO2-Ersatzgesetzgebung aus dem Boden stampfen müssen und darauf hoffen, dass irgendwann in nicht ewig ferner Zukunft ein vernünftiger Grundsatzentscheid dennoch möglich sein wird. Und es muss ja auch noch eine Rahmenabkommen-Ersatzlösung improvisiert und darauf gehofft werden, dass irgendwann in nicht ewig ferner Zukunft dieses Land wieder so etwas haben wird wie eine gemeinsame Europastrategie. Und schliesslich müssen wir uns auch noch akut darum kümmern, dass die Schweizer Polizeikräfte die missbräuchlichen Repressionsmittel, über die sie von Gesetzes wegen jetzt verfügen, aus unerfindlichen Gründen nicht einsetzen.
Das Spektrum der Baustellen hat auch sein Gutes: Die Desaster erscheinen klein portioniert. Zunächst müssen wir ohnehin schauen, wie wir über die extrem heissen Sommertage kommen. Frisurenwitze werden es nicht richten.
Illustration: Alex Solman