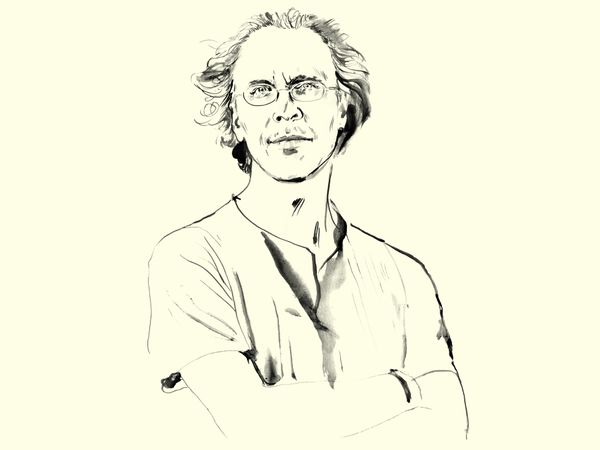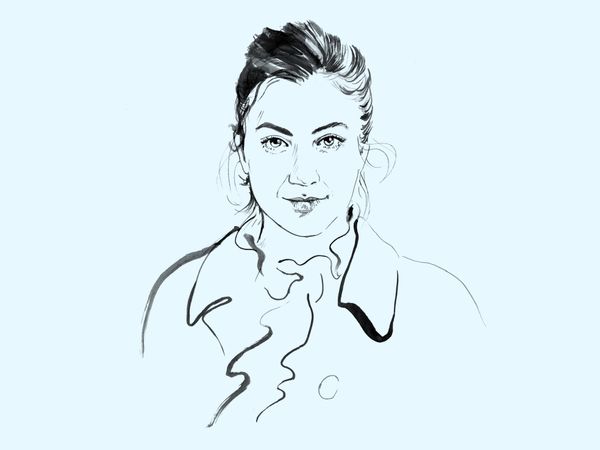Lieber Laurin, das Sterben geht weiter und wir langweilen uns
Vor lauter Lockdown fühle er sich schon wie der Tagträumer Oblomow aus der russischen Literatur, schrieb der Basler Spoken-Word-Künstler Laurin Buser an Dichterkollege Max Czollek. Der antwortet aus Berlin mit einem Bekenntnis zur politischen Kunst und gegen die Behaglichkeit.
Von Max Czollek (Text) und Elisabeth Moch (Illustration), 22.03.2021
Lieber Laurin,
also das ist schon auch ein wenig Klischee, oder? Da liegst du in der Schweiz den ganzen Tag auf der Couch rum und nichts passiert. In Paris brennen Autos und in Zürich mein Kamin.
Ich erinnere mich, wie ich mit zwei Freunden mal ein paar Tage in Bern verbrachte, um gemeinsam eine Anthologie zusammenzustellen. Das Radio lief, und die Sendung wurde für eine Eilmeldung unterbrochen: Im Umland sei eine Sirene zu hören, es handle sich aber um einen Fehlalarm.
Selbstverständlich glaube ich nicht, dass die Schweiz keine Probleme hat. Das glaubst du ja selber nicht, wie du am Ende deines Briefes schreibst. Oblomow funktioniert ja erst, wenn man weiss, dass es eigentlich was zu tun gäbe. Als Gontscharow dieses Buch schrieb, war auch alles fieberhaft auf die Modernisierung der russischen Gesellschaft gerichtet, unter allerhöchster Ausbeutung von Natur und Arbeitskraft. Während die Privilegierten sich auf ihren Privilegien ausruhten und den Moment verschliefen.
Achtung, jetzt geht es los mit Assoziationen. Und Assoziationen stellen ja meistens eine etwas krumme Verbindung zwischen zwei Punkten her.
Bei deinem Bezug auf Oblomow denke ich beispielsweise an Dada, was ja eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg war. Das Ganze begann in der Schweiz, die nicht Teil des Krieges war und dennoch die Schnauze voll hatte. Und so könnte das auch mit deinem Oblomowismus sein, der zwar auf den ersten Blick wirken mag wie ein Fehlalarm im Berner Umland, aber am Ende genau weiss, was Sache ist.
In einer WG, die ich während des Studiums häufig besuchte, wurde der Spruch «Depression ist Subversion» geprägt. Er scheint mir gegenwärtig näher an Dada (und deinem Oblomowismus) dran, als ich damals dachte, als ich den Slogan grinsend zur Kenntnis nahm. In einer Welt, in der selbst die Massnahmen gegen die Pandemie noch auf Produktivität ausgelegt sind, ist das Herumliegen und Nichtsmachen ein Akt des Protests. Und in einer Welt, in der jede logische Information eine Anstiftung zum Morden ist, darf Kunst keinen Sinn mehr ergeben und wird Dada. Nicht als Flucht, sondern als Gegenentwurf.
Und weil Dada Anagramme liebte, fällt mir jetzt der DAAD ein, der Deutsche Akademische Austauschdienst, der derzeit vermutlich nicht so viel zu tun hat.
Nächster Punkt auf meiner krummen Linie. Wäre dieser Brief ein Haus, würde es am Ende ziemlich schief aussehen. Mit dem Künstlerprogramm des DAAD, dem Gorki-Theater und der Allianz Kulturstiftung habe ich letzte Woche ein Festival organisiert: Re:Writing the Future. Es ging im weitesten Sinne um Human Rights und Literatur. Und diese Assoziation ist ganz und gar nicht willkürlich.
Denn selbstverständlich geht das Sterben auch unter Pandemiebedingungen weiter, werden Menschen verfolgt, ertrinken im Mittelmeer oder leben unter menschenunwürdigen Zuständen in den Flüchtlingslagern Europas. Das alles passiert, während wir schreiben, während du auf der Couch liegst und eine Taube beobachtest und ich an meinem Berliner Schreibtisch sitze, während die Stadt in einer Stille versinkt, die Einsicht in die Notwendigkeit fortgesetzter Corona-Massnahmen oder auch einfach Vollnarkose bedeuten könnte.
Das Sterben geht also weiter und wir langweilen uns – ob aus Subversion oder aus dem Völlegefühl der Privilegiertheit, muss hier offenbleiben. Auch Letzteres habe ich schon häufig erlebt. Ich erinnere mich beispielsweise noch genau, wie ich in Berlin einmal zu einem Stück von René Pollesch in die Volksbühne ging. Die Arbeit hiess «Kill Your Darlings», und in meinem Umfeld war eine regelrechte Polleschmania ausgebrochen. Also dachte ich, ich schaue mir den Typen einmal an.
In dem Stück ging es, soweit ich das beurteilen kann, um die Aussichtslosigkeit linker Kritik. Der Schauspieler stand auf der Bühne und lamentierte ewig über seine Unfähigkeit, noch politisch zu handeln: Ich kann dich nicht lieben, du bist ein Netzwerk usw. Und dazu zog er den berühmten Planwagen aus Brechts «Mutter Courage» über die Bühne.
Ich fand das albern. Aber vor allem fand ich Polleschs ostentative Ideenlosigkeit schockierend. Da machte also ein gefeierter Regisseur in einem für seine linke politische Positionierung bekannten und berüchtigten Haus eine Arbeit, bei der sich die politischen Impulse von früher nur noch als Anhängsel über die Bühne schleifen liessen. Vielleicht war es genau das, was er damit sagen wollte: Politik ist vorbei, Freundinnen und Freunde. Und ich dachte mir damals und denke das auch heute noch: Spiegelt sich darin nicht die sehr deutsche Klage, dass man sich von nun an nur noch wiederholen könne, denn die Geschichte sei nun einmal vorbei und die Lektionen gelernt.
Oder wie es in einem gemeinsam verfassten Text meines Lyrikkollektivs G13 heisst: Was ist das mit der Langeweile, dieser deutschen Amnesie.
In der Rückschau rücken die Dinge näher aneinander, als sie es wirklich gewesen sind. Heute scheint mir, nur wenige Monate nach «Kill Your Darlings» kam ich erstmals mit dem Ballhaus Naunynstrasse in Kontakt. Die Künstler*innen, auf die ich dort traf, sollten wenig später in das Maxim-Gorki-Theater einziehen, das wussten wir damals noch nicht. Aber die Programmatik des postmigrantischen Theaters war bereits umrissen. Und ich kann nur sagen, dass ich dort an keiner Stelle auf ein ähnliches Lamento wie in der Volksbühne stiess.
Da waren Menschen, die langweilten sich nicht. Für die war noch nicht alles erzählt worden. Trat man vor die Tür, waren dort der Kotti und die O-Strasse, voller Geschichten, von denen ich in den meisten anderen Berliner Theatern nie etwas gehört hatte. Und damit wurde auch mir klar, welche Position sich hinter diesem Narrativ der Langeweile verbarg, hinter dem Lamento, man könne nicht mehr lieben und nicht mehr Kritik üben. Das waren die Beschwörungen eines Teils der Gesellschaft, der sich nichts sehnlicher wünschte, als dass es nichts weiter zu erzählen geben würde als eben das: Langeweile.
Laurin, du hast es dir sicherlich gedacht, dass ich so ein phlegmatisches Verhältnis zur Welt nicht so ohne Widerspruch ertragen kann. Nachdem du bei «Gegenwartsbewältigung» reingehört hast, wolltest du mich anstacheln, auf die Frage nach politischer Praxis und ihrer Verweigerung einzusteigen. Und was soll ich sagen: Es hat geklappt.
Und an dieser Stelle möchte ich noch mal auf die Form dieses Austauschs zu sprechen kommen: Es handelt sich ja um zwei Briefe, einen einzigen langen Wortwechsel, zwei Monologe, wenn man so will. Das hat mich zu Beginn ein wenig skeptisch gemacht, weil ich dachte: Was soll das für ein Gespräch sein, bei dem jeder nur einmal zur Sprache kommt? Mittlerweile schaue ich mir an, was sich dabei herausbildet, und denke, hier entsteht ein Spannungsfeld. Und so ein Feld entsteht auch schon zwischen zwei Polen.
Dieses Spannungsfeld ist übrigens das – Achtung Assoziation –, was eines meiner liebsten Gedichte von Thomas Brasch umkreist. Ich meine, er hat viel mit diesem Austausch zu tun. Der Text «Der schöne 27. September» erschien 1980 im gleichnamigen Gedichtband, und er geht so:
Ich habe keine Zeitung gelesen.
Ich habe keiner Frau nachgesehn.
Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet.
Ich habe keinem einen Guten Tag gewünscht.
Ich habe nicht in den Spiegel gesehn.
Ich habe mit keinem über alte Zeiten gesprochen und
mit keinem über neue Zeiten.
Ich habe nicht über mich nachgedacht.
Ich habe keine Zeile geschrieben.
Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht.
Was diesen Text mit Oblomow und damit auch diesen Briefen verbindet, ist die Negation. Wir wissen aus dem Theater, was passiert, wenn sich solche Verneinungen demonstrativ wiederholen: Sie kippen in Richtung ihres Gegenteils. Wenn ich auf der Bühne stehe und sage: «Ich habe kein Problem, ich habe kein Problem, ich habe kein Problem», dann habe ich mit ziemlicher Sicherheit ein Problem.
Brasch macht in diesem Gedicht etwas Ähnliches. Er weicht den Dingen aus und macht sie im Ausweichen noch sichtbar als etwas, was zu tun wäre, hätte er die Kraft dazu.
Und hier komme ich zum letzten Teil meines schrägen assoziativen Hauses. Vielleicht ist es der schiefe Dachfirst oder auch das Fundament. Den folgenden Song von Adrienne Cooper hörte ich das erste Mal bei ihrem Gedenkkonzert, bei dem Daniel Kahn, Sasha Lurje und die anderen Allstars der Berliner Klezmer-Szene im Café Burger am Rosa-Luxemburg-Platz auftraten (heute ist Luxemburgs 150. Geburtstag, aber das nur am Rande). Der Text lautet im jiddischen Original so:
Volt ikh gehat koyekh
volt ikh gelofn in di gasn
volt ikh gezingen sholem
– sholem sholem sholem
Das übersetzte Cooper wie folgt ins Englische:
If my voice were louder
If my body stronger
I would take to the street
Shouting peace peace peace
Da ist sie wieder, die Wiederholung, diesmal ohne Negation. Und vielleicht zeigen diese Wiederholungen an, dass nicht nur in der oblomowistischen Verweigerung etwas Widerständiges enthalten sein muss, sondern im Frieden auch etwas von der Wut. Damit der Körper stärker und die Stimme lauter wird. Darum geht es die Tage doch mehr als vor einem halben Jahr: die Kraft zu finden, weiterzumachen. Und dafür gibt es sehr unterschiedliche Strategien.
Mit herzlichen Grüssen aus Berlin,
Dein Max
Berlin, 5. März 2021
Laurin Buser ist Rapper und Spoken-Word-Poet. Mit Fatima Moumouni bildet er das Team «Zum Goldenen Schmied», gemeinsam waren sie deutschsprachige Poetry-Slam-Champions und touren mit ihrem Abendprogramm «Gold». Auch als Rap-Combo «Nuggets» machen Moumouni und Buser gemeinsame Sache: 2021 veröffentlichten sie den Song Scheine im Gesicht. Busers letzte Solo-EP «Schmuck» erschien bei Samy Deluxes Label «Kunstwerkstadt».
Max Czollek ist Lyriker, Theaterautor und Essayist. Er ist Mitglied des Lyrikkollektivs G13 und Mitherausgeber des Magazins «Jalta – Positionen zur jüdischen Gegenwart». Seine Gedichtbände «Druckkammern» (2012) und «Jubeljahre» (2015) sowie «Grenzwerte» (2019) erscheinen im Verlagshaus Berlin, seine Essays «Desintegriert euch!» und «Gegenwartsbewältigung» im Carl-Hanser-Verlag. Zu seinen Theaterarbeiten gehörten zuletzt die «Tage der Jüdisch-Muslimischen Leitkultur» 2020. Zuletzt hat ihn die Republik zum Selbstbild der Deutschen und der Gefahr von rechts befragt.