
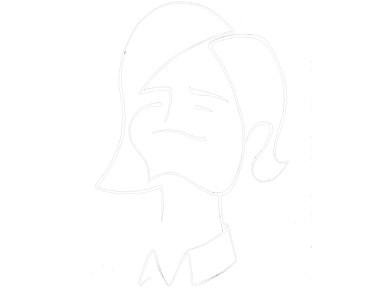
Zynische Opportunisten als letzte Hoffnung
Wie geht der Machtkampf in der Republikanischen Partei aus? Davon hängt nicht nur die Amtsenthebung von Trump ab. Sondern die Zukunft der Demokratie in den USA und der Welt.
Von Daniel Binswanger, 16.01.2021
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Nach dem Schock die Verwirrung: Auch gut eine Woche nach dem Angriff auf den amerikanischen Kongress beherrschen das Entsetzen und eine lähmende Ungewissheit die Geister und den Diskurs. Jeden Tag stellen sich neue verstörende Fragen zum Grad der Organisiertheit der Vandalen, zur aktiven Komplizenschaft republikanischer Abgeordneter, zu Terrorakten, die in den nächsten Tagen und Wochen in Washington und auf dem gesamten amerikanischen Staatsgebiet zu erwarten sind.
Die seriösesten Schätzungen gehen davon aus, dass es in den USA heute rund 580 rechtsextremistische Gruppierungen gibt, davon rund 180 bis an die Zähne bewaffnete paramilitärische Organisationen. Bis anhin war ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen dem historischen Faschismus und der Trump-Herrschaft, dass der historische Faschismus seine Macht nicht nur auf staatliche Repression, sondern auf systematische Strassengewalt und Terror abstützte. Die nächsten Wochen werden zeigen, in welchem Mass sich dieser Unterschied zu relativieren beginnt.
Inzwischen schlafen Hundertschaften Nationalgardisten neben ihren Sturmgewehren in den Gängen des Kongressgebäudes auf dem Boden, weil anders die Sicherheit der Volksvertreter nicht mehr zu gewährleisten ist. Das Parlament ist zum Heerlager geworden. Wenn das nicht Bilder sind aus einem Land im Bürgerkrieg, was dann?
Wir sollten uns keiner Illusion hingeben: Diese Demokratiekrise ist keine rein amerikanische Angelegenheit. Natürlich ist die amerikanische Politik seit langem viel polarisierter als die europäische, natürlich ist die Ungleichheit noch viel extremer als in allen anderen westlichen Industrieländern, natürlich ist das Mediensystem noch toxischer für den demokratischen Diskurs, als dies bei uns der Fall ist. Donald Trump war nie die Ursache, sondern das Symptom des Niedergangs der amerikanischen Demokratie. Doch sein Aufruf zum Sturm auf den Kongress ist nicht ein Fehltritt seiner pathologischen Persönlichkeit, sondern der konsequente Kulminationspunkt seiner vierjährigen Präsidentschaft.
Seit dem Zweiten Weltkrieg haben alle politischen Umbrüche in den USA früher oder später auch in Europa zu Epochenwenden geführt. Wenn sich in Washington ein Quasi-Putschversuch ereignen kann, welche Tabus werden dann in Zukunft auf dem alten Kontinent noch unantastbar bleiben?
Natürlich, es gibt machtvolle Stimmen der politischen Vernunft, zum Beispiel der britische «Economist». Er deklariert ohne Federlesen: «Treten wir etwas zurück, um die Ungeheuerlichkeit seines Handelns in den Blick zu bekommen. (…) In einer Demokratie ist kein Verbrechen schwerwiegender und keine Missetat verräterischer.» Trump, so der «Economist», müsse diskussionslos impeached werden. Es müsse ohne Wenn und Aber demonstriert werden, dass «Amerika einen Staatsführer, der seine Verfassung mit Füssen tritt, mit aller Vehemenz zurückweist».
Die Grundlagen der demokratischen Rechtsordnung sind nicht verhandelbar. Deshalb ist es so absurd und heuchlerisch, wenn im Namen der überparteilichen Aussöhnung nun gefordert wird, der Möchtegern-Putschist und seine Komplizinnen dürften auf gar keinen Fall zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt keine demokratische Aussöhnung mit den Feinden der Demokratie. Und es gibt schon gar keine Aussöhnung mit einer Republikanischen Partei, deren Abgeordnete in der Mehrheit bis heute nicht von ihren Propagandalügen zurückweichen und weiterhin behaupten, es sei zu massivem Wahlbetrug gekommen (selbstverständlich nur in den Swing-States, in denen Biden gewonnen hat).
Natürlich haben Trump und seine Komplizen ganz explizit und offensichtlich den Mob in Washington zu Gewalt angestachelt, natürlich waren auch während und unmittelbar nach dem Sturm aufs Kapitol Trumps Aufrufe zur Ruhe von kalkulierter Ambivalenz, natürlich kam die Verurteilung der Gewalttaten viel zu spät und blieb ohne jede Glaubwürdigkeit.
Es reicht nicht, wenn Trump in einem fadenscheinigen Versuch, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, nun plötzlich betont, es werde eine friedliche Amtsübergabe geben. Im Minimum müsste er zugestehen, dass Biden der legitime und korrekt gewählte Präsident ist. Doch auf diese concession werden wir lange warten können. Nicht weil es Trumps pathologischer Persönlichkeit gar nicht möglich ist, eine Niederlage zu akzeptieren. Sondern weil er offensichtlich andere politische Pläne hat.
Unterschätzen wir nicht die Macht der Versuche, Verwirrung zu stiften und mit absurden Manövern die Debatte zu manipulieren. Man nehme zum Beispiel den «Club» des Schweizer Fernsehens zum Kapitol-Sturm. Es war wieder einmal einer dieser Hinter-welchen-sieben-Monden-leben-wir-eigentlich-Momente.
Weitgehend unwidersprochen und die Runde souverän dominierend, exponierte dort Blocher-Leutnant Markus Somm, dass Trump bis am Morgen des 6. Januar ein genialer, konservativer Politiker gewesen war und dann, gewissermassen in einem umgekehrten Damaskus-Wunder, ganz plötzlich zum selbstzerstörerischen Unhold wurde. Politisch war er ein Genie, nur leider ist er ein Charakterlump. Will sagen: Trump hat massiv die Steuern gesenkt, mit allen Mitteln versucht, Obama-Care zu zertrümmern, den Supreme Court mit Abtreibungsgegnerinnen bestückt. Was kümmern uns da die Kratzfüsse vor dem Ku-Klux-Klan?
Auch in der helvetischen Debatte haben sich solche Argumente schon lange bestens etabliert: Rassismus, Xenophobie und systematische Propagandalügen haben mit Politik natürlich rein gar nichts zu tun. Das sind bei uns nicht Charakter-, sondern «Stilfragen». Wer das big picture plutokratischer Machtstrategien im Blick hat, darf sich an schlechtem «Stil» bestimmt nicht stossen. Wenn schon, ist er ein Gütesiegel.
Aber nicht nur weil Grundwerte nicht verhandelbar sind, auch aus strategischen Gründen war es alternativlos, dass die Demokratinnen, unterstützt durch immerhin zehn republikanische Stimmen, das Impeachment lanciert haben. Die Zukunft der amerikanischen Demokratie hängt davon ab, wie der Machtkampf innerhalb der Republikanischen Partei ausgehen wird. Die Partei, so wie sie heute existiert, muss untergehen. Nicht deshalb, weil die amerikanische Politik auf eine konservative Kraft verzichten könnte, sondern im Gegenteil: weil ein Zwei-Parteien-System, dessen eine Komponente eine antidemokratische Agenda verfolgt, die Demokratie über kurz oder lang zerstören wird.
Das Impeachment wird die Republikaner dazu zwingen, Farbe zu bekennen und ihre interne Auseinandersetzung auszutragen. Es wäre eine Katastrophe, wenn es im Senat nicht zu einer Zwei-Drittel-Mehrheit käme und Trump freigesprochen würde, aber selbst dann noch wird das Impeachment-Verfahren für diesen Klärungsprozess eine wichtige Funktion erfüllen.
Es gibt heute im Wesentlichen drei Fraktionen innerhalb der Republikanischen Partei: Erstens das kleine Trüppchen der Anständigen, die Never-Trumpers, die Gründer des Lincoln Project und unter den aktiven Parlamentsvertretern den einsamen Solitär Mitt Romney. Dann gibt es zweitens die starke Fraktion der zynischen Opportunistinnen, die geglaubt haben, es reiche, absolut alle Schändlichkeiten von Trump unbesehen hinzunehmen, um die eigene Steuersenkungs- und Big-Business-Agenda durchzubekommen, die einen Millimeter vor dem Kapitol-Sturm jetzt aber ausgestiegen sind: Mitch McConnell, Mike Pence, Liz Cheney. Als dritten Block gibt es die Fraktion derer, die das Kalkül machen, die fortgesetzte Loyalität gegenüber Trump und ein weiteres Aufrechterhalten der Wahlbetrugslüge biete ihnen die besten politischen Perspektiven: Josh Hawley, Ted Cruz, Lindsey Graham. Sie haben de facto ins Lager der offenen Demokratiefeindlichkeit gewechselt.
Das Problem ist allerdings, dass nicht nur die Loyalistinnen, sondern auch die «blossen» Zyniker – sowohl die breakers als auch die gamers, wie es Timothy Snyder in einem brillanten «New York Times»-Artikel formuliert hat – schon lange nicht mehr auf dem Boden demokratischer Grundsätze Politik machen. Sie verfolgen eine oligarchische Agenda, die den Interessen der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung zuwiderläuft und die sich nur mit der konsequenten Verzerrung der Mehrheitsverhältnisse durch das Wahlsystem und mit populistischer Rattenfängerei durchsetzen lässt.
Die Elite der brillanten, ehrgeizigen Hoffnungsträger unter den republikanischen Abgeordneten – nicht nur Hawley und Cruz, sondern zum Beispiel auch die sehr smarte, in Harvard ausgebildete Congresswoman Elise Stefanik – kommt offensichtlich zum Schluss, dass man weiterhin zu den Trump-Loyalisten gehören muss, wenn man in Washington eine grosse Zukunft haben will. Nichts sollte uns mehr beunruhigen als die Tatsache, dass eine ganze Generation knallhart kalkulierender Opportunistinnen die Rechnung macht, der offene Angriff auf die amerikanische Verfassung sei heute ihr bester Karriereplan.
Täuschen sie sich? Wird trotz allem die Fraktion der «blossen Zyniker» die amerikanische Demokratie noch vor dem Schlimmsten bewahren können? Und wird sich in einem zweiten Schritt aus seinen zersprengten Resttruppen wieder eine kohärente, demokratisch vertretbare Form des amerikanischen Konservatismus konsolidieren? Es braucht verdammt viel Optimismus, um an dieses Szenario zu glauben. Wenn das Ethos eines Mitch McConnell und einer Liz Cheney die beste unmittelbare Hoffnung für ein politisches System darstellt, steht es wirklich am Abgrund. Ohne vernünftige, konservative Partner werden die Demokraten aus dieser Krise jedoch nicht herausfinden.
Auch in Europa ist das leider grundsätzlich nicht anders.
Illustration: Alex Solman