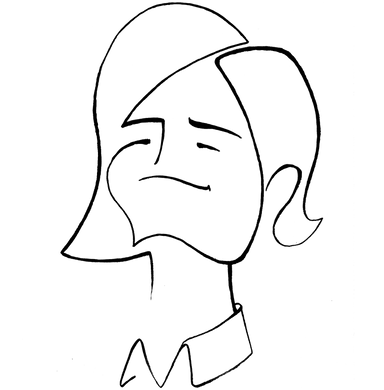
Der Hybris-Index
UBS und CS haben ihre Geschäftsberichte vorgelegt. Konjunktur herrscht vornehmlich bei den Boni. Das verheisst nichts Gutes.
Von Daniel Binswanger, 23.03.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Die UBS legte letzte Woche ihren Geschäftsbericht 2018 vor, und wie jedes Jahr hat das Salär von Sergio Ermotti – über 14 Millionen Franken – zu reden gegeben. Die Gesamtvergütung der 13-köpfigen UBS-Geschäftsleitung hat wieder die stolze 100-Millionen-Marke geknackt, zum ersten Mal seit der Finanzkrise. Gestern war die CS mit ihrem Jahresbericht an der Reihe und beweist erneut, wie hart sie ihrer grossen Schwester auf den Fersen ist: CS-CEO Tidjane Thiam kommt auf insgesamt 12,65 Millionen Jahressalär, die ganze Geschäftsleitung auf fast 94 Millionen Franken.
Weitere Kennzahlen der beiden Schweizer Grossbanken sind vergleichbar, auch wenn hier die Entwicklung leider in die entgegengesetzte Richtung läuft: Die Aktienkurse von UBS und CS fielen im Lauf des Jahres 2018 beide um über 30 Prozent. Ebenfalls nach unten bewegen sich im Fall der UBS die bereits vor ein paar Wochen kommunizierten Gewinnzahlen. Aufgrund der Verurteilung zu einer 4,5-Milliarden-Euro-Busse in Paris mussten die Rückstellungen der Bank erhöht werden. Sie beschränken sich zwar immer noch auf bescheidene 516 Millionen Franken – einen Bruchteil des Gesamtbetrags der Strafzahlung, gegen welche die UBS in Berufung gegangen ist –, tragen aber auch so zu einer spürbaren Schmälerung der Gewinne bei. Vorderhand scheint bei den Schweizer Grossbanken weiterhin das meiste nach unten zu gehen – ausser eben die Vergütungen der Chefetage.
Man kann diese bizarre Anomalie in zweierlei Hinsicht zu relativieren versuchen. Erstens: Es war auch schon viel grotesker. Ex-UBS-Chef Marcel Ospel verdiente auf dem Höhepunkt des Renditerausches der Nullerjahre 24 Millionen pro Jahr. Allerdings geschah dies damals vor dem Hintergrund nach oben schiessender Aktienkurse. Wenn man Ermottis oder Thiams und Ospels Vergütungen in ein Verhältnis zu den zu ihren Zeiten erwirtschafteten Aktienkursen setzt, erscheint Ospels Bezahlung vergleichsweise bescheiden. Zweitens lässt sich der Einwand machen, dass die ganze Diskussion um Topsaläre zwar ethisch nicht unwichtig, wirtschaftlich aber von sehr geringer Relevanz ist: 100 Millionen Franken Geschäftsleitungsvergütung ändern wenig am Gesamtergebnis. Auch dieses Argument ist absolut betrachtet richtig, vernachlässigt aber den entscheidenden Zusammenhang: Topsaläre sagen sehr viel aus über Selbstverständnis, Betriebskultur und Machtanspruch der Finanzinstitute. Sie sind gewissermassen der branchenweite Hybris-Index. Dass dieser nun wieder durch die Decke geht, verheisst nichts Gutes – für uns alle nicht.
Letztes Jahr veröffentlichte der IWF ein faszinierendes Working Paper über «die politische Ökonomie von Finanzkrisen». Es zeigt anhand historischer Rekonstruktionen, dass Banken- und Spekulationskrisen sehr stark von der Entwicklung der Regulierung beeinflusst werden – und dass diese Entwicklung immer zyklisch verläuft. Wenn das Finanzsystem in eine bedrohliche Schieflage gerät und mit staatlicher Hilfe gerettet werden muss, fühlt sich die Politik ermächtigt, mit harten Massnahmen durchzugreifen, die fehlbaren Institutionen an die Kandare zu nehmen und alles zu unternehmen, damit eine solche Krise sich nie mehr wiederholen möge. Sie erhält dabei Sukkurs von der breiten Bevölkerung, die unter den Folgen der ökonomischen Notlage leidet und ihren heiligen Zorn gegen die Abzocker richtet.
Genau so war es im Nachgang zur Krise von 2008: Es wurden einschneidende Regulierungen beschlossen, das Bankgeheimnis für Offshore-Kapital wurde abgeschafft und die obligatorische Kapitalisierung der Banken stark erhöht.
Die Geschichte der Finanzmarktregulierung zeigt allerdings noch ein Zweites: Es gilt das eherne Gesetz, dass der Impetus der Finanzmarktregulierung nach einer gewissen Zeit wieder erlahmt. Wenn sich die Situation entspannt hat, die Banken einigermassen stabilisiert sind und sich das öffentliche Interesse wieder anderen Dingen zuwendet, verschiebt sich die Machtbalance zwischen Finanzindustrie und Politik empfindlich. Der aufsichtsrechtliche Aktivismus der Post-Krisen-Periode schlägt um in eine Phase erneuter Deregulierung. Die Marktakteure profitieren von der wiedergefundenen Freiheit und erleben einen Boom – bis nach einer gewissen Zeit die Risiken von Neuem unkontrollierbar werden, die Dinge aus dem Ruder laufen, die nächste Krise kommt und der Zyklus wieder von vorn beginnen kann. Das ist der Grund, weshalb der Hybris-Index der CEO-Vergütungen durchaus relevant ist. Unsere Banken sind zwar weit davon entfernt, wieder auf gesichertem Erfolgskurs zu sein, aber sie legen schon seit geraumer Zeit wieder ein verblüffendes Selbstbewusstsein an den Tag.
Das zeigt sich in aller Deutlichkeit am politischen Lobbying: Die Bankiervereinigung befindet sich schon länger im Modus der Dauermobilisierung gegen den sogenannten «Swiss Finish» der Bankenregulierung und wird wohl nicht ruhen, bevor sie die letzte Schweizer Sondermassnahme, die über den internationalen Standard hinausgeht, wieder geschleift hat. Unmittelbar nach der Finanzkrise herrschte parteienübergreifender Konsens, dass ein «Swiss Finish» für den extrem exponierten Schweizer Finanzplatz absolut unverzichtbar sei. Mittlerweile agieren SVP und FDP wieder weitgehend so, als wäre ihr Mandat die simple Interessenvertretung der Bahnhofstrasse.
Besonders flagrant zeigte sich das jüngst, als die rechten Parteien im Ständerat eine «Lex UBS» durchbringen wollten, die es der Grossbank ermöglichen würde, ihre in Paris zu zahlende Mega-Busse zum grösseren Teil von den Steuern abziehen zu können. Komplexfreier kann wirtschaftliches Lobbying die Politik eigentlich kaum vor den eigenen Karren spannen. Aber so wie die Machtverhältnisse offenbar wieder liegen, braucht die UBS auch keine Komplexe zu haben.
Das ist besonders unerfreulich im Hinblick auf die nächsten Regulierungsabbaurunden, die so sicher kommen werden wie das Amen in der Kirche. Donald Trump hat schon vor knapp einem Jahr die amerikanischen Finanzmarktregulierungen massiv zurückgefahren – unter grossem Applaus der europäischen und schweizerischen Bankenvertreter, die seither nicht müde werden zu betonen, dass man diesseits des Atlantiks unbedingt nachziehen müsse. Vor zwei Wochen hat das Fed nun weitere Lockerungen angekündigt. Die Dynamik der Deregulierung wird immer getrieben von Standortkonkurrenz und Innovation. So war es vor der letzten Finanzkrise – so wird es auch vor der nächsten wieder sein. Es würde sehr wundern, wenn die obligatorische Kapitalisierung der Finanzinstitute in Zukunft nicht wieder sinken würde. Schliesslich müssen die Schweizer Banken wettbewerbsfähig bleiben. Und irgendetwas muss geschehen – so wird man es den Behörden mit dem geforderten Nachdruck zu verstehen geben –, damit die Talfahrt der Aktienkurse der beiden Schweizer Grossbanken endlich an ein Ende kommt.
Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wer alles lernt, alles korrigiert – und dann alles wieder vergisst, ist dazu verdammt, nur kurzzeitig besser zu fahren.
Illustration: Alex Solman
Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger
Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen vermissen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.