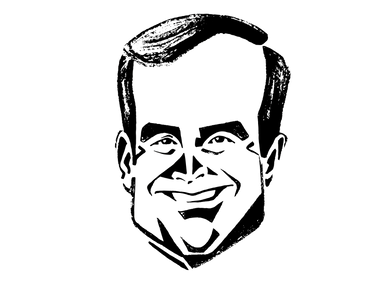
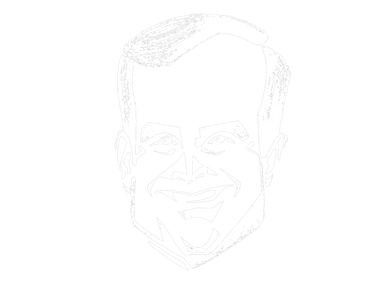
Konkordanz und Kollegialität sind unter Druck
Dass Bundesräte jederzeit zurücktreten können, nützt nur den Parteien, nicht dem Land. Es gäbe ein besseres System.
Von Gerhard Pfister, 26.03.2024
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Der ehemalige Bundesrat Adolf Ogi wurde während des Abstimmungskampfs um die 13. AHV-Rente schmerzhaft mit der Realität konfrontiert. Weil er einen Brief an ältere Menschen mitunterzeichnete, in dem er die Volksinitiative als «brandgefährlich» bezeichnete, bekam er ziemlich viel unerfreuliche Post.
Ogi war empört: Es gehe nicht an, dass man Alt-Bundesräte derart diffamiere, sagte er in den Medien. Auch sie seien Menschen mit Rechten und Pflichten. Zweifellos ist ihm diesbezüglich zuzustimmen. Warum er aber nur Alt-Bundesräten das Recht zugestehen wollte, nicht diffamiert zu werden, bleibt sein Geheimnis. Er glaubt offenbar, (ehemaligen) Mitgliedern des Bundesrats stünden besondere Privilegien zu. Wie kommt er zu dieser Haltung?
Die Antwort auf die Frage hat weniger mit der Person Adolf Ogi zu tun. Immerhin hatte er nach der Abstimmung die Grösse einzugestehen, dass mindestens die Wortwahl des offenen Briefes inadäquat war, und entschuldigte sich. Die Antwort hat vielmehr erstens mit institutionellen und zweitens mit faktischen Rahmenbedingungen zu tun, innerhalb derer die Schweizer Regierung agiert.
Denn der Bundesrat steht über den Parteien, über den Niederungen der harten Auseinandersetzungen in Abstimmungskämpfen. Ob in der Arena, in den Medien oder auch im Parlament: Mitglieder des Bundesrats werden geschont. Staatspolitisch streng genommen, dürften sie gar keine Abstimmungsvorlagen vertreten. Denn die Gesetze und Initiativen sind Beschlüsse der Bundesversammlung, nicht des Bundesrats. Der Bundesrat macht Vorschläge, die abschliessende Entscheidung liegt beim Parlament. Dennoch werden Mitglieder des Bundesrats von den Parteien und den Komitees sehr gerne eingesetzt in Abstimmungskämpfen. Denn der Bundesrat hat den Status der Überparteilichkeit, fast schon der Neutralität, ganz sicher aber wird er als glaubwürdiger wahrgenommen als die Mitglieder des Parlaments oder die Vertretungen von Verbänden.
Diese Überparteilichkeit ist institutionell durchaus gewollt. Sie ist die Folge der Konkordanz und der Kollegialität. Die Konkordanz verlangt die Repräsentanz der wichtigsten Parteien in der Regierung gemäss ihrer Wählerstärke. Die Kollegialität verlangt die Bereitschaft der Mitglieder der konkordant gebildeten Regierung zusammenzuarbeiten und die Beschlüsse gemeinsam und einheitlich nach aussen zu vertreten – auch und gerade dann, wenn ein Mitglied eine andere Meinung hat. Diese Einbindungs- und Konsensmechanismen führen zu breit abgestützten Entscheiden, die anschliessend in der Beratung im Parlament und in Volksabstimmungen Bestand haben können.
Deshalb ist die Kritik aus der Bevölkerung verständlich. Indem sich die ehemaligen Mitglieder des Bundesrats mit ihrem Brief klar positionierten, in einer ohnehin schon sehr emotionalen Debatte, wurden sie nicht mehr als überparteilich wahrgenommen, sondern als blosse Abstimmungskämpfer für die eine Seite. Ogi vergass, dass er, wenn er sich in die Arena der politischen Auseinandersetzung begibt, auch den Staub in Kauf nehmen muss, den er damit aufwirbelt.
Aber Konkordanz und Kollegialität sind unter Druck. Einerseits von der SVP, die als stärkste Partei zwar numerisch legitimen Anspruch auf zwei Sitze hat. Aber die sich so verhält, als sei sie nicht stärkste Regierungspartei, sondern Opposition. Und die ihre Bundesräte gerne nur noch als «halbe» bezeichnet, wenn sie von der Parteilinie abweichen. Andererseits ist die Konkordanz unter Druck, weil die Wahlresultate von 2019 und 2023 den Anspruch der FDP auf zwei Sitze nicht mehr ausreichend legitimieren.
Wir haben uns angewöhnt, dass wir dem Bundesrat Privilegien zugestehen, die man heute zumindest hinterfragen kann. Dass er gratis in der ganzen Schweiz Ski- oder Snowboard fahren darf, ist eines. Dass dieses Privileg, nachdem die Bergbahnen es nicht mehr bezahlen dürfen, einfach die Steuerzahlerinnen übernehmen sollen, hat der Bundesrat sehr schnell entschieden. Ein Zeichen besonderer Volksnähe ist das nicht. Man mag diese Kritik kleinlich finden. Aber in der direkten Demokratie ist es auch die Summe von Kleinigkeiten, die das Vertrauen in die Politik stärkt oder schwächt.
Ein weiteres Privileg, das wie aus der Zeit gefallen scheint: Bundesrätinnen können jederzeit, ohne Rücksprache, zurücktreten. Sie werden zwar bei den Gesamterneuerungswahlen für eine ganze Legislatur gewählt, aber sie sind nicht verpflichtet, das Amt auch vier Jahre auszuüben. Im Gegenteil: Ihre Rücktritte sind öfter so geplant, dass sie ihren Parteien den Erhalt des Sitzes ermöglichen. Wohlverstanden: Ein Rücktritt aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen wie der von Bundesrätin Simonetta Sommaruga muss weiterhin legitim sein. Aber ist es staatspolitisch sinnvoll, dass Mitglieder des Bundesrats grundsätzlich frei sind zu entscheiden, wie lange sie ihr Amt ausüben wollen und zu welchem Zeitpunkt sie zurücktreten?
Die Bundesversammlung ist schon länger dazu übergegangen, sich bei Bundesratswahlen streng an die «Tickets» der vorschlagenden Fraktionen zu halten. Die SVP hat nach der Nichtwiederwahl Christoph Blochers sehr hohe Hürden beschlossen, sodass ein Parteiausschluss droht, wenn eine Kandidatin gewählt wird, die nicht offiziell von der Fraktion vorgeschlagen wurde. Die anderen Fraktionen sind dazu übergegangen, diese Praxis zu respektieren, aus Angst, dass bei der Wahl für ihre Sitze nicht offizielle Kandidaten gewählt würden. Meines Erachtens spricht nicht mehr viel dafür.
(Wer sich fragt, ob es denn nicht eher darauf ankomme, ob eine Kandidatin für das Amt fähig sei, dem sei gesagt, dass es eher als selbstverständlich gilt, dass Kandidatinnen die Fähigkeiten für das Amt vorweisen. Genauer überprüfen will oder kann das die Bundesversammlung nicht. Die dominierende Frage bei Bundesratswahlen lautet: «Wer will?», und nicht: «Wer kanns?».)
Sinnvoll wäre deshalb eine Amtszeitbeschränkung auf acht Jahre, wenn gleichzeitig ein Rücktritt nur aus wichtigsten persönlichen, familiären oder gesundheitlichen Gründen möglich wäre. Gesamterneuerungswahlen hätten dann auch echte Folgen, was die Zauberformel angeht: Bei einer Amtszeitbeschränkung auf acht Jahre wäre gewährleistet, dass in der Regel mehrere Bundesratssitze gleichzeitig neu zu besetzen wären. Damit wäre es eher denkbar, dass eine Mehrheit der Bundesversammlung die Sitze gemäss dem Wahlresultat verteilen würde, und weniger wahrscheinlich, dass eine Partei trotz ungenügender Wählerinnenstärke ihre Sitze behalten könnte.
Was spricht gegen eine Amtszeitbeschränkung und ein Rücktrittsverbot während der Legislatur? Das erste übliche Gegenargument ist das «lame duck»-Phänomen: Man nimmt an, dass ein Regierungsmitglied, dessen Amtszeit zu Ende geht, nicht mehr genügend politische Kraft hat, um wichtige Reformen oder grosse Projekte durchzusetzen.
Ich halte dieses Argument in der Schweiz nicht für plausibel. Wir kennen keine Regierungs- und Oppositionsdichotomie und entsprechende Wechsel dieser Konstellation nach Wahlen. Sondern wir haben eine konkordante Regierung, die Projekte über Jahre begleitet, in zwei Räten vorbereitet und durchbringt und anschliessend gegebenenfalls in Volksabstimmungen vertreten muss. Das heisst: Jedes Mitglied des Bundesrats hat Projekte, die in verschiedenen Stadien sind, begleitet von der Verwaltung, und dieser Strom hört nie auf, regelmässig und ruhig dahinzufliessen.
Ein Beispiel: Die neue Vorsteherin des Innendepartements, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, musste in den ersten Abstimmungen dieses Jahres Vorlagen vertreten, die vollständig von ihrem Departementsvorgänger Alain Berset begleitet und im Parlament vertreten worden waren. Doch das hatte meines Erachtens kaum Einfluss auf die Abstimmungsresultate. Sie übernahm das Dossier, vertrat die Position des Bundesrats, und die Tatsache, dass sie erst seit dem 1. Januar 2024 diese Aufgabe innehatte, spielte keine Rolle.
Das zweite Gegenargument könnte lauten: Zu viele Mitglieder des Bundesrats müssten gleichzeitig ersetzt werden, und damit wäre die Kontinuität gefährdet. Dem ist entgegenzuhalten, dass diese Disruption einer angeblichen Kontinuität ja bereits jetzt von den Bundesratsmitgliedern verursacht wird: Departementsrochaden sind je nach Interesse, Machtanspruch und persönlicher Befindlichkeit offenbar kein Problem – weder für die Regierung noch das Parlament, noch die Öffentlichkeit, egal wie kurz jemand nur im Verteidigungsdepartement ausharren wollte. Zudem sind praktisch alle neu gewählten Mitglieder des Bundesrats entweder ehemalige oder aktive Parlaments- oder Regierungsratsmitglieder, was ihnen die Einarbeitung ins neue Amt einfacher macht.
Das dritte Gegenargument ist eines, das mit der Wahrnehmung des Bundesrats als eine Art Ersatzmonarchie zu tun hat: Das Amt sei derart kräftezehrend, ein derartig belastender Dienst am Vaterland, dass es geboten erscheine, diesen Heroinnen des Landeswohls das Privileg des selbstbestimmten Rücktritts zuzugestehen.
Diese Auffassung ist naiv. Im Gegenteil: Vor der Wahl in den Bundesrat versprechen alle Kandidaten, das Landeswohl im Auge zu behalten. Was für die Wahl gilt, sollte auch für das Ende der Amtszeit gelten.
Wenn wir die Konkordanz erhalten wollen, dann müssen wir der Entwicklung Rechnung tragen, dass sich seit der Einführung der Zauberformel die Parteienlandschaft pluralisiert hat. Das Ziel der Zauberformel, die Abbildung der realen Kräfteverhältnisse, ist gegenwärtig nicht erreicht. SVP und FDP haben eine Mehrheit im Bundesrat. Sie haben diese Mehrheit weder beim Volk (gemessen an den Wähleranteilen) noch in der Bundesversammlung (gemessen an Sitzen in National- und Ständerat).
Wahlen sollten Folgen haben. In der Schweiz wählt nicht das Volk die Regierung, sondern das Parlament. Wenn das Parlament die Resultate der Wahlen nicht umsetzt, weil die Parteien an ihren Machtansprüchen festhalten, führt das zu einer grösseren Distanz zwischen den politischen Eliten und der Bevölkerung.
Wäre die maximale Amtszeit für den Bundesrat jetzt in Kraft, verbunden mit der Regelung, dass niemand während der Legislatur zurücktreten darf, würden nach den Wahlen 2027 vier Sitze im Bundesrat frei. Ausreichend, um der Bundesversammlung die Möglichkeit zu geben, die Regierung wieder konkordant zusammenzusetzen, und die Kräfteverhältnisse unter den Parteien im Bundesrat genauer abzubilden, als es jetzt der Fall ist. Wir sollten es jetzt angehen.
Illustration: Alex Solman