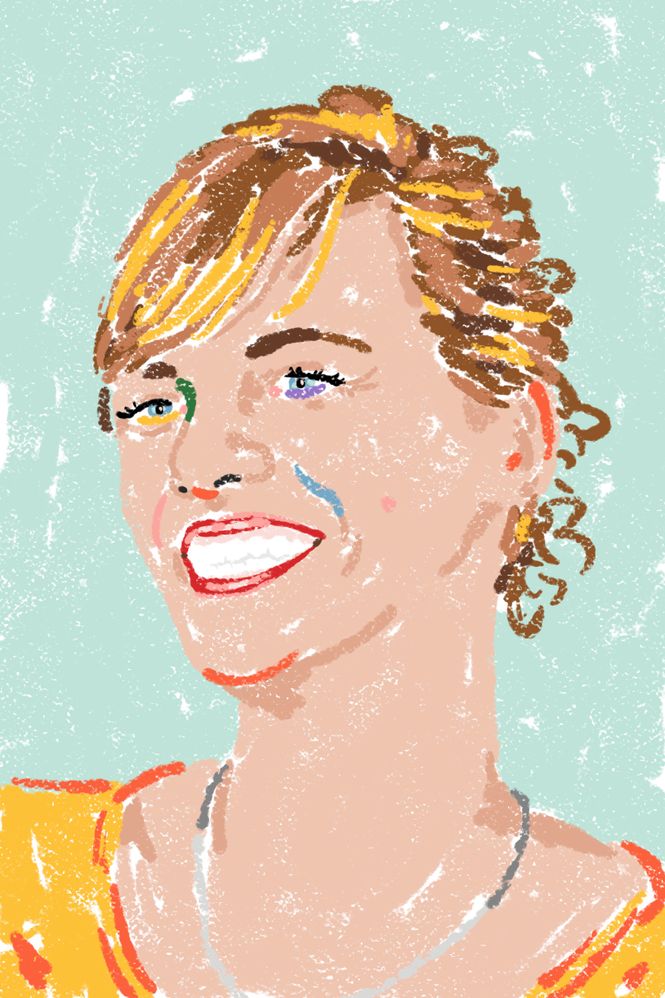
«Jemanden überzeugen? Das kann man sich meistens sparen»
Sie sind es müde, immer wieder die gleichen Fragen zu diskutieren? Die Philosophin und Argumentationstrainerin Romy Jaster verrät, wie wir wieder streiten lernen. Ein Gespräch zum Jahreswechsel.
Von Elia Blülle, Carlos Hanimann (Text) und Luis Mazón (Illustration), 23.12.2023
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Frau Jaster, wann haben Sie das letzte Mal eine gute Debatte geführt?
Das passiert mir täglich von Berufs wegen. Ich bin Philosophin und finde, dass eine der besten Eigenschaften der akademischen Philosophie ist, dass die Streitkultur so gut ist. Und dass man eigentlich so gut wie jedes noch so brisante Thema in einer wirklich sachlichen und wertschätzenden Weise diskutiert.
Wie gelingt ein Gespräch?
Indem man es als positiv begreift, wenn die Diskussionspartnerin die Dinge ganz anders sieht als man selbst. In der Philosophie sprechen wir auch vom Prinzip des Wohlwollens. Wenn man in den sozialen Netzwerken Streit oder Debatten verfolgt, kann man feststellen, dass die Leute einander sehr schnell entweder Dummheit oder Bösartigkeit unterstellen. Und wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass die andere Person trotz inhaltlicher Differenz hehre Absichten verfolgt, dann ist ein gutes Fundament gelegt für einen gelingenden Streit.
Wie geht man mit Leuten um, die kein Wohlwollen in das Gespräch mitbringen?
Mit Leuten, die keinerlei Bereitschaft zum wohlmeinenden Austausch zeigen, hat das Reden keinen Sinn. Ich würde nicht versuchen, mit jedem sinistren Demagogen auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber glücklicherweise ist die Zahl dieser Leute ja klein im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Insofern würde ich sagen: Ja, diese Leute gehören ausgeschlossen von gewissen Diskursen. Die Herausforderung besteht dann aber darin, die Leute zu identifizieren, für die das wirklich gilt. Sonst schliesst man alle aus, die nicht die gleiche Meinung teilen wie ich.
Beobachten Sie das?
Ja, die Bereitschaft, sich ernsthaft und tiefgreifend mit widerstreitenden Positionen auseinanderzusetzen, halte ich derzeit für nicht besonders hoch.
Romy Jaster lehrt und forscht am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität in Berlin, sie ist dort auch Gründerin und Leiterin des Forums für Streitkultur. Sie beschäftigt sich mit Willensfreiheit, Fähigkeiten, Fake News und konstruktivem Diskurs. 2020 ist ihr Buch «Agents’ Abilities» erschienen, 2019 das gemeinsam mit David Lanius verfasste Buch «Die Wahrheit schafft sich ab: Wie Fake News Politik machen».
Unsere Beobachtung ist, dass das gegenseitige Wohlwollen häufig wegfällt.
Ich teile diesen Eindruck. Und ich glaube, der Grund ist, dass wir sehr viel mit Positionen konfrontiert sind, die unseren Ansichten zuwiderlaufen. Das fordert uns stark heraus.
Tatsächlich? Es wird doch ständig gesagt, wir lebten nur noch in Blasen.
Ich würde mich da in einigen Punkten konträr zu den gängigen Thesen positionieren. Wir leben schon in Bubbles, aber das war schon immer so. Das lässt sich sozialpsychologisch gut erklären: Es verursacht Stress, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die das eigene Wertesystem oder fundamentale Überzeugungen infrage stellen. Deswegen bewegen sich Leute eher unter Gleichdenkenden. Es ist kein neuer Befund, dass es diese Tendenz gibt im analogen Raum. Was ich aber kritisch sehe, ist die Diagnose, dass sich das im digitalen Raum noch verschärfe.
Wie meinen Sie das?
Der digitale Raum wird ja nicht grundlos als ein Kampfplatz wahrgenommen. Dort treffen wir viel häufiger auf Andersdenkende, die vollkommen unterschiedliche Ansichten zu Fragen haben, die oft identitätsstiftend sind.
Sie meinen zum Beispiel die Genderdebatte.
Genau. Soll man gendern? Gibt es mehr als zwei Geschlechter? Das scheint sehr tief mit Identitätsfragen verknüpft zu sein. Und im normalen, analogen Leben ergeben sich nicht so oft Situationen, wo man mit jemandem crasht, der das komplett anders sieht.
Aber im Internet erklärt man den anderen, wie dumm und einfältig man sie findet.
Deshalb gibt es auch Grund zur Annahme, dass es im Internet trotzdem auch so etwas gibt, das sich als Blaseneffekte beschreiben lässt.
Nämlich?
Dass man die, die anders denken, gar nicht ernst nimmt. Dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, es könnte sich lohnen, sich mit deren Argumentationen auseinanderzusetzen. Man betrachtet nur die als ebenbürtige Diskussionspartnerinnen, die weitestgehend die gleiche Meinung haben.
Warum?
Wenn mir eine Person im Internet begegnet, die ich nicht persönlich kenne, dann tritt sie mir nur als Stellvertreterin einer bestimmten Meinung entgegen. Ich weiss über diese Person nichts, ausser dass sie einmalig oder sogar dauernd Dinge sagt, die mir nicht passen. Im analogen Kontext sehen wir, dass diese Person vielleicht lacht, zweifelt, hadert. Und wir sind uns an einem Ort begegnet, der uns eine gewisse Gemeinsamkeit verleiht – eine Familienfeier, ein Schulfest, ein Seminarraum, eine Bar. Wir nehmen das Gegenüber als Mensch wahr und nicht bloss als irgendein Ei auf Twitter.
Eigentlich macht es doch niemandem Spass, im Internet rumzustänkern.
Aber man bekommt den Beifall der – ich sage jetzt mal – Stammesangehörigen. Im analogen Raum ist das nicht so. Da habe ich ja nicht immer meine Clique hinter mir, die mich anfeuert, wenn ich in einen Streit gehe. Ich bin da in aller Regel allein in einer spannungsreichen sozialen Situation. Das versuche ich zu vermeiden.
Zerstört das Schielen auf Likes die gute Absicht?
Man will gar nicht im Gespräch bleiben, sondern gewinnen. Der digitale Beifall verkehrt die eigentlich unangenehme Konfrontation in etwas Positives. Wenn ich hingegen auf einer Zugfahrt mit einer fremden Person über eine politische Frage streite, dann suche ich eher den Konsens. Im Internet werde ich von meiner Crowd dafür belohnt, dass es knallt.
Wir verbringen durchschnittlich drei bis sechs Stunden pro Tag am Handy …
… ich glaube, manche Leute sogar mehr …
… überträgt sich diese digitale Streitkultur auch ins reale Leben?
Ich glaube, ja. Mindestens in dem Sinne, dass man sich gar nicht inhaltlich mit der anderen Seite auseinandersetzen will. So scheint sich in bestimmten Diskursen gerade die Norm zu verfestigen, dass es völlig in Ordnung sei, sich nicht mit den Argumenten der Gegenseite zu beschäftigen. Oder es gilt plötzlich als angemessene Reaktion, den gegenläufigen Standpunkt zu diskreditieren. Das scheint mir in den analogen Raum zu schwappen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass an Universitäten die Bereitschaft abnimmt, Vorträge von Leuten zu hören, die Thesen vertreten, von denen man findet, dass die fundamental falsch oder moralisch problematisch sind.
Sind Sie der Ansicht, die jüngeren Menschen hielten nichts mehr aus, seien alle snowflakes?
Ich würde das nicht von der Generation abhängig machen. War das früher anders? Ich kann das nicht beurteilen, ich bin nicht so alt. Meine älteren Kollegen an der Universität sagen, das sei so. Es habe eine Streitkultur gegeben, in der es völlig klar gewesen sei, dass man sich in der Sache fetzen und einander trotzdem persönlich zugewandt sein kann. Wenn das stimmt, dann ist das ein grosser Unterschied zu heute. Aber vielleicht ist das auch nur eine Idealisierung vergangener Zeiten. Das will ich zumindest nicht ausschliessen.
Wir leben in einer sehr konfliktreichen Zeit. Und gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Harmonie sehr gross. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja. Heute werden nicht minder starke Standpunkte eingenommen als früher – zu allen möglichen Fragen. Aber kaum jemand hat Lust, diese Konflikte wirklich auszutragen.
Uns fällt auf, dass sich manchmal Leute der Diskussion entziehen mit dem Argument, sie seien es leid, immer die gleichen Dinge zu erklären.
Ja, das finde ich diskursfaul.
Nicht etwa verständlich?
Es kann natürlich nicht sein, dass immer die, die von Rassismus betroffen sind, den anderen erklären müssen, was Rassismus ist. Das ist verständlich. Aber es gibt ja genug Leute, die nicht davon betroffen sind und diese Arbeit übernehmen können. Wenn man sich gesellschaftlichen Fortschritt wünscht, dann reicht es nicht, sich nur selbst zu vergewissern. Gesellschaftliche Entwicklung findet statt, weil es hinreichend viele Leute gibt, die nicht müde werden, diesen Diskurs immer wieder zu führen. Eine Zeit lang las man auf Social Media ständig «ich bin so müde». Ja, okay, dann schlaf dich einmal aus. Aber am nächsten Tag: wieder diskutieren. Es kann ja niemand erwarten, dass alle die Welt von sich aus bereits schon so sehen, wie man selbst sie sieht. So ist es halt einfach nicht.
Unser Eindruck ist, dass viele Debatten in einer Art Lagerdenken stecken, am heftigsten sieht man das vielleicht am Beispiel des Kriegs im Nahen Osten: Offenbar fällt es gerade vielen schwer, dass man sowohl die Terrorangriffe der Hamas als auch die israelische Bombardierung von Zivilistinnen in Gaza verurteilen kann – ohne sich deswegen gleich zu einer Seite zu bekennen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel für fehlende Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, auszuhalten, dass zwei Tatsachen gleichzeitig wahr sein können, die auf den ersten Blick in einer gewissen Spannung zueinanderstehen. Es gibt ja in Wirklichkeit gar keinen Konflikt zwischen diesen beiden Feststellungen: Das Morden der Hamas ist schrecklich, und das Leid der Menschen in Gaza ist auch schrecklich.
Trotzdem gibt es den Druck, man müsse sich auf eine Seite schlagen.
Der entsteht, weil die Feststellungen unterschiedliche Handlungen nahelegen: Wenn es eine humanitäre Katastrophe in Gaza gibt, liegt nah, dass den Zivilisten dort geholfen werden muss. Und das ist offensichtlich schwierig, solange Israel Krieg führt. Also ergibt sich daraus, dass Israel zunächst aufhören müsste, Krieg zu führen. Wenn es aber auch wahr ist, dass die Hamas eine existenzielle Bedrohung für die israelische Bevölkerung darstellt, dann muss Israel die Hamas eliminieren und in Gaza einmarschieren. Erst wenn man diese Handlungsoptionen – Rückzug oder Einmarsch – in die Diskussion einbezieht, entsteht ein Konflikt.
Wir führen also eine Art Stellvertreterdiskussion?
Viele haben das Gefühl, mehrere Wahrheiten festzustellen, bedeute bereits, sich mit Blick auf die daraus zu ziehenden praktischen oder politischen Konsequenzen zu positionieren. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel: Wenn man findet, es sei nicht eindeutig, ob trans Frauen im selben Sinne Frauen sind wie biologische Frauen, dann liegt nah, dass diese Unterscheidung auch im Alltag eine Rolle spielen könnte. Also etwa bei der Frage, ob eine trans Frau Zugang zu Frauengefängnissen oder Frauenhäusern bekommen soll.
Das heisst, man diskutiert dann eigentlich nicht die ursprüngliche Frage, sondern bereits die möglichen Folgen, die daraus entstehen könnten?
Genau. Dann geht es in der Diskussion plötzlich weniger um die Frage, ob eine trans Frau eine Frau ist, sondern darum, ob sie Zugang zum Frauenhaus bekommen soll.
Das klingt nachvollziehbar.
Vermutlich könnte man das für alle Grabenkämpfe durchexerzieren. Aber es ist tatsächlich sehr herausfordernd, anzuerkennen, dass auf der einen Ebene zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können und auf einer anderen Ebene wiederum schwierige Konflikte daraus entstehen.
Andererseits leben viele öffentliche Debattenformate ja gerade von diesen sehr polarisierten Konflikten und der Spannung, die daraus entsteht.
Es gibt bessere und schlechtere Argumente, dass man das so macht. Man will zum Beispiel, dass es hoch hergeht.
Jetzt mal ehrlich: Es macht doch auch Spass, wenn es knallt.
Wenn es nur um die Quote geht, ist das sicher kein gutes Argument. Aber ich habe auch schon ein besseres Argument gehört, dass das nämlich eine gewisse kathartische Wirkung hat. Wenn es bei Anne Will … oder was haben Sie Vergleichbares in der Schweiz?
Anne Will kennen wir auch.
Wenn es bei Anne Will richtig knallt, dann ist sozusagen der öffentliche Friede hergestellt. Ich habe auch schon das Argument gehört, dass man da die unterschiedlichen Positionen aufeinander loslässt, damit die Zuschauerin dabei zugucken kann, wie die jeweilige Position abschneidet, wenn sie einer harten Auseinandersetzung standhalten muss – wie in einem Gladiatorenkampf.
Es ist uns etwas unangenehm, aber aus der Redaktion kam der dringende Wunsch, dass wir mit Ihnen auch über Weihnachten und den unvermeidbaren Streit am Familientisch sprechen …
Ja, diese Frage kommt tatsächlich jedes Jahr.
Wie auch der mühsame Wutbürger-Onkel …
Das Gute ist, dass bei einem solchen Weihnachtsessen, anders als etwa in den sozialen Netzwerken, eine gewisse Zivilität herrscht. Wir hauen selbst dem verhassten Onkel nicht Dinge um die Ohren, wie wir das im Internet tun würden. Aber Verwandte können uns mit wenig Aufwand extrem auf die Palme bringen. Die eigene Mutter etwa kann uns mit gewissen Verhaltensweisen wahnsinnig machen, die Umstehende gar nicht mitbekommen. Warum das so ist, weiss ich nicht, das liegt ausserhalb meiner wissenschaftlichen Expertise. Aus eigener Erfahrung weiss ich nur, dass das so ist.
Wenn die eigene Mutter Quatsch erzählt, geht uns das nahe.
Die eigene Mutter liebt man halt, und es kann enttäuschen, wenn diese Person plötzlich Dinge sagt, die dem eigenen Wertekompass komplett zuwiderlaufen. Da kann es sein, dass ich Respekt vor ihr verliere, was wiederum die Beziehung insgesamt gefährdet. Das fühlt sich bei der Mutter natürlich viel bedrohlicher an als bei einer Person, die ich gerade im Hostel kennengelernt habe und wahrscheinlich nie wieder sehe.
Dann versucht man ja oft, die eigene Mutter oder den mühsamen Onkel von der eigenen Meinung zu überzeugen. Wie sinnvoll ist das?
Jemanden in einer einzelnen Diskussion zu überzeugen, ist extrem schwierig. Das kann man sich meistens sparen. Mit diesem Ziel in die Diskussion zu gehen, ist zudem sehr konfrontativ. Man tritt ja mit der Haltung an, die andere Person verändern oder die Auseinandersetzung gewinnen zu wollen. Man will, dass die andere Person unterliegt. Das kann nicht funktionieren.
Was wäre besser?
Wenn man nicht will, dass es knallt, aber auch nicht stehen lassen will, was der mühsame Onkel so sagt, dann kann man ihm viele kritische Fragen stellen. Das wirkt oft entschärfend.
Aber dann habe ich ihm noch nicht die Meinung gegeigt.
Aber warum muss der denn wissen, wie Sie die Dinge sehen? Er wird die Dinge deswegen nicht so sehen wie Sie. Viel interessanter ist doch, ob man ihn durch geschicktes Fragen dazu bringt, selbst etwas zu sehen. Oder etwas zu begründen, das er sonst nie begründen muss, sodass er dadurch vielleicht den festen Stand verliert. Das ist eine Möglichkeit: einfach zu sagen, heute sag ich überhaupt nichts dazu, wie ich die Dinge sehe. Ich frage nur nach.
Wie beendet man eigentlich auf gute Weise ein Gespräch?
Das machen Sie mir sicher gleich vor.
Dann tun wir es wie «Der Spiegel»: Frau Jaster, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.