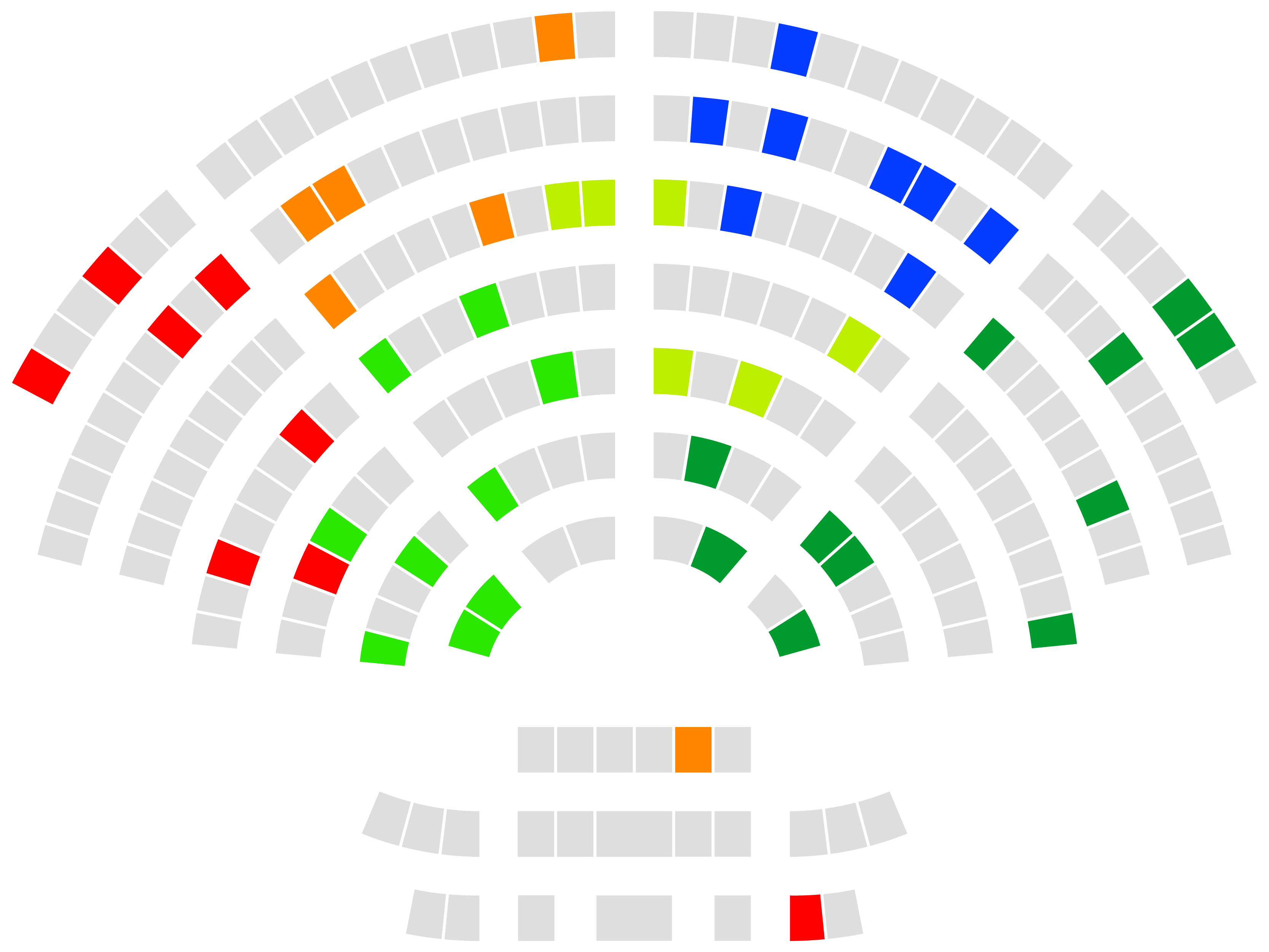
Wer entscheidet Wahlen? Vor allem alte Männer – aber junge Frauen holen auf
Nicht einmal die Hälfte aller Wahlberechtigten geht an die Urne. Bei den Jungen liegt die Beteiligung sogar noch tiefer. Auftakt der neuen Reihe zu den Schweizer Wahlen im Herbst.
Von Sarah Bütikofer, 24.07.2023
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Von den 8,7 Millionen Menschen, die in der Schweiz leben, sind lediglich 5,5 Millionen stimm- und wahlberechtigt. Rund ein Viertel der Bevölkerung besitzt kein Schweizer Bürgerrecht und ist deshalb von den eidgenössischen Wahlen ausgeschlossen. Doch auch längst nicht alle, die wählen dürfen, tun das regelmässig. In den letzten Jahrzehnten haben im Durchschnitt jeweils nur knapp die Hälfte aller Wahlberechtigten an den nationalen Wahlen teilgenommen.
Die rege Teilnahme der Bürger an politischen Prozessen ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Doch ausgerechnet in der direktdemokratischen Schweiz liegt die Wahlbeteiligung deutlich tiefer als in den meisten anderen Ländern.
Der Hauptgrund: Wahlen gelten in der Schweiz als nicht so wichtig. Schliesslich können Bürgerinnen bei Abstimmungen regelmässig Stellung zu konkreten Sachfragen nehmen – das im Gegensatz zu anderen Staaten, wo nur alle paar Jahre ein Parlament und allenfalls eine Regierung gewählt werden kann. Auch die Komplexität des politischen Systems der Schweiz ist einer hohen Wahlbeteiligung nicht förderlich. Zudem betrachtet nur eine Minderheit das Wählen als Bürgerpflicht.
Sarah Bütikofer ist Politikwissenschaftlerin, Herausgeberin von «De Facto», der Online-Plattform der Schweizer Politikwissenschaft, sowie Projektpartnerin beim Forschungsinstitut Sotomo. Sie begleitet den laufenden Wahlkampf für die «Republik» mit regelmässigen Beiträgen.
Allerdings gilt es zu differenzieren. In der Schweiz nimmt nicht immer die gleiche Hälfte der Wahlberechtigten tatsächlich an Wahlen teil. Viele Bürger partizipieren selektiv. Sie entscheiden von Fall zu Fall, ob sie an einer Wahl oder an einer Abstimmung teilnehmen oder nicht. Im Lauf einer vierjährigen Legislaturperiode nehmen alles in allem vier von fünf Personen mindestens an einem Urnengang teil.
Nur jeder Dritte unter 30 geht wählen
Was wissenschaftliche Analysen auch zeigen: In gewissen Teilen der Bevölkerung ist die Wahlbeteiligung deutlich höher als 50 Prozent – und in gewissen deutlich tiefer.
Am fleissigsten wählen die über 65-Jährigen, vor allem die über 65-jährigen Männer. An vielen nationalen Wahlen der letzten Jahre war ihre Teilnahme fast doppelt so hoch wie diejenige der Jungen. Bei diesen sieht es so aus: Seit 1971 haben im Durchschnitt lediglich drei von zehn Wahlberechtigten unter 30 an eidgenössischen Wahlen teilgenommen.
Wahlbeteiligung bei nationalen Wahlen 1971 bis 2019
Nach Altersgruppen
Quelle: «Swiss Election Study (Selects), Cumulative Dataset 1971–2019»
Die Schweiz bildet diesbezüglich keine Ausnahme. Auf der ganzen Welt ist die politische Teilnahme bei älteren Personen höher als bei jüngeren. Es gibt viele Gründe, wieso junge Erwachsene weniger an politischen Prozessen teilnehmen. Auch wenn einige von ihnen durchaus stark an Politik interessiert sind, haben viele noch keine gefestigte politische Haltung. Für die Mehrheit von ihnen stehen Ausbildung und Berufseinstieg im Vordergrund, aber auch Sozialleben und Freizeit. Der Auszug aus dem Elternhaus, nicht selten an einen Ort, wo man die politischen Verhältnisse weniger kennt, hemmt die politische Partizipation zusätzlich.
Auch dafür, dass die Wahlbeteiligung bei Personen über 30 zu steigen beginnt, finden sich die gängigen Erklärungsmuster in den Lebensumständen. Wer einer geregelten Arbeit nachgeht, ein regelmässiges Einkommen hat, mit Steuern und Abgaben konfrontiert ist, Verantwortung für eine Familie trägt und bereits länger in einer Gemeinde lebt, entwickelt häufig mehr Interesse an politischen Fragen. Das führt dazu, dass die Partizipation mit dem Älterwerden steigt.
Die Wahrscheinlichkeit, im mittleren und späteren Lebensabschnitt regelmässig an die Urne zu gehen, ist zusätzlich dann höher, wenn jemand bereits mit 18 an den Wahlen teilgenommen hat. Gerade das aber ist bei Schweizerinnen über 65 nicht der Fall.
Die fehlende politische Erziehung
Die Menschheit flog bereits zum Mond, als die Schweizer Männer 1971 den Schweizer Frauen das Stimm- und Wahlrecht auf nationaler Ebene doch noch zugestanden. Die erste Folge davon war, dass die allgemeine Wahlbeteiligung einbrach. Sie sank von 66 Prozent im Jahr 1967 auf 57 Prozent im Jahr 1971. Von den damals erstmals wahlberechtigten Frauen gingen 46 Prozent an die Urne, von den Männern 70 Prozent. Die Mehrheit der Frauen derjenigen Generationen, die in der Schweiz nicht zu politischen Wesen erzogen worden waren, blieben der Urne also fern – obwohl sie endlich zum Wählen berechtigt gewesen wären.
Wahlbeteiligung bei nationalen Wahlen von 1971 bis 2019
Nach Geschlecht
Quelle: «Swiss Election Study (Selects), Cumulative Dataset 1971–2019»
In den folgenden Jahren geschah zweierlei: Einerseits nahm die Wahlbeteiligung der Männer alles in allem ab, andererseits blieb diejenige der Frauen ungefähr gleich tief.
Dass beide Geschlechter in den 1990er- und 2000er-Jahren wieder häufiger wählten, hat mit der zunehmenden Polarisierung der Politik zu tun, und dem damit verbundenen Aufstieg der SVP zur stärksten Partei der Schweiz.
Anders als in anderen Ländern Westeuropas besteht in der Schweiz bis heute ein bedeutender Geschlechterunterschied bei der Wahlbeteiligung. Zwar nehmen Französinnen, Italienerinnen oder Engländerinnen ebenfalls etwas weniger an Wahlen teil als Franzosen, Italiener oder Engländer, die Differenz beträgt dort jedoch meist nur 1 oder 2 Prozentpunkte. In der Schweiz dagegen waren es bei den letzten Wahlen 2019 noch immer 8 Prozentpunkte.
Junge Frauen holen auf – und überholen junge Männer
Allerdings ist die Aussage nicht zulässig, dass Schweizerinnen in jedem Fall weniger häufig wählen als Schweizer. Wesentlich tiefer ist die Teilnahme nämlich vor allem bei Wählerinnen im Pensionsalter – und das seit Jahrzehnten. So betrug die Differenz zwischen den Geschlechtern 1971 durchschnittlich 24 Prozentpunkte, bei Wählenden über 65 aber fast 40 Prozentpunkte.
Differenz der Wahlbeteiligung zwischen den Geschlechtern
Jüngste vs. älteste Wählende
Lesebeispiel: Mit einer Ausnahme gingen stets mehr Männer als Frauen wählen. 1971 betrug der Unterschied bei den unter 30-Jährigen 13 Prozentpunkte, bei den über 65-Jährigen 38 Prozentpunkte.
Quelle: «Swiss Election Study (Selects), Cumulative Dataset 1971–2019»; der Datensatz von 1983 fehlt.
Auch 2019 noch nahmen deutlich weniger Schweizerinnen über 65 an den Wahlen teil als gleichaltrige Schweizer. Die Differenz betrug fast 20 Prozentpunkte.
Der praktisch verschwundene Unterschied in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre kann übrigens mit dem sogenannten Brunner-Effekt und der damit verbundenen Debatte über Frauen in der Politik erklärt werden.
Auch fünfzig Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts bleiben die Schweizerinnen der ältesten Generation der Urne also deutlich häufiger fern als Männer im gleichen Alter. Neben der fehlenden politischen Sozialisation wird ihre tiefere Beteiligung auch auf den in diesen Generationen weniger hohen Bildungs- und Ausbildungsstand von Frauen zurückgeführt, auf das fehlende eigene Erwerbseinkommen beziehungsweise die tiefere Beteiligung am Erwerbsleben sowie auf das gelebte Rollen- und Familienmodell.
Bei den Personen unter 30 hingegen war die Geschlechterdifferenz bereits in den 1970er-Jahren viel kleiner. Über die Jahre ging sie weiter zurück – und 2015 nahmen zum ersten Mal sogar mehr junge Frauen an den Nationalratswahlen teil als junge Männer.
Wahlbeteiligung bei den eidgenössischen Wahlen 2019
Nach Alter und Geschlecht
Quelle: «Eidgenössische Wahlen 2019», Selects – FORS.
2019 nahmen praktisch gleich viele Frauen unter 35 an den nationalen Wahlen teil wie Männer unter 35; das gleiche Bild bei denjenigen zwischen 45 und 54. Der Geschlechterunterschied besteht vor allem bei den pensionierten Wahlberechtigten.
Ergänzende Auswertungen von Orten, an denen die entsprechenden Daten vorliegen, konnten für die Nationalratswahlen 2019 aufzeigen, dass die Wahlteilnahme junger Frauen in einigen Kantonen der Westschweiz sogar deutlich höher ausfiel als die der jungen Männer. Die auffällig hohe Teilnahme der jungen Frauen kann auf die Mobilisierung durch die Klima- und Frauenbewegung im Wahljahr zurückgeführt werden.
Auch Registerdaten der Stadt Zürich lassen den Schluss zu, dass es sich bei der lange tieferen Beteiligung der Frauen um einen Generationeneffekt handelte. Bei den letzten Wahlgängen lag die Wahlteilnahme der jüngsten wahlberechtigten Frauen nämlich immer leicht über derjenigen der jüngsten Männer.
Ist die tiefe Wahlbeteiligung ein Problem?
Die Legitimation des politischen Systems oder einzelner politischer Entscheide wird in der Schweiz nicht grundsätzlich infrage gestellt, auch wenn nicht einmal die Hälfte der Berechtigten an Wahlen teilnimmt und die Beteiligung in einigen gesellschaftlichen Gruppen noch tiefer ist.
Nichtwählende gelten als unbekannte Wesen, denen Wissenschaft und Politik mit einer gewissen Nonchalance begegnen. So wird die Nichtteilnahme als Ausdruck der Zufriedenheit mit dem politischen System interpretiert. Andere Untersuchungen gehen davon aus, dass Wahlen und Abstimmungen nur selten anders ausfallen würden, wenn die Beteiligung höher wäre.
Solche Argumente werden gern zur Begründung vorgebracht, wieso keine weiteren Schritte unternommen werden müssen, um die Bevölkerung zu vermehrter politischer Partizipation zu animieren.
Allerdings: Unter den Wählenden waren Frauen während Jahrzehnten markant untervertreten – und Frauen machen die Hälfte der ganzen Bevölkerung aus (im Gegensatz zu den Wählenden unter dreissig, die nur ein kleiner Teil des gesamten Wahlkörpers sind). Wenn die Teilnahme der Frauen deutlich tiefer ist als die der Männer, kann dies einen entscheidenden Einfluss auf das Resultat von Wahlen und Abstimmungen haben – unter der Voraussetzung, dass sich die Haltungen von teilnehmenden Frauen und Männern und von verschiedenen Generationen stark unterscheiden.
Junge Frauen wählen links, junge Männer rechts
Diese Frage beschäftigt Wissenschaft und Politik immer mehr. So kam eine Untersuchung bereits 2015 zum Schluss, dass bei Jungen die geschlechtsspezifischen Einstellungsunterschiede im Bereich der Gesellschafts- und Sozialpolitik besonders gross sind. Eine ganz aktuelle Studie zeigt auf, dass der viel zitierte Stadt-Land-Graben in erster Linie auf einen Generationenkonflikt zurückzuführen ist. Schliesslich zeigen Nachwahlanalysen zu den eidgenössischen Wahlen 2019 einen deutlichen Unterschied zwischen den Parteipräferenzen von Männern und Frauen.
Noch deutlicher in diese Richtung gehen die jüngst geäusserten Absichten von Wahlberechtigten über ihre Parteipräferenz bei den nationalen Wahlen im nächsten Herbst. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind vor allem bei der jüngsten Generation sehr ausgeprägt. Junge Frauen haben eine deutlich grössere Vorliebe für SP und Grüne, junge Männer eine deutlich grössere für FDP und SVP. Auch zwischen den Generationen zeigen sich deutliche Unterschiede: Die Präferenz für die Grünen ist bei jungen Frauen deutlich grösser als bei älteren Frauen, diejenige für die SVP hingegen deutlich tiefer. Die Männer weisen über die Generationen hinweg kleinere Unterschiede auf als die Frauen.
Wahlabsichten bei den nationalen Wahlen 2023
Befragte zwischen 18 und 29 Jahren
Quelle: Wahlbarometer Sotomo
Geht man davon aus, dass die Wahlbeteiligung der Geschlechter bei künftigen Generationen etwa gleich gross ist, so wird deutlich: Die zunehmend auseinanderklaffenden Präferenzen der Geschlechter könnten Wahlen in Zukunft stärker beeinflussen als bisher.
Der politische Gender-Gap bei Abstimmungen
Wo Frauen beim Abstimmen den Unterschied machen, hat Claude Longchamp bereits 2019 für die Republik systematisch ausgewertet. Letztes Jahr zeigte die Vox-Analyse zur Abstimmung über die AHV-Revision 2021 den grössten Geschlechterunterschied aller verfügbaren Nachabstimmungsanalysen von eidgenössischen Urnengängen. Während Männer die AHV-Reform 2021 klar annahmen, lehnten Frauen sie genauso klar ab. Nur lag ihre durchschnittliche Abstimmungsteilnahme mit 51 Prozent gegenüber 53 Prozent der Männer leicht tiefer. Jüngere Frauen waren unter den Abstimmenden zwar etwas besser vertreten als jüngere Männer, aber mit zunehmendem Alter lag die Teilnahme der Männer wieder deutlich höher. Hinweise auf einen Geschlechterunterschied gibt es auch aus anderen Untersuchungen. Kürzlich erschien beispielsweise in der «NZZ am Sonntag» eine Auswertung, gemäss der sich vor allem jüngere Frauen und jüngere Männer politisch voneinander entfernen.