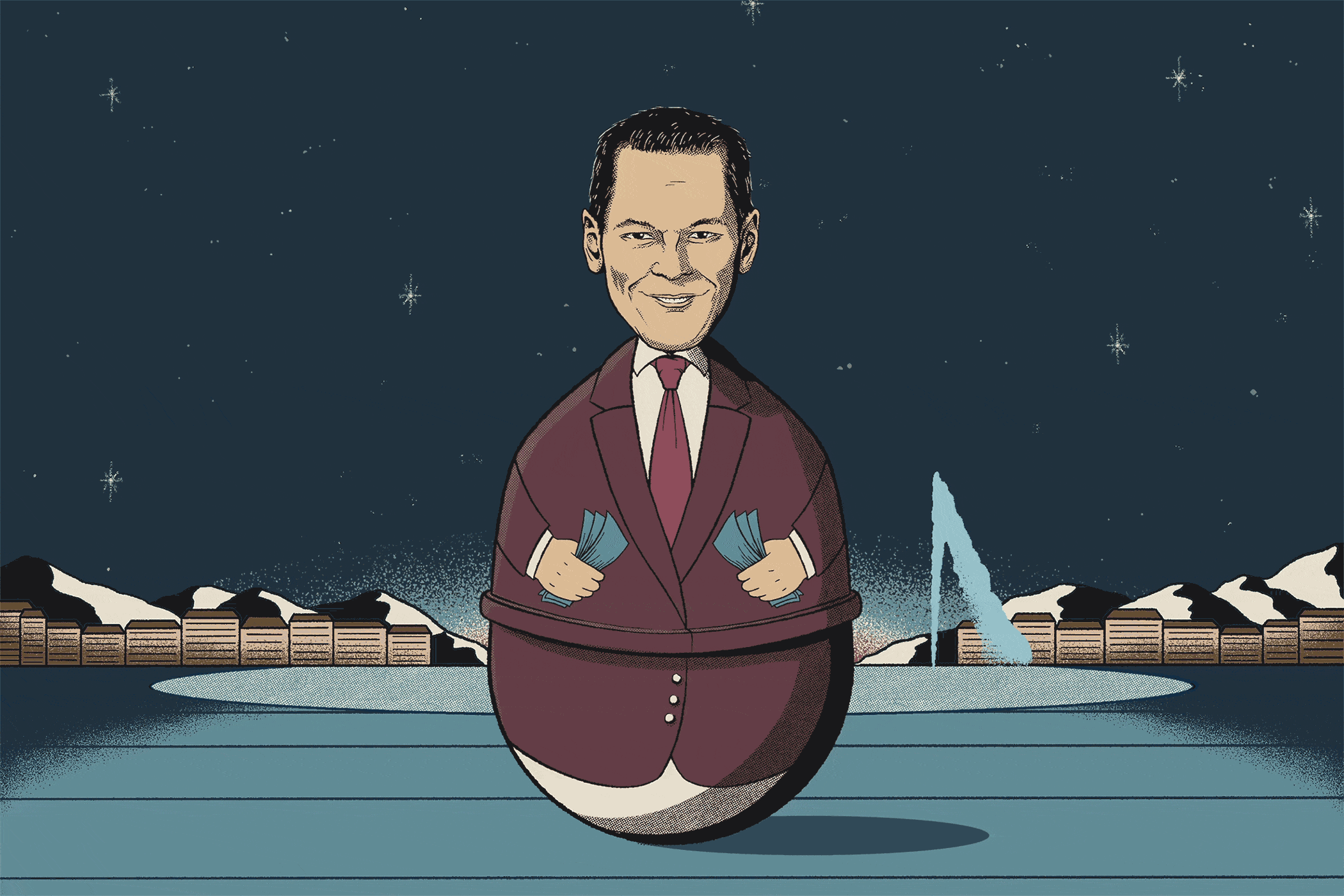
Operation Trotzkopf: Kehrt Pierre Maudet zurück?
Er war Wunderkind, Kandidat für den Bundesrat, dann der gefallene Politiker aus Genf, der vom Bundesgericht verurteilt wurde. Doch schon bald könnte Pierre Maudet wieder regieren.
Von Angelika Hardegger (Text) und Philipp Beck (Illustration), 23.03.2023
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
An einem Abend im Januar steht Pierre Maudet in einer Tür. Bonsoir, bonsoir, bisous, bisous, er lädt in einen Saal. Das Parkett knarrt, an den Wänden dunkler Täfer, aber von der Bühne wummert ein moderner Beat. Ist alt, was hier kommt? Oder neu?
Pierre Maudet sieht aus wie der Alte, wieder bubenhaft.
Er trug Bart, als er im September verkündete, er kandidiere noch einmal für die Regierung. «Ein neuer Pierre Maudet?», fragte das Lokalfernsehen Léman bleu. Aber für diesen Abend, den Start in die Wahlkampagne, hat Maudet sich rasiert. Glattbäckig steht er in der Tür, wie aufgespannt. Bereit, einzutreten in die Wiederkehr.
Später am Abend wird aus Lautsprechern tönen, dies sei ein historischer Abend. Man werde dereinst zurückblicken und schwärmen: «Ich war da!»
Es wird Gewissheit aus Gesichtern leuchten, Teil von etwas Neuem zu sein: einer politischen Bewegung, weder rechts noch links, die Genf erobern wird. Es wird sein, als habe der Saal zu lange in die Sonne geblickt, um zu sehen, wer an diesem Abend im Zentrum stand:
Pierre Maudet, der gefallene Regierungspräsident von Genf. Im November vom Bundesgericht schuldig gesprochen, weil er sich einen «nicht gebührenden Vorteil» verschafft hatte.
Maudet, der sich als Regierungspräsident First Class nach Abu Dhabi fliegen liess. Der eincheckte im Luxus, mitsamt Familie, dem Stabschef und einem Freund, für «Hotel, Pool, Zigarren und Grand Prix», so steht es im Urteil des Bundesgerichts. Maudet, der sich die Luxusreise vom Königshaus in Abu Dhabi bezahlen liess. Und der, als die Reise publik wurde, log. Und wieder log. Der einen mitgereisten Freund vermutlich dafür lobte, die Staatsanwaltschaft belogen zu haben, eine Institution, der er als Justizminister selbst vorstand: «Well done, Old Chap», schrieb er in einer SMS.
Und als alles aufflog, harrte er einfach aus im Amt, fast drei Jahre lang. Für die Umstände: ewig. Erst als die Kollegen in der Regierung ihn entmachteten, trat Maudet zurück und verkündete sogleich, er bewerbe sich für seinen eigenen Sitz. Das war vor zwei Jahren. Maudet holte mehr als 30 Prozent der Stimmen, aber er verlor.
Am 2. April wählt Genf erneut. Fragt man in der Stadt, ob es Maudet diesmal reiche, seufzen die Leute: «Ich weiss es nicht.»
Genf kennt viele Gefallene. Ein ehemaliger Regierungskollege Maudets bezahlte mit der Kreditkarte des Kantons morgens um fünf Uhr in einer Bar. Er zog sich zurück und wurde Anwalt. Maudets Vorgänger prügelte sich in einer Silvesternacht mit einem Barmann, heute ist er schlicht Jurist. Einzig Maudet, diese schlimmste Affäre von allen, die Hauptfigur in einem der grössten Politskandale der jüngsten Schweizer Geschichte: Ihn werden sie nicht los.
Ist es der Narzissmus? Die Macht? Sucht er Rehabilitierung? Revanche?
Maudet sei ein Ufo, ein einzigartiger Fall, sagen sie in Genf. Ein Jahrhunderttalent in den Augen von Unterstützerinnen, ein monströses Ego für die Kritik. Er ist auch, das erzählen alle irgendwann, «Politiker seit Kind». Als wäre er das eine gewesen und unmittelbar darauf das andere. In den Geschichten über sein Leben fehlt eine ganze Phase: die Adoleszenz. Ist er am Ende Staatsrat geworden, aber nie erwachsen?
Fehlt Pierre Maudet für den Abgang schlicht die Reife?
«Der Wunderbub ist tot»
Ein Freitagabend im März. In einer Schreinerwerkstatt, zwischen Sägemehl und Schalenhörschutz, lässt sich Maudet die Sorgen von Handwerkern erzählen. Ein Schreiner klagt, er habe ein Jahr lang versucht, einen Lehrling einzustellen, von Schalter zu Schalter geschickt, von Behörde zu Behörde. Aus dem Publikum verärgertes Murmeln. Zustimmend. Sie sitzen auf Bänken, die Arme verschränkt, die Rücken gekrümmt. Wie Brücken, auf denen man Maudet in Richtung Regierung laufen sieht.
Er ist gekommen, um Projekt Nummer 14 im Wahlprogramm vorzustellen: eine einzige Behörde, die den Papierkram für die Lehre regelt.
Projekt Nummer 1 ist eine einheitliche und öffentliche Krankenkasse für Genf.
Nummer 6: Im Stadtzentrum darf zu Stosszeiten nur noch Auto fahren, wer mindestens zu zweit drinsitzt.
Nummer 17: Die Verwaltung führt bei Bewerbungen den anonymen Lebenslauf ein, ohne Name, Foto, Geschlecht.
Es sind nicht nur die Handwerkerinnen, die Maudets Wahlprogramm mögen.
«Messbar, umsetzbar» sei sein Programm, wirbt er. «Simpel» trifft es auch. Es ist, als habe sich der gefallene Maudet beim Aufprall auf eine einzige A4-Seite komprimiert. Er, der Archive füllt in Genf, so lange macht er schon Politik. Als andere eine Lehre begannen, besetzte Maudet bereits einen Präsidentensessel in der Politik. Er war der Wunderbub, der «petit Mozart» dieser Stadt. Er schillerte und Genf staunte.
Mit 12 Jahren Gründung eines Jugendparlaments. Kaum aus dem Gymnasium: Organisator eines riesigen Stadtfests zum Jahrtausendwechsel. Mit 20 Jahren Eintritt in den Parti radical, der später mit den Liberalen die FDP bilden würde. Darauf Lancierung einer Initiative, um Genf und die Waadt zu fusionieren. Das war anmassend und gewitzt: Er stand auf allen Titelseiten mit seiner Utopie. So wurde er selbst zu einer.
Er galt als «jung, wach, ungestüm», die inkorporierte Zukunft. Mit 33 Jahren war er der jüngste Stadtpräsident der Genfer Geschichte. Mit 34 der jüngste Regierungsrat. Als er mit 39 für den Bundesrat kandidierte, feierten ihn die Medien, als hätten sie ihn selbst erfunden. «Gewinner» nannten sie ihn, «Schweizer Macron», ein «Stern» am Himmel der Romandie. Sie nannten ihn auch «Jungbrunnen», dabei wurde Maudet immer älter.
Wenig später, nach seinem Fall, stellte ein Genfer Professor für Psychiatrie eine Diagnose: Eine Stadt habe sich verführen lassen von ewiger Jugend, von einem scheinbar göttlichen Kind.
Der Professor schrieb das im Vorwort zu einem Buch, das Maudet aus der politischen Verbannung publizierte. Darin berichtet er von einer Stadt, die sich in folie d’amour ertappte, als der scheinbar perfekte Jüngling fehlbar wurde. Diese These erklärt, warum in Genf in den Wochen vor den Wahlen kaum jemand über Abu Dhabi spricht, die Vorteilsannahme, das Delikt. Was die Leute umtreibt, ist der Betrug, die Lüge.
Der Psychiater beschreibt die Affäre Maudet als Beziehungsdrama und Maudet selbst: als Politiker, der in gewissen Zügen in der Kindheit stecken blieb.
Maudet habe «infantile Lügen» vorgebracht, um die Reise nach Abu Dhabi zu vertuschen. Er behauptete zunächst, die Reise sei privat gewesen. Der Lüge überführt, log er, sie habe nur 10’000 Franken gekostet. Er log weiter, als längst ermittelt wurde und absehbar war, dass er auffliegen würde. Er log ungeschickt wie ein Kind, das mit Bonbonpapier erwischt wird und behauptet, es habe nicht genascht. Es habe nur ein Bonbon genommen, dabei waren es fünf.
Vielleicht ist es nun wieder so, vielleicht klammert Maudet, weil er die Jugend einfach übersprang.
Auf die Frage, warum er nicht aufhöre, spricht er von einer «medialen Schlacht» und «symbolischer Hinrichtung», er fragt: «War das verhältnismässig? Diese Frage kann man stellen. Wenn ich jetzt die Hände in den Schoss lege, gebe ich meinen Gegnern recht.»
Er will und will nicht lassen von der Politik. Wie ein Bub, dem ein Spielzeug genommen wird, der darauf heult und stampft und wütet, bis er es zurückbekommt. Maudet denkt eher: wie ein Kämpfer. Er versteht seinen Trotz auf erwachsene Art. Als Hartnäckigkeit, Selbstbehauptung. «Der Wunderbub ist tot, c’est fini», sagt er im Gespräch. Aber enden lassen darf er seine politische Geschichte nicht so, mit dem Fall. Dafür liebt er sich zu sehr.
Frisch und jung, ganz der Alte
Pierre Maudet sagt: «Das ganze Leben ist eine Kampagne!» Er suchte die Bühne ab dem Moment, als er sie verloren hatte: Kurz nach dem Rauswurf aus der Regierung schrieb er ein Buch. Hinterher kandidierte er für seine eigene Nachfolge. Und als die Wahl verloren war, trat er im Theater auf.
Das war in Fribourg, er war der prominente Gast in einem satirischen Format. Man lachte über Abu Dhabi und die Lügen, man erleichterte sich. Gefragt, warum er den Auftritt akzeptiert habe, sagte Maudet damals, vielleicht sei das eine Form von «persönlicher Katharsis».
Er stellte die Bedingung, das Stück auch in Genf aufzuführen. Er hat den Wahlkampf in der Heimat nie pausiert.
Kaum aus der Regierung geworfen, richtete Maudet ein Büro in der Genfer Innenstadt ein. Er kündigte sich im Schaufenster als «unabhängiger Staatsrat» an, der «Verwaltungsopfer der Covid-Krise» berate, jeweils Montag bis Donnerstag, zwischen 7.30 und 13.30 Uhr. Er war schamlos clever.
An jenem Abend im Januar, im alten Saal mit dem wummernden Beat, tritt Maudet unter Applaus und lautem «Bravo!» vor das Publikum. Er unterhält ab Sekunde eins. Er witzelt über die Rasur, witzelt über Zeitungsrecherchen, die am Tag davor enthüllt hatten, wie er als Regierungsrat in die «Uber-Files» involviert gewesen war. Er witzelt über «casseroles», das französische Wort für Affären wie seine, Machenschaften, «aber wir sind heute nicht hier, um über casseroles zu reden».
Einige Wochen später wird publik, wie Maudet, noch im Amt, einem libanesischen Banker zum Schweizer Pass verhalf. Eine brisante Recherche, denn Maudets Reise nach Abu Dhabi wurde aus libanesischen Kreisen organisiert. Bis heute konnte die Strafverfolgung nicht nachweisen, dass Maudet eine konkrete Gegenleistung für die Reise erbracht hätte. Stand die Einbürgerung des Bankers mit Abu Dhabi in Zusammenhang?
Maudet schwieg, als Journalisten fragten. Doch am Abend, unter Fans, spricht er eine Stunde lang und kurzweilig zugleich.
Er lädt den Saal in aller Ruhe mit Geschichte auf, um ihn dann laut und zügig in die Zukunft zu ziehen. In die politische Bewegung, die ausströmen und mobilisieren soll, er spricht von Hoffnung, Lust, Erneuerung. «Er ist dynamisch! Ein Visionär!», wird ein Anhänger später sagen. Maudet gibt sich frisch und jung, er ist ganz der Alte. Er steht den ganzen Abend im Zentrum, obwohl er oft ensemble sagt.
Er stellt die Wahlliste vor, mit der seine Bewegung zu den Wahlen ins Parlament antritt. Sie soll jene 65 Prozent der Genferinnen und Genfer mobilisieren, die sonst nicht wählen. Die Liste enthält Namen, die niemand kennt in Genf, auch niemand kennen muss. Sie stehen im Wahlkampf weniger für sich als hinter ihm.
Maudet ruft die Kandidatinnen auf wie Schüler: eine Coiffeuse, einen Schreiner, eine Wirtin. Eine Psychologin, eine zugezogene Deutsche, einen 92-jährigen Senior. Einen jungen Informatiker, eine schwarze Pharmaangestellte, eine Kauffrau, eine Mutter von sechs Kindern. Und als man glaubt, jede Gruppe sei schon vertreten: einen spanisch-schweizerischen blinden Para-Athleten.
Maudets Bewegung heisst Libertés et Justice sociale, nach dem alten Wahlspruch der Genfer Radikalen. Um einzuziehen in das Parlament, bräuchte seine Liste 7 Prozent der Wählerstimmen. Es gab in Genf Bewegungen, die das auf Anhieb schafften. Aber auch enge Unterstützerinnen bezweifeln, dass das Quorum erreichbar ist. Niemand in der Bewegung hat Aussicht, gewählt zu werden. Ausser Pierre Maudet.
Er nutzt die Herkünfte der Leute, ihre Verankerung im Leben. «Das ist eine Liste, die Ihnen ähnelt!», ruft er ins Publikum. Die Liste ähnelt nur dem Publikum, nicht ihm, dem Berufspolitiker seit Kind. Maudet war 20 Jahre lang das Inbild einer Elite, der er in der laufenden Kampagne vorwirft, sie politisiere lebensfern.
Das sei «fast populistisch und ziemlich demagogisch», findet Pascal Sciarini, Politologe an der Universität Genf.
«Es ist die Flucht nach vorne von einem Mann mit monströsem Ego», sagt die Genfer Historikerin Isabelle Brunier.
Brunier sass für die SP im Stadtparlament, als Maudets Aufstieg begann. Eine Frau, die die Genfer Politik in elegante und unelegante Figuren unterteilt, mit einer selbstbewussten Oberflächlichkeit, wie sie Genf eigen ist. Von dieser Oberflächlichkeit hat Maudet immer profitiert. Aber ihn, sagt Brunier, ihn habe sie nie gewählt.
«Er ist sehr französisch, keineswegs repräsentativ für Genf. Die echten Genfer sind diskret. Sie drängen sich nicht vor», sagt sie. Das Ego komme aus Frankreich, wo Präsidenten kleine Könige sind. Genf grenzt auf 102 Kilometern an Frankreich und nur auf 4,5 an die Schweiz. Das erklärt mit, warum Maudet in Genf noch wählbar ist.
Er macht Politik zu mehr, als sie in der Schweiz für gewöhnlich ist. Als er in die Kampagne für den Bundesrat zog, liess er sich exklusiv von einem Fotografen begleiten. Der schoss einprägsame Fotos: Maudet im Hotel. Maudet mit Adolf Ogi. Maudet am Rednerpult vor Hunderten. Maudet nachdenklich vor einem Fenster. Maudet beim Joggen vor dem Bundeshaus. Er verlor die Wahl, aber die Kampagne machte er zum Ereignis.
Und selbst die Affäre: Für Schweizer Verhältnisse war sie spektakulär. In Frankreich hatten sie Cahuzac, Sarkozy, Strauss-Kahn. In Frankreich sind sie Affären gewohnt.
Isabelle Brunier sagt: «Was Maudet leitet, ist nicht die Politik. Ich glaube, da sind keine echten Überzeugungen. Was ihn leitet, ist sein Ego.» Maudet selbst sagt der Republik: «Jeder Politiker, jede Politikerin ist irgendwo narzisstisch, sonst überlebt man nicht.»
Er zog schon als Kind gern alle Aufmerksamkeit auf sich, er sagt: «Politik verlangt, in den Zeitungen zu stehen, am Fernsehen aufzutreten. Wer sich selbst nicht gern sieht, erträgt das nicht.» Er glaubt von sich selbst, die Bühne nur als Instrument zu nutzen. Er sieht sich als Politiker, der Ideen verkörpert, nicht nur sich selbst. Er versteht sich als Politiker aus Leidenschaft. Ein alter Klassenlehrer, ein Sozialdemokrat, glaubt: Das stimmt.
Gérard Deshusses war Maudets Lehrer in der Oberstufe und Präsident der Genfer SP, als die Affäre Maudet eskalierte. Damals forderte er seinen ehemaligen Schüler öffentlich zum Rücktritt auf. Heute erklärt Deshusses die neuerliche Kandidatur ganz simpel: «Leidenschaften ändern sich halt nicht.»
Deshusses erzählt von einer Reise, auf die er Maudets Klasse führte. Kurz nach dem Mauerfall radelten sie durch die Tschechoslowakei, ein Land geschunden vom Kommunismus. «Ich musste kämpfen, die Schüler zu ernähren», erzählt Deshusses: «Ich stand in der Metzgerei und man sagte mir: ‹Eine halbe Wurst können Sie haben.› Für eine ganze Klasse. Und wir waren Velo gefahren!»
Die Reise habe alle geprägt, glaubt Deshusses. «Man kann über Maudet sagen: Die Politik interessierte ihn früh. Aber eigentlich ist das falsch. Was ihn interessierte, war die gemeine Sache, die res publica. Er war 12 Jahre alt. Ohne es schon zu wissen, war er zutiefst radikalliberal, im Sinne von 1848.»
Er glaube, sagt Deshusses, das stecke noch in Maudet drin. «Ob nur das? Ich weiss es nicht. Wer eingesteckt hat, was er einstecken musste, ob zu recht oder nicht, will vielleicht auch Dinge geraderücken. Mag sein, dass eine Spur Revanche dabei ist.»
Maudet sagt, Revanche suche er nicht. «Das Ansehen rehabilitieren: Ja.»
Dass sein trotziges Verhalten sein Ansehen nur noch mehr beschädigt, zieht er gar nicht in Betracht. Sein Selbstverständnis kennt nur eine Richtung, nach vorne. Und nur ein einziges Feld: die Politik.
Im Alter von 24 Jahren sagte er: «Ich mache Politik, weil ich die Macht liebe.» Heute habe sich seine Sicht auf die Macht verändert: «Die Erfahrung zeigt, dass die Macht nicht unbedingt dort liegt, wo man sie vermutet. Es gibt ja viele Arten von Macht, die Macht der Symbolik zum Beispiel, die des Geldes, die Macht der Medien. Als Staatsrat hat man im Grunde wenig Macht. Man ist nur einer von sieben.»
Vielleicht ist es weniger die Macht der Politik, die ihn anzieht, als das Handwerk. Politik, sagt Maudet, sei auch «eine Kunst der Ausführung, ein wenig wie der Krieg. Man stellt sich auf, man rückt vor.»
Er war jung schon Offizier, er hat sich aufgestellt, er rückt vor. Was, wenn er verliert?
Demut ist ihm fremd
Maudet zieht in Kampagnen, als wären sie Kriege. Er vergibt Codenamen dafür. Die Kampagne für den Bundesrat war «Operation Valmy». Nach der Kanonade von Valmy, wo Preussen und Österreicher überraschend zum Rückzug gezwungen wurden – natürlich durch französische Truppen. Die Kampagne für seine Regierungskandidatur von 2021 hiess «Operation Dynamo». Unter diesem Code evakuierten im Zweiten Weltkrieg die Briten Truppen aus Dünkirchen. Das war die Grundlage für ihren späteren Sieg über Hitlerdeutschland. Die vielleicht bedeutendste Rettungsaktion der Weltgeschichte. Kleiner geht es bei Maudet nicht. Er spricht sehr gut Deutsch, er versteht das deutsche Wort «Hochmut», aber «Demut» ist ihm fremd.
Er übersetzt das Wort auf dem Handy.
«Humilité! Ja, das ist nicht veranlagt in mir. Ich arbeite daran.»
Die Historikerin Isabelle Brunier sagt: «Irgendwie tut er mir leid. Ich glaube, er hat sich in eine unmögliche Situation manövriert. Es bräuchte Intelligenz und Demut zu sagen: ‹Ja, ich habe Fehler gemacht. Ich höre auf.›»
Maudet sagt: Jetzt aufhören, das sei «nicht Demut, sondern falsch platziertes Schuldgefühl». In Anbetracht dessen, was er getan und nicht getan habe, sei es demütig, den Fehler anzuerkennen und zu sagen: Das wiederholt sich nicht. Ich habe gelernt. Ich werde besser sein. «Aber einfach aufhören, beim kleinsten Angriff: Das nennt sich Kapitulation.»
Er glaubt wirklich, er habe sich vor zwei Jahren mit «Dynamo» evakuiert.
Die 30 Prozent der Stimmen, die er holte: eine symbolische Gewalt. Sie verschafft ihm in der laufenden Kampagne Auftritte am Fernsehen, Platz in der Zeitung. Von den vielen Kandidaturen für die Regierung nimmt man seine ernst. Aber verliert Maudet erneut, verliert er nicht nur die 30 Prozent, sondern auch Ernsthaftigkeit. Dann wird er zur Karikatur.
Oder Nationalrat? Ein alter politischer Freund, Bernard Lescaze, hat ihm dazu geraten.
Lescaze ist ein Mann ohne E-Mail-Adresse, dafür mit Sekretärin. Ein warmer Mensch, der schon am Telefon sagt: «Pierre Maudet? Je l’aime beaucoup.» Ein Historiker, der so lange aus der Genfer Skandalgeschichte erzählen kann, bis diese eine Affäre, die seines Lieblings, fast unbedeutend wird: «c’est un tout petit!»
Lescaze glaubt, die Affäre habe Maudet den Weg in den Bundesrat versperrt. Ansonsten: alles möglich. Warum Maudet nicht einfach etwas anderes mache? Den Job in der Firma für Cybersicherheit behalte? Bernard Lescaze empfindet das nicht als Frage, sondern als Affront. «Weil er resilient ist! Hartnäckig! Zum Glück hört er nicht auf! Glauben Sie, mit dieser Denkweise, ‹Warum lässt er nicht los?›, glauben Sie, so hätte Selenski durchgehalten?»
Lescaze war schon Mentor von Maudet, als dieser 20 war. Er will seinen Wunderbub behalten.
Er sagt: «Er ist ein Phänomen. Diese Faszination für einen Menschen, ich würde sagen, das hat man nicht mehr erlebt seit Léon Nicole.» Nicole war eine Galionsfigur der Genfer Linken, «der hatte auch seine Skandale, mais oui!», er wurde praktisch aus dem Gefängnis in die Regierung gewählt.
Aber das war vor hundert Jahren. Heute spricht einiges gegen Maudet.
Vor zwei Jahren konnte er als Bisheriger kandidieren. Er war nicht endgültig schuldig gesprochen, er hatte Rekurs eingelegt vor Gericht. Es wurde gewählt in der Pandemie, es gab viel Unzufriedenheit. Andererseits: Die Regierung kippte mit jener Wahl nach links. Es wird im April Bürgerliche geben, die die linke Mehrheit brechen wollen – und sei es über die Wahl Maudets. Seine Konkurrenz ist schwach, von Maudet hingegen weiss man: Er hat Dinge möglich gemacht. Man weiss das gerade auch links.
Maudet galt als Wirtschaftspolitiker, aber «seine Ökopolitik war ganzheitlich und visionär». Das schreibt der Journalist Philippe Reichen in einer aufwendig recherchierten und kritischen Biografie. Maudet war law and order, aber er legalisierte in Genf die Sans-Papiers. Diese Aktion, «Operation Papyrus», ist vielen Linken höchst präsent. Maudets Kampagnenchefin war früher Generalsekretärin der SP, sie glaubt: So viel politisches Geschick gehört genutzt.
Und wenn er verliert?
An einem Nachmittag im März tritt Maudet vor Senioren auf. Ein Anlass wie eine zähe Bühnenprobe: Es gibt einen Moderator, Konkurrenten, null Höhepunkte und kein Licht. Doch ob der Bühne, unter der Decke, hängt ein glitzernder Luftballon. Übrig geblieben von einem besseren Event, er muss entwichen sein und blieb doch gefangen. Gewinnt Maudet im April, wird er entwichen sein. Aber frei?
Einmal, als Maudet über Abu Dhabi spricht und seine Zukunft, sagt er in einem Nebensatz, er könne ja «nicht einfach aufhören zu leben». Er sei auch Vater und Ehemann, manche fragen in Genf: Warum wartet er nicht wenigstens ein bisschen? Der Familie zuliebe?
Der Familie widmete Maudet das Buch, das er aus der Isolation schrieb. Er nahm sich in der Einleitung vor, sich selbst zu finden. Am Ende schrieb er ein politisches Programm. Der wichtigste Satz im Buch ist ein Zitat von Maudets politischem Ziehvater, dem verstorbenen Guy-Olivier Segond. Wütend über die Lügen, fuhr er Maudet an: «Die Menschen realisieren, dass ihr Regierungsrat gross ist, aber der Mensch klein.»
Es ist, als habe in diesem Körper nicht zweierlei Grösse Platz.
Gewinnt Maudet im April, wird er den Namen der geglückten «Operation» einer Zeitung verraten. Daraus wird eine fette Schlagzeile werden, eine Schlacht wird es sein. Irgendein Heer, das sich irgendwann und irgendwo allen Widrigkeiten zum Trotz schlug, um ruhmvoll heimzukehren.
Verliert Maudet, will er «Politik machen, aber anders», wie er sagt. Er hält das bewusst diffus. Sagt nur, man werde ihn «wohl eine Zeit lang nicht mehr in der politischen Arena» sehen. Es ist ihm zuzutrauen, dass er für das Szenario Niederlage einen alternativen Codenamen bereithält. Eine andere historische Operation, die er medial verkünden kann. Eine heldenhafte Niederlage zum Beispiel, eine Schlacht vielleicht, die nur ein Vorrücken erlaubte, aber keinen Sieg? Etwas Unverfängliches.
Maudet ist ein Gefangener der Politik. Er wird eine Lagebesprechung einberufen, sich neu aufstellen und wieder vorrücken müssen. In welche Geländekammer auch immer.