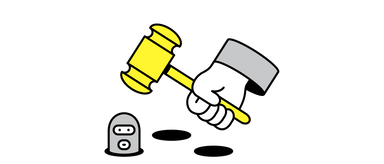
Zank um Zink
Ein Metallspritzwerk lagert Zinkpulver auf dem Areal. Unsachgemäss, finden die Behörden – und schicken einen Strafbefehl. Der Geschäftsführer lässt sich das nicht gefallen. Er sagt: Zink sei doch eigentlich gesund.
Von Daria Wild, 24.08.2022
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Die eidgenössische Umweltgesetzgebung hat sich in den letzten Jahrzehnten stetig erweitert: In den 1960er-Jahren trat das Natur- und Heimatschutzgesetz in Kraft, in den 1980er-Jahren das Umweltschutzgesetz. In den 1990er-Jahren kam das Gewässerschutzgesetz dazu, in den Nullerjahren das Chemikaliengesetz. Sie alle verfolgen letztlich dasselbe Ziel: Mensch, Tier und Natur zu schützen. Widerhandlungen gegen diese Gesetze gelten zusammengefasst als: Umweltkriminalität.
Vor ein paar Jahren liess das Bundesamt für Umwelt alle kantonalen Strafrechtsentscheide in Sachen Umweltkriminalität von 2013 bis 2016 auswerten. Die Untersuchung ergab: Die meisten Verurteilungen fallen auf Gewässergefährdungen sowie auf illegales Verbrennen und Entsorgen von Abfällen. Das meiste wird per Strafbefehl erledigt und mit Bussen unter 1000 Franken geahndet. Nur selten landen die Fälle vor Gericht. Und erfordern dort einiges an Fachexpertise.
Ort: Regionalgericht Berner Jura-Seeland, Biel
Zeit: 16. August 2022, 14 Uhr
Fall-Nr.: PEN 21499
Thema: Widerhandlungen gegen das Chemikaliengesetz, Umweltschutzgesetz und Gewässerschutzgesetz
Paul Marti, der in Wirklichkeit anders heisst, ist Geschäftsführer und Inhaber eines Metallspritzwerks. Der Unternehmer darf zufrieden sein: Die Auftragslage ist gut, und einer der Söhne ist bereits ins Geschäft eingestiegen, mit der Absicht, die Firma in dritter Generation weiterzuführen.
Die Arbeit ist seit Jahrzehnten dieselbe. Marti, sein Sohn und zwei Mitarbeiter reinigen Metall und verzinken es, das schützt vor Rost. 5000 bis 5500 Franken beträgt Martis Monatslohn, nicht grad viel, aber «normal für die Gegend», wie der Geschäftsführer in einer Prozesspause erzählen wird. Wäre der Sohn nicht, hätte Marti das Geschäft längst verkauft. Mit 57 Jahren habe er langsam genug.
Der Mann hat sein gesamtes Arbeitsleben im Metallspritzwerk verbracht. Die Zeit ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, Schnitte, Furchen und Flecken zieren seinen drahtigen Körper. Noch sitzt er im Wartesaal des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland in Biel, in den Händen eine rote Sichtmappe mit ein paar A4-Blättern. Ohne Anwalt – zu teuer sei der gewesen.
Marti hat Einsprache gegen einen Strafbefehl erhoben. Ihm drohen eine bedingte Geldstrafe zu 20 Tagessätzen à je 150 Franken, also 3000 Franken, eine Busse von 10’000 Franken und Gebühren von 2500 Franken. Weil eine bedingte Geldstrafe nicht bezahlt werden muss, kann zusätzlich eine Busse damit verbunden werden, die sogenannte Verbindungsbusse, hier 750 Franken. Das alles wegen Widerhandlungen gegen das Chemikaliengesetz, das Umweltschutzgesetz und das Gewässerschutzgesetz. Denn Martis Arbeit ist zwar über die Jahre hinweg dieselbe geblieben, doch der Umgang mit gefährlichen Stoffen hat sich geändert – zum Schutz der Arbeiterinnen und der Umwelt.
Beim Verzinken sind beispielsweise Filteranlagen seit längerem Pflicht, genauso wie Schutzanzüge, sachgerechte Lagerung und ein korrektes Beschriften des Zinkpulvers, das beim Verzinken anfällt. Darüber sollte vor Gericht zwar noch gestritten werden, aber aus wissenschaftlicher Sicht ist es eindeutig: Zinkpulver ist ein gefährlicher Stoff. Es kann Explosionen auslösen, ist in hoher Dosierung schädlich für den menschlichen Körper und schon in geringer Dosierung schlecht für Wasserorganismen.
Von diesem Zinkpulver soll Paul Marti im Februar 2019 circa 15 Tonnen nicht sicher verpackt und nicht gekennzeichnet haben, so heisst es im Strafbefehl.
Das Pulver habe er in einem ehemaligen Pulverlager im Kellergeschoss seines Geschäfts auf unbefestigtem Boden, in nicht verschlossenen Fässern sowie später in sogenannten Big Bags – das sind rund ein Kubikmeter grosse Plastiktaschen – auf dem Vorplatz deponiert. Weil im Keller Durchzug geherrscht habe, sei das in den Fässern im Keller gelagerte Zinkpulver durch einen türlosen Eingang auf die Wiese geraten und habe das Grundwasser verunreinigt, so die Auffassung der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus sei die Firma, die Marti zum Abtransport des Materials beauftragt habe, nicht informiert worden, dass es sich um gefährliches Zinkpulver handle.
Eine Frage der Dosis
Vor Gericht schwankt Marti zwischen Einsicht und Relativierung der Gefahren. «Ich habe sicher einen Fehler gemacht, ich habe zu wenig sauber gearbeitet», sagt er bei der Begründung seiner Einsprache. Man müsse aber wissen, dass es überall im Boden Zink gebe. «Zink ist eigentlich gesund. Die Menschen kaufen Zinktabletten, weil sie zu wenig davon haben.» Er habe schliesslich kein ganzes Fass auf die Wiese geleert.
Die Fotos, die Einzelrichterin Denise Weingart dem Beschuldigten vorhält, zeigen ein schlichtes, graues Backsteingebäude auf einer Wiese, auf der mehrere dunkelgraue Flecken von Zinkpulver zu sehen sind. Wie gross die sind, ist anhand dieser Vorlage schwer zu sagen, vielleicht etwa im Umfang eines Gullideckels, vielleicht grösser.
Die Kantonspolizei Bern hat die Bilder geschossen, genau gesagt die Fachstelle Umweltkriminalität. Weitere Aufnahmen zeigen einen dunklen Kellerraum, das ehemalige Pulverlager, in dem graues Pulver zentimeterhoch lose auf dem Boden und in Metallfässern lagert. Auf den Fotos sehe es auf Berndeutsch gesagt «scheusslech» aus, gibt Marti zu, aber das sei einfach ein schlechter Moment gewesen. «Das lag nicht monatelang draussen, wir haben das nachher weggeräumt.»
Im Prinzip, so Marti, sei die Polizei im dümmsten Moment gekommen.
In der Verhandlungspause wird er erzählen, warum es zu dieser Inspektion kam: Einer seiner Mitarbeiter habe etwas geschweisst, da sei ein Funke aufs Zinkpulver übergegangen. Die Folge: ein Dachbrand, Feuerwehr, Ambulanz – und die Polizei. «Die haben das sofort gesehen», sagt er.
In Martis Augen ist weder Zinkpulver wahnsinnig gefährlich, noch sind die Regeln, die die Behörden im Umgang damit vorschreiben, sinnvoll.
Von diesen Regeln, das ist vielleicht Martis Problem vor Gericht, scheint er zumindest schon mal gehört zu haben. «Dass man die Schuhe wechselt, wenn man zum Gebäude rausgeht, ist Theorie, das macht kein Mensch», sagt er. Dass die Polizei behaupte, das Zinkpulver gelange ins Grundwasser und die Fische würden darob sterben, sei ein Witz. «Warum ist das ein Witz?», hakt die Richterin nach. Bei dieser Menge sei das unmöglich, sagt Marti, und fügt später hinzu, es sei ja schliesslich kein Fisch gestorben.
Einzelrichterin Weingart: «Syt ihr go luege?» Marti nickt.
An diesem Prozess prallen, wie so oft vor Gericht, Welten aufeinander. Da ist Paul Marti, der seit Jahrzehnten alles so macht, wie es sein Vater jahrzehntelang schon gemacht hatte – beziehungsweise: Marti macht vieles besser, heute, etwa Masken tragen bei der Arbeit. Für den aber gefährlich vermutlich nur dann gefährlich bedeutet, wenn einer, Fisch oder Mensch, krepiert. Doch nicht alles, was gefährlich ist, ist von blossem Auge erkennbar, und in Martis Arbeitsrealität mischt sich nun, wie sich zeigen wird, völlig zu Recht der Umweltschutz ein.
Quasi dazwischen steht das Gericht.
Richterin Weingart gibt zu, sie könne nicht beurteilen, wie gefährlich Zinkpulver sei. Das Gericht berufe sich auf den Inspektionsbericht des Amts für Wasser und Abfall. Dort sei festgehalten, dass Fallgrubenmaterial – dazu gehört Zinkpulver – mit einem Reinheitsgrad von circa 98 Prozent als gefährlich behandelt werden müsse.
Weingart zitiert: «Zinkstaub ist brennbar, darf nicht eingeatmet werden, nur geschultes Personal darf damit umgehen – und so weiter.» Der Stoff gelte ausserdem als gewässergefährdend und «akut aquatisch toxisch» sowie «chronisch aquatisch toxisch». Weingart, die über die Begriffe fast stolpert, fasst zusammen: «Also: giftig.» Das Amt habe das Wasser auf Martis Grundstück untersucht, die erlaubten Zinkwerte seien um das Doppelte überschritten worden.
Ob er immer noch der Meinung sei, Zink sei ungiftig, will Weingart geduldig wissen. Marti bleibt stur: «In dieser Menge, ja.»
Dreissig Jahre schon liege dieser Zinkstaub im Keller, nie sei etwas passiert.
Gesunde Schafe, gesunde Mitarbeiter
In Martis Augen ist alles vor allem Pech: Sie seien nun endlich «voll dran» gewesen, diesen Pulverkeller auszuräumen. Das Loch, das sie extra in die Mauer geschlagen hätten, um mit einem Bagger das Pulver abzutragen, sei mit einem Plastik zugedeckt gewesen, «hauptsächlich, damit niemand reingeht».
Und Marti weiter: «Es ist nicht so, dass das monatelang so ausgesehen hat.» Der Boden sei zwar, wie der Polizeirapport festhalte, nicht betoniert (laut Rapport: «unbefestigt»), doch solange da kein Wasser dazukomme, könne das Pulver nicht ins Grundwasser gelangen. Es habe natürlich «gestoben», als sie mit dem Bagger in den Keller reingefahren seien, vielleicht hätten sie diesen Staub zu wenig «abgeblasen», aber es habe halt einfach Zink im Boden.
Marti bleibt dabei, dass Zink «grundsätzlich gesund» sei, er sei in den letzten zwanzig Jahren noch nie krank gewesen. Auch die Mitarbeiter seien nie krank, es habe nie einen Unfall gegeben, nie «Lämpen» mit den Nachbarn wegen der Schafe, die auf der Zinkwiese grasen würden. Diese seien auch nie krank.
«Ich habe das Gefühl, wir machen nicht alles falsch im Betrieb.»
Nach rund zwei Stunden schickt Richterin Weingart Paul Marti in die Verhandlungspause. In dieser erzählt er weiter von der Arbeit und davon, wie man früher im Geschäft «einfach gemacht» habe. Heute dürfe man gar nichts mehr. Er habe das Gefühl, es ginge «von einem Extrem ins andere». Früher habe man noch Zinkfieber gehabt, sich elend gefühlt am Abend, nachdem man mit Zink hantiert habe. «Aber am nächsten Morgen wars wieder gut.»
Manchmal huscht ein verschmitztes Lächeln über Martis Gesicht, vielleicht weiss er, dass das alles nicht so unproblematisch tönt, dass seine Messlatte für Gefährlichkeit gefährlich tief liegt.
Mit schelmischer Unverfrorenheit fragt er die Richterin nach der Pause: «Muss ich mich jetzt verstecken?» Doch das Urteil nimmt der 57-Jährige dann nicht mehr auf die leichte Schulter. Zu sehr hatte er mit richterlicher Milde und Geduld gerechnet. Und nun wird er schuldig gesprochen.
Er habe die Sorgfaltspflicht missachtet, keine Person ernannt, die im Betrieb verantwortlich wäre, und Umwelt-, Gewässer- und Chemikaliengesetz gebrochen. Die Richterin schraubt die Strafe von 20 Tagessätzen auf 140 à 150 Franken hoch, das macht satte 21’000 Franken. Diese wird zwar bedingt ausgesprochen, bei einer Probezeit von 4 Jahren, doch die Übertretungsbusse von 10’000 Franken und die Verfahrenskosten von 4500 Franken wird Marti bezahlen müssen. Auf eine Verbindungsbusse verzichtet das Gericht.
Weingart wiederholt, das Gericht könne nicht beurteilen, ob das Zinkpulver gefährlich sei oder nicht, es stütze sich auf die Fachstellen. «Es ist ein gutes Zeichen, dass Sie es besser machen als früher, aber das heisst nicht, dass es nach den geltenden Gesetzen reicht. Diese müssen eingehalten werden.» Das Gericht gehe davon aus, dass Marti um die Gefährlichkeit des Pulvers wisse, und es sei von ihm zu erwarten, dass er sich informiere.
Der Unternehmer hatte in der Verhandlungspause durchblicken lassen, die Busse werde ihn und sein Geschäft nicht ruinieren, auch wenn es viel Geld sei.
Ein «Denkzettel», wie Richterin Weingart die Strafe nennt, ist es allemal.
Illustration: Till Lauer