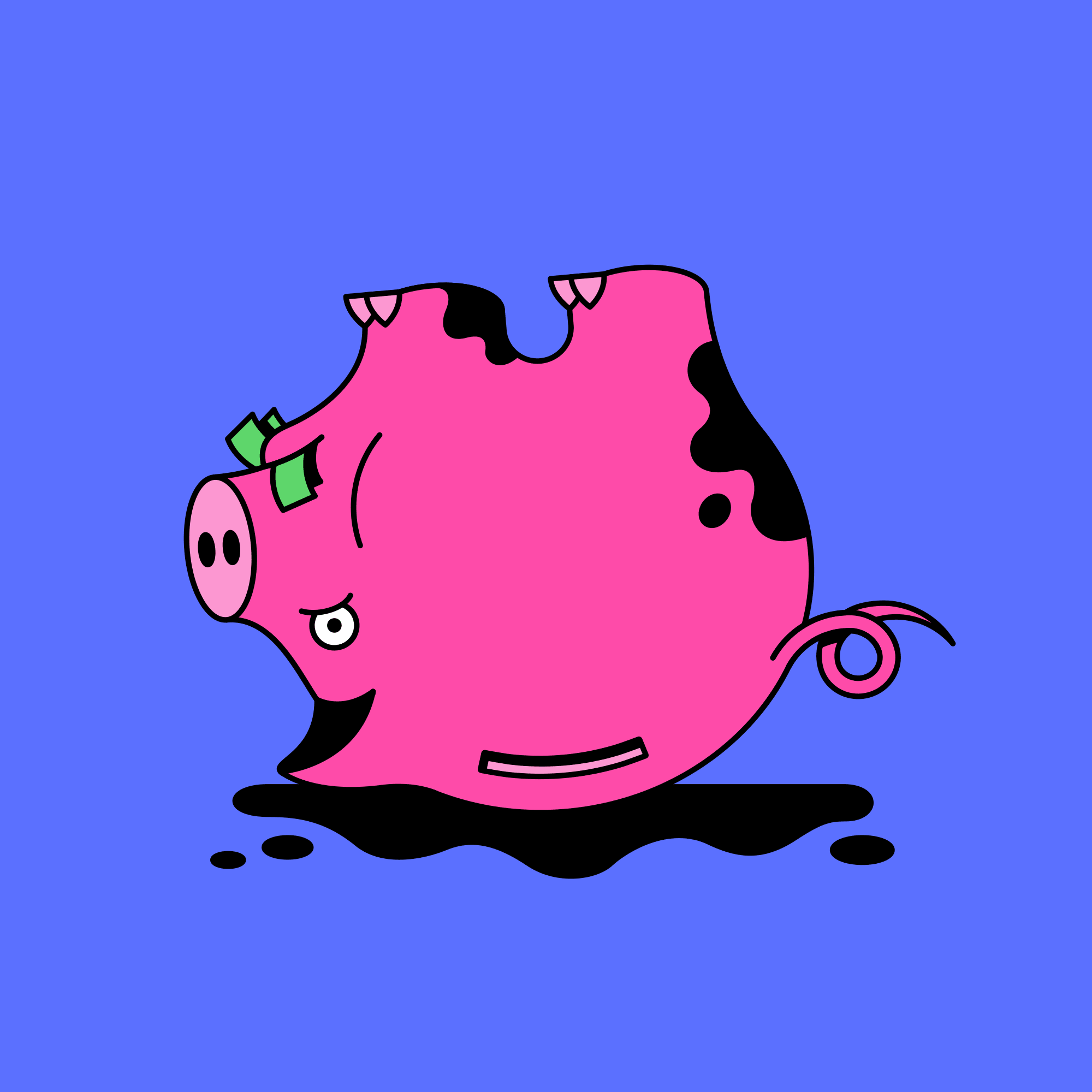
Schweizerische Krisenanstalt
Die Credit Suisse steckt in ihrer grössten Krise. Ursache: kolossale Fehlleistungen in Serie. Unverzichtbar ist die Grossbank für die Schweiz trotzdem.
Von Beat Schmid (Text) und Till Lauer (Illustration), 12.08.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Mit der legendären SKA-Mütze auf dem Kopf trat Thomas Gottstein zum letzten Mal vor die Belegschaft.
Personen, die an der Townhall-Veranstaltung Ende Juli dabei waren, berichten von einem aufgewühlten Chef. In ungewohnt hoher Lautstärke soll er sich verabschiedet haben. CEO einer Bank zu sein, sei ein Sch***job, so Gottstein. Das habe ihm schon Brady Dougan gesagt, sein Vorvorgänger.
Die Probleme der Credit Suisse, sie scheinen allmählich auch in der Chefetage die Moral zu zersetzen. Ein CS-Manager sagt: «Irgendwann hältst du den Druck einfach nicht mehr aus.»
Gottstein war zur falschen Zeit im falschen Job. Er war ein dealmaker, einer, der Börsentransaktionen einfädelte und grosse Firmenkredite aushandelte. Mit seiner coolen Art kam er bei Schweizer Unternehmern an. Doch intern konnte er sich nicht durchsetzen, er kam bei der Basis nicht an. Nun musste er gehen – nach nicht einmal zweieinhalb Jahren im Amt.
Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Warum ist die einst stolze Grossbank so tief gefallen? Um das zu verstehen, zeichnen wir den Abstieg der CS seit der Finanzkrise nach, wir beleuchten die neue Strategie kritisch und erklären die Fehlleistungen im Fall Greensill, dem grössten Kundendebakel der CS-Geschichte.
Warum uns das etwas angeht? Weil die Schweizer Wirtschaft stark davon profitiert, wenn es auf dem Finanzplatz nicht nur eine international vernetzte Grossbank gibt, sondern zwei. Mehr dazu später.
Um den Grossverdiener Gottstein zumindest muss man sich keine Sorgen machen. Obschon er eigentlich das Rampenlicht nie suchte, war er ein Profiteur des Systems. Im Jahr 2020 betrug sein Lohn 6,35 Millionen Franken, ein Jahr später 3,75 Millionen. Jetzt dürfte er noch für zwölf Monate bezahlt sein, bei einem Basissalär von knapp 3 Millionen Franken.
Man wird ihn wohl wieder öfter im edlen Golf & Country Club Zürich in Zumikon antreffen. Der 58-Jährige hat ein sensationelles Handicap von 0,7. In jungen Jahren hätte er auch Golfprofi werden können. «Er verfügt über einen unglaublichen Swing», sagt einer, der mit ihm schon eine Runde absolvierte. Wenn Gottstein fällt, fällt er weich.
Ganz anders die Credit Suisse.
Die Anlegerzeitung «Finanz und Wirtschaft» macht sich inzwischen darüber lustig, dass man mit einer CS-Aktie nicht einmal mehr einen Espresso beim «Sprüngli» am Paradeplatz bezahlen könnte.
CS weiter im Sinkflug, während sich die UBS erholt
Entwicklung der Aktienkurse von CS und UBS seit der Finanzkrise 2008
Quelle: Yahoo Finance. Gezeigt wird der bereinigte Schlusskurs von Credit Suisse und UBS (Aktiensplits und Dividendenausschüttungen berücksichtigt).
Vor zwei Wochen gab die Bank das Ergebnis für das zweite Quartal bekannt und unterbot die dunkelsten Prognosen. Sie machte einen Reinverlust von 1,6 Milliarden Franken. Die Ergebnisse verschlechterten sich in allen Geschäftssegmenten. Drastisch ist der Ertragsrückgang auf 3,6 Milliarden. So wenig hat die Bank seit vierzig Quartalen nicht mehr verdient.
Gleichzeitig fällt der Aktienkurs konstant. Seit Anfang Jahr hat er 43 Prozent an Wert verloren. Der Verwaltungsrat war gezwungen, die Reissleine zu ziehen: CEO Gottstein wurde entlassen, der Chef des Investmentbankings abgesetzt.
Wer kann, der geht
CS-Präsident Axel Lehmann räumt nun die Scherben zusammen. Er hatte sich redlich Mühe gegeben, die Entlassung von Gottstein schönzureden. Nein, der Abgang sei nicht forciert gewesen, sagte er in einem TV-Interview mit CNBC. Und ja, die Bank habe entschieden, den Transformationsprozess zu beschleunigen. Ein solcher Prozess verlange die volle Energie eines CEO. An diesem Punkt hätten Gottstein und er gespürt, dass ein Wechsel besser sei.
Transformation, was heisst das eigentlich? In den Worten Lehmanns bedeutet es: die Investmentbank abbauen und stärker auf die Bedürfnisse der Kundinnen der Vermögensverwaltung eingehen. Im Handelsgeschäft die Risiken herunterfahren und gruppenweit die Kosten senken, um eine Milliarde pro Jahr.
Ich will es genauer wissen: Was bedeuten die Begriffe «Investmentbank», «Wealth-Management» und «Asset-Management»?
Für die Geschäftsfelder von Grossbanken gibt es keine einheitlichen Definitionen. Die Banken verwenden zwar die gleichen Begriffe, interpretieren sie aber oft auf ihre Art. Zudem gibt es innerhalb der Banken bei allen Bereichen Überschneidungen, so auch bei den Divisionen der Credit Suisse:
Das Wealth-Management beziehungsweise die Vermögensverwaltung bedient überdurchschnittlich reiche Kunden. In der Finanzwelt spricht man von (ultra) high-net-worth individuals, (sehr) vermögenden Privatpersonen mit einem investierbaren Vermögen ab 30 beziehungsweise 5 Millionen Franken. Die Bank legt das Geld im Auftrag der Kundschaft an.
Auch die Investmentbank investiert Geld. Die Kundschaft ist aber eine andere als beim Wealth-Management. Das Geld stammt von Firmen, Regierungen, Pensionskassen, Hedgefonds, privaten Investorinnen oder anderen Finanzinstituten. Die Bank übernimmt für sie den Wertschriftenhandel, die Kapitalbeschaffung und die Beratung. Bis vor ein paar Jahren war das Geschäft mit hohen Risiken verbunden, inzwischen gelten schärfere Regeln.
Das Asset-Management ist nahe beim Wealth-Management angelegt. Asset-Manager sind aber in ihren Entscheidungen autonomer als Vermögensberaterinnen. Die Kundschaft ist ähnlich wie bei der Investmentbank. Investiert wird vornehmlich in Anlage- und Immobilienfonds, die sozial, ökologisch und führungstechnisch nachhaltiger sind.
Zum Schweizer Geschäft, bei der CS Swiss Bank genannt, zählen hauptsächlich Privat- und Firmenkunden, die bei der Bank ein Konto führen oder sich bei ihren Anlagen beraten lassen. Zum Schweizgeschäft zählen auch Tochterfirmen, die Kleinkredite verkaufen oder Kreditkarten herausgeben.
Allerdings ist diese Strategie nicht neu. Sie wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgerufen, zwar immer wieder in neue Worte gepackt, doch der Inhalt blieb stets der gleiche. Vor sieben Jahren versprach der frisch gekürte CEO Tidjane Thiam eine Fokussierung auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit einer Redimensionierung des Investmentbankings. Auch er setzte den Sparstift an, strich Stellen und senkte die Kosten rigoros.
Doch langsam scheinen die Investoren genug zu haben. Beim aktuellen Wert der Aktie kommt die Credit Suisse auf eine Börsenkapitalisierung von rund 14 Milliarden Franken. Schaut man aber auf das Eigenkapital der Bank, weist sie einen Buchwert von 44,4 Milliarden Franken aus.
Das ergibt ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von weniger als 0,3. Das Ziel müsste es sein, dass dieser Wert bei 1 liegt. Kaum eine andere Bank mit Ausnahme der Deutschen Bank handelt auf einem so tiefen Niveau. Die UBS hat ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von knapp über 1, Julius Bär von 1,5. Je tiefer die Kennzahl, desto höher das Misstrauen der Anleger.
Die Bank befindet sich auch personell in einem desolaten Zustand. Mit jeder «neuen Strategie», jeder «Transformation», jedem «Übergangsjahr», das die Chefs ankündigen, steigt der Frust in der Belegschaft. Wer kann, der geht.
Die Geschäftsleitung ist seit Anfang 2021 praktisch vollständig ausgewechselt worden. Nur der Finanzchef ist noch der gleiche. Allerdings hat dieser seinen Abschied bereits angekündigt. Er bleibt nur noch so lange, bis eine Nachfolge gefunden ist. Zudem fehlt eine Chefin für das Asset-Management, da dessen Leiter Ulrich Körner zum neuen CEO erkoren wurde. Das Asset-Management ist neben dem Schweizer Klein- und Firmenkundengeschäft, der Investmentbank und dem Privatbanking die kleinste Geschäftseinheit.
Dass die Finanzmarktaufsicht (Finma) bei einer systemrelevanten Bank ein derartiges Führungschaos zulässt, verwundert. Aber ihr bleibe wohl auch gar nichts anderes übrig, wie ein ehemaliger Kadermann bemerkt, der anonym bleiben möchte.
Ex-UBS-Leute sollen die CS retten
Jetzt soll Ulrich Körner die angeschlagene Bank aus dem Tief holen. Er ist der dritte CEO innerhalb von drei Jahren. Eigentlich ist auch er ein CS-Urgestein, doch von 2009 bis 2020 arbeitete er bei der UBS. Banker-Legende Oswald Grübel warb ihn vor dreizehn Jahren ab. Damals ging es der UBS schlecht, etliche CS-Manager wechselten zur Konkurrentin. Sogar den Garagisten lotste Grübel zur UBS.
Das Karussell dreht sich wieder in die andere Richtung. Der vormalige Präsident António Horta-Osório holte Axel Lehmann im Oktober 2021 zur Credit Suisse, wo dieser zunächst Präsident des Risikoausschusses des Verwaltungsrats wurde. Lehmann wurde Ende 2020 als Schweiz-Chef bei der UBS abgesetzt, seine Karriere schien beendet. Er ergriff die Chance, sie neu zu lancieren.
Diese erhielt kurz darauf einen unerwarteten Push, denn nur wenige Monate später musste Horta-Osório zurücktreten, weil er Quarantäneregeln verletzt und den Businessjet zu oft für private Termine gebucht hatte. Im Februar übernahm Lehmann das Präsidium. Er ist der dritte Präsident in den letzten drei Jahren.
Von der UBS kommt auch der neue Rechtschef Markus Diethelm. Sein Job ist es, die langwierigen und kostspieligen Rechtsfälle zu beenden. Die «Handelszeitung» hat ausgerechnet, dass die CS in zehn Jahren 16,3 Milliarden Franken für Rechtsfälle zurückgestellt hat. Bei der UBS waren es mit 13,2 Milliarden Franken allerdings auch nicht viel weniger.
Und eben, auch der CEO kommt von der UBS. Körner fasst den gleichen Job wie einst Oswald Grübel bei der UBS: das Investmentbanking zügeln und in den Dienst der Vermögensverwaltung stellen. Die Aufgabe scheint Körner auf den Leib geschnitten. Er kennt den Restrukturierungsprozess von der UBS als Chief Operating Officer und rechte Hand von Oswald Grübel. Also nochmals the same procedure für «Ueli the knife», wie Körner intern bereits genannt wird?
Die entscheidende Frage dürfte eine andere sein: Ist es auch die richtige Strategie für die Credit Suisse?
Auch das Wealth-Management ist ein Sanierungsfall
Gehen wir nochmals zurück zum desaströsen Quartalsresultat. Einen schlechten Job machte nicht nur die Investmentbank mit einem Vorsteuerverlust von 1,1 Milliarden Franken. Was im Getöse unterging: Auch das Wealth-Management wies einen Verlust aus von 96 Millionen.
Das ist bemerkenswert, denn die Vermögensverwaltung ist normalerweise Garant für zuverlässige Ertragsströme, die auch dann fliessen, wenn die Börsenkurse fallen. Dafür sorgen Vermögensverwaltungsmandate, die regelmässig Gebühren abwerfen. Doch bei der CS ist der Anteil von wiederkehrenden Einkünften (recurring fees) viel kleiner als bei anderen Banken. Der Anteil von transaktions- und erfolgsabhängigen Einnahmen dagegen ist grösser. Doch diese sind viel stärker den Launen der Märkte ausgesetzt.
Es ist die Aufgabe von Francesco De Ferrari, dem neuen Leiter des Wealth-Managements, das Geschäft so umzubauen, dass es vermehrt verlässliche Einkünfte generiert. Obschon er nun schon seit einigen Monaten im Amt ist, ist davon noch wenig zu spüren.
De Ferrari hat ein Geschäft übernommen, das stark von einem Mann geprägt war, der die CS-Vermögensverwaltung zwischen 2015 und 2019 geleitet hatte und zuletzt Schlagzeilen über den Finanzplatz hinaus gemacht hatte: Iqbal Khan. Das «Wunderkind des Schweizer Bankenplatzes» wurde durch seinen Wechsel zur UBS und die damit verbundene Beschattungsaffäre bekannt.
Khan setzte vor allem auf transaktionsorientiertes Banking, das zusätzlich durch Kredite befeuert wurde. Reiche Kundinnen konnten ihre Depots mit Lombardkrediten belehnen, um so mit einem grösseren Hebel an der Börse zu spekulieren. Lombardkredite sind Instrumente, die von vermögenden Kunden nachgefragt werden, die dafür ihre Wertpapiere oder andere Sicherheiten verpfänden. Solange die Kurse stiegen, und das taten sie bis November 2021, lief das Geschäft bestens.
Doch dann kippten die Märkte, und die Kundinnen, vor allem aus dem asiatischen Raum, lösten ihre Kreditlinien auf. Im ersten Quartal 2021 erreichten die transaktionsbasierten Einnahmen fast eine Milliarde Franken. Im abgelaufenen Quartal ist es weniger als die Hälfte. Die wiederkehrenden Einnahmen hingegen sind im gleichen Zeitraum nur leicht gefallen. Es ist also nicht so, dass die Vermögensverwaltung der Credit Suisse ein sicheres Blatt wäre, auf das ein Pokerspieler sein letztes Hemd setzen würde.
Khan hinterliess der CS ein weiteres, ungleich schwerwiegenderes Erbe, dessen Ausmass noch von der Finma untersucht wird und das der CS noch viel Ungemach bringen könnte, wie Recherchen der Republik zeigen.
Doch bevor wir zum grössten Kundendebakel der CS-Geschichte kommen, wärmen wir uns mit einer kurzen Rekapitulation der jüngsten Fehlleistungen auf.
1. Spy-Gate
Im September 2019 wird der Beschattungsfall um Iqbal Khan bekannt. Khan leitet das Wealth-Management bei der Credit Suisse und ist im Begriff, zur Konkurrentin UBS zu wechseln. Bei der CS befürchtet man, dass Khan Ex-Kollegen zur UBS holen könnte. Und so wird eine Detektei auf den Banker angesetzt. Doch die Aktion läuft aus dem Ruder. Eine interne Untersuchung ergibt später, dass weitere ranghohe Manager beschattet wurden. Ein enger Mitarbeiter von CEO Tidjane Thiam wird zur Verantwortung gezogen und verlässt das Unternehmen im Oktober. Im Februar 2020 wird der Druck für Thiam zu gross, und er tritt als CEO zurück. Er sagt, er habe von der Beschattungsaktion nichts gewusst.
Im Zuge der Affäre wird auch bekannt, dass es zwischen Khan und Thiam zu heftigen Kollisionen kam. Hintergrund ist ein Nachbarschaftsstreit zwischen den beiden. Ohne vorgängig seinen Chef zu informieren, kaufte Khan in Herrliberg ein Grundstück, das direkt an Thiams Villa angrenzt. Um seine Privatsphäre zu schützen, liess Thiam eine Hecke pflanzen. Dies wiederum soll Khans Frau verärgert haben, weil die Thujahecken angeblich die Sicht auf die Glarner Alpen nehmen. An einer Cocktailparty mit Geschäftsleitungsmitgliedern und ihren Frauen im Hause Thiam kommt es zur direkten Konfrontation. Ein gefundenes Fressen, nicht nur für die Boulevardmedien.
2. Affäre Lescaudron
Im Januar 2018 beginnt in Genf der Prozess gegen den ehemaligen CS-Kundenberater Patrice Lescaudron. Zu seinen Klienten gehörten osteuropäische Oligarchen, darunter Bidsina Iwanischwili, ein Milliardär und ehemaliger Premier der einstigen Sowjetrepublik Georgien. Lescaudron wird zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der Berater soll Gelder im Umfang von mehreren hundert Millionen Franken veruntreut haben. Dabei konnte er die internen Sicherheitsregeln umgehen. Im Sommer 2020 nahm er sich im Gefängnis das Leben.
Iwanischwili hat sich 2019 mit anderen Geschädigten zur Klägergruppe «CS Victims» zusammengetan und in Singapur und den Bermudas Schadenersatzklagen eingereicht. Dort hat die Gruppe einen ersten Sieg errungen. Ein Gericht des Karibikstaates hat die CS Ende März zu einer Zahlung von 500 Millionen Dollar verdonnert. Die Bank ist in Berufung gegangen.
3. «Suisse Secrets»
Am 20. Februar 2022 dominiert die CS die internationalen Schlagzeilen. «Suisse Secrets», die Datenleak-Recherche von «Süddeutsche Zeitung», «Guardian», «New York Times», «Le Monde» und weiteren Medien, nimmt die Credit Suisse ins Visier. Die Bank habe bis 2015 Gelder von Hochrisikokundinnen angenommen, obschon diese zum Teil wegen Betrugs und anderer Delikte verurteilt waren. Die Straftaten seien in einschlägigen Datenbanken wie World-Check, die zur Identifizierung der Kunden genutzt werden, zum Zeitpunkt der Kontoeröffnungen eingetragen gewesen, schreiben die Journalistinnen. Die CS spricht von einer «konzertierten Aktion mit der Absicht, den Schweizer Finanzplatz zu schädigen».
4. Archegos
Am 26. März 2021 bricht der New Yorker Hedgefonds Archegos zusammen und hinterlässt bei mehreren Investmentbanken ein Loch von 10 Milliarden Dollar. Den grössten Verlust erleidet die CS mit 5 Milliarden. Das Vehikel von Bill Hwang spekulierte mit riesigen Einsätzen in tief bewertete Technologietitel und pushte so deren Aktienwert nach oben. Der Fonds brach zusammen, nachdem US-amerikanische Medien- und Technologieaktien ins Wanken geraten waren und die Banken sogenannte margin calls ausgelöst hatten. Die Händler der CS reagierten viel zu spät und blieben auf den implodierten Aktien sitzen. Es ist der grösste Handelsflop in der Geschichte der Grossbank.
5. Greensill
Am 1. März 2021 brach der Greensill-Skandal aus. An diesem Tag griff die CS zu einem drastischen Mittel, indem sie Fonds blockierte, die in Verbindung mit dem australischen Finanzdienstleister Greensill standen. Damit wurden auf einen Schlag Kundenvermögen in der Höhe von 10 Milliarden Dollar eingefroren. Der Geschäftsmann Alexander David «Lex» Greensill war 2011 in das Geschäft von Lieferkettenfinanzierungen eingestiegen, das daraus bestand, offene Rechnungen in Wertpapiere zu verpacken. Die CS überzeugte vermögende Kunden, in solche Supply-Chain-Finance-Fonds zu investieren und verpasste den Zeitpunkt zum Aussteigen. Bis das System zusammenbrach.
Die fünf hier aufgezählten Fälle kamen und kommen die Credit Suisse teuer zu stehen, sei es, weil Kunden entschädigt werden müssen, sei es, weil das Vertrauen der Investorinnen verloren geht.
Im Unterschied zu den Grossunfällen wird der Greensill-Skandal die Bank noch lange beschäftigen. Der Archegos-Fall kostete zwar enorm viel Geld, doch die Untersuchungen sind abgeschlossen und die Abteilung, die den Schaden anrichtete, das sogenannte Prime Brokerage, wird abgewickelt.
Greensill hingegen schwelt weiter: Zum einen ist das Enforcement-Verfahren der Finma noch nicht abgeschlossen. Zum andern warten viele vermögende Kunden auf die Rückzahlung von Geldern. Jahrelange, teure Verfahren kommen auf die Bank zu. Der Skandal zeigt, wie gefährlich das vermeintlich harmlose Vermögensverwaltungsgeschäft für ein Bankinstitut werden kann.
Risikomanagement ausser Kontrolle
Bereits zuvor gab es Probleme mit den Fonds. CEO Gottstein veranlasste im Jahr 2020 eine interne Untersuchung. Wie kam die CS überhaupt zu diesem Geschäft, welche Fehler wurden begangen?
Nur einen Monat nach der Blockierung der Fonds wurde bekannt, dass die Finma ein sogenanntes Enforcementverfahren gegen die CS im Zusammenhang mit Greensill gestartet hatte. Dabei handelt es sich um ein offizielles Beweisverfahren, an dessen Ende Massnahmen von unterschiedlicher Schärfe angeordnet werden können wie Berufsverbote oder der Entzug der Banklizenz.
Noch läuft die Untersuchung. Gemäss Recherchen der Republik wurden im Mai die letzten CS-Spitzenmanager von der Finma befragt. Das Verfahren befindet sich somit in der Schlussphase. Es ist damit zu rechnen, dass die Resultate noch in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden.
Es liegt in der Natur des Auftrags der Finma, vor allem Mängeln im Risikomanagement von Finanzinstituten nachzugehen. Wie die Republik aus Gesprächen mit involvierten Personen erfahren hat, stiessen die Untersuchungsbeauftragten auf schwere Konstruktionsfehler beim Aufbau des Geschäfts.
Was war falsch am Set-up? Um das zu verstehen, muss man in die Details eintauchen. Das Basisprodukt der Fonds sind Finanzierungslösungen für Unternehmen, um schnell an Liquidität zu gelangen. Man muss sich das so vorstellen: Eine Firma liefert eine Ware aus und schickt die Rechnung hinterher. Doch bis die Kundin bezahlt, können 30, 60 oder mehr Tage verstreichen.
Das Unternehmen muss auf das Geld warten, erst dann kann es investieren oder Vorleistungen einkaufen. Hier springen Lieferkettenfinanzierer ein. Sie kaufen der Firma die Rechnung ab, bezahlen aber nur 99 Prozent des Betrags. Das Unternehmen ist damit zufrieden und kann weiterarbeiten.
Der Lieferkettenfinanzierer treibt dann das Geld beim Kunden ein, und zwar 100 Prozent des Betrages. Das eine Prozent steckt der Finanzierer für sich ein. Entsprechend ist das Geschäft ebenfalls kapitalintensiv. Das ist der Punkt, an dem die Banken ins Spiel kommen. Sie stellen den Finanzierungsgesellschaften wie Greensill das nötige Kapital gegen einen Zins zur Verfügung.
Um die Kredite nicht auf der eigenen Bilanz zu haben, werden sie in handelbare Finanzprodukte umgepackt – sie werden verbrieft, wie das Banker nennen. Bei Greensill spricht man in diesem Zusammenhang von sogenannten notes. Diese notes wiederum wurden vom Asset-Management der CS in Fonds verpackt, deren Anteile vom CS-Private-Banking als sichere Anlagen vermögenden Kundinnen verkauft wurden.
Die ursprünglichen Liquiditätsrisiken wurden also verbrieft, gebündelt und verkauft. Sie wanderten vom Lieferanten zum Lieferkettenfinanzierer (Greensill), zur Bank (Credit Suisse), zu den Fonds und landen zuletzt in den Depots von Bankkunden. Insgesamt flossen 10 Milliarden Dollar Kundenvermögen in «Credit Suisse Supply Chain Finance Funds».
Das Geschäft lief wie geschmiert.
Das Problem ist, dass hinter den notes Kredite stehen, die vor Greensill auch an Unternehmen gezahlt wurden, die über eine schlechte Bonität verfügen, wie etwa den britisch-indischen Stahlmagnaten Sanjeev Gupta. Sein Unternehmen erhielt auch dann Geld, wenn dahinter keine Rechnungen standen, sondern zukünftige Rechnungen. Man nannte das future receivables – nicht existierende Rechnungen von noch nicht existierenden Kundinnen. Gupta selbst sprach von «prospektiven» Rechnungen.
Der Punkt ist: Für die CS sind Lieferkettenfinanzierungen keine Besonderheit. Im Firmenkundengeschäft gehören sie zum Standard. Doch der entscheidende Unterschied ist: Wenn die Bank die Kredite auf die eigene Bilanz nimmt, dann greifen professionelle Kontrollinstrumente. Die Kreditabteilung durchleuchtet die zu finanzierenden Unternehmen und wacht über die Kredite. Eingeschliffene Risikoprozesse sorgen dafür, dass Probleme auf dem Radar erfasst und, wenn sie auftauchen, eng begleitet werden.
Anders ist das im Asset-Management, wo die verbrieften Kredite in die Fonds abgefüllt wurden. Die Abteilung verfügt über keine vergleichbaren Sicherungsmechanismen. In der Regel braucht sie das auch nicht, in den Fonds sind normalerweise Aktien, Anleihen oder andere liquide Papiere, deren Bonität von einer Armada von Ratingagenturen überwacht wird.
Bei den Greensill-Papieren war das eine andere Sache, niemand schaute sich die Risiken dahinter genau an. Dieses Kontrollmanko wurde bei der Konstruktion der CS-Fonds übersehen, vergessen oder bewusst zur Seite gewischt.
Der Enforcement-Bericht der Finma wird darüber Auskunft geben. Die Köpfe hinter den Fonds sind der damalige Chef des Asset-Managements der CS, Eric Varvel, und Michel Degen, Schweiz- und Europachef der Abteilung. Eine entscheidende Rolle beim Set-up, bei der Vermarktung und dem Verkauf der Fonds spielte aber auch Iqbal Khan, der als Chef des Wealth-Managements auch das Asset-Management führte. Im Jahr 2012 wurden die zuvor getrennten Abteilungen fusioniert. Seit April 2021 wird das Asset-Management wieder als eigenständige Einheit geführt.
Ein grosses Köpferollen ist nicht mehr zu erwarten. Die damaligen Verantwortlichen wurden kurz nach Auffliegen des Skandals im März 2021 suspendiert beziehungsweise entlassen.
Iqbal Khan war zu diesem Zeitpunkt bereits bei der UBS. Auch Gottstein kann es nicht mehr treffen.
Allerdings kann das Ergebnis des Enforcement-Berichts Auswirkungen auf laufende Rechtsverfahren haben. Im April 2021 reichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bei der Zürcher Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige ein. In der Folge führte die Oberstaatsanwaltschaft letzten Herbst Razzien im Asset-Management der CS in Zürich sowie bei vier Mitarbeitern durch. Dabei beschlagnahmten die Beamtinnen Dokumente, welche die Grossbank via Anwälte umgehend versiegeln liess. Es ist im Interesse der Staatsanwälte, auf die Erkenntnisse der Finma-Untersuchung zugreifen zu können.
Im Greensill-Verfahren gehen die Ermittlungsbehörden dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs nach. Anleger könnten beim Vertrieb der Greensill-Fonds getäuscht worden sein, weil möglicherweise unrichtige oder irreführende Angaben gemacht worden waren. Später könnten zudem Schadenersatzklagen auf die CS zukommen. Die Bank gab an, dass von den ursprünglich investierten 10 Milliarden Dollar rund 2 Milliarden sehr schwer zurückzuholen seien.
Die Finma äussert sich nicht zu laufenden Verfahren, wie sie schriftlich mitteilt. Sie lässt auch offen, wann die Untersuchung zur CS zu einem Abschluss kommt.
Auch die CS will auf Anfrage weder zu den Einvernahmen noch zu den Sicherheitsmechanismen im Asset-Management Stellung nehmen.
Was würde Rainer E. Gut sagen?
Zurück zur Frage: Soll sich die CS – so wie die UBS – auf das Vermögensverwaltungsgeschäft konzentrieren und das Investmentbanking zurechtstutzen?
Interessant wäre dazu eine Antwort von Rainer E. Gut, dem langjährigen CEO und Verwaltungsratspräsidenten der Bank, der die frühere Schweizerische Kreditanstalt (SKA) weltweit auf die Landkarte setzte. Der 89-Jährige ist Ehrenpräsident der CS und lebt heute zurückgezogen in Maur ZH. Eine Anfrage der Republik blieb unbeantwortet.
Interessant wäre seine Einschätzung, weil er und folgende Chefs wie Oswald Grübel und Brady Dougan die CS als eine Investmentbank mit angehängtem Private Banking verstanden. So funktionierte die Bank seit ihren Anfängen im Jahr 1856. Von Alfred Escher als SKA gegründet, bestand ihr Zweck darin, grosse Projekte zu finanzieren.
Escher führte ein neues Bankmodell in die Schweiz ein, das sich in europäischen Regionen, die sich industrialisierten, bereits durchgesetzt hatte. Das Modell der Handelsbanken «beruhte darauf, dass die Ersparnisse eines Landes eingesammelt wurden, um sie gezielt in die Förderung von Industrie und Eisenbahn zu investieren», schreibt der Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann in einem Aufsatz für die NZZ anlässlich des Escher-Gedenkjahrs 2019.
Daher überrascht es nicht, dass an der Spitze der Bank über viele Jahre Manager standen, die sehr viel vom Handelsgeschäft verstanden. Gut arbeitete bei Lazard in New York, bevor er zur damaligen SKA kam. Oswald Grübel arbeitete ab den 1970er-Jahren im Anleihehandel der SKA in London. Brady Dougan stieg im Derivategeschäft bei Bankers Trust ein und wechselte 1990 zu First Boston, mit der die CS damals ein Joint Venture unterhielt und die sie später voll in die Bank integrierte.
Allerdings überbordete die CS in den USA. Mit der Übernahme der Investmentbank DLJ im Jahr 2000 baute die Bank ihre amerikanischen Investmentaktivitäten massiv aus. Sie legte dafür 20 Milliarden Franken auf den Tisch. Es war ein völlig überteuerter Fehlkauf: Ende 2021, also mehr als zwanzig Jahre nach der Übernahme, musste die CS Abschreiber auf dem Kaufpreis vornehmen.
Doch damals passte das. Es war die Zeit des Dotcom-Hypes. Es herrschte Goldgräberstimmung. Die Bank war richtig gross im Geschäft mit Börsengängen. Frank Quattrone, der das Technologieteam bei Credit Suisse First Boston leitete, brachte Firmen wie Amazon an die Börse. Er persönlich verdiente Unsummen dabei. Zwischen 1998 und 2000 soll er rund 200 Millionen Dollar an Boni einkassiert haben.
Die Bonuskultur schwappte auch in die Schweiz über. Ältere Banker können sich noch erinnern, wie sie bis in die späten 1990er-Jahre jedes Jahr noch eine Gratifikation erhielten, die etwa einem Monatslohn entsprach. Doch dann, urplötzlich und ohne Grund, gab es einen halben Jahreslohn oder auch mehr obendrauf.
Wie zäh sich die von der Wall Street übernommene Bonuskultur in den Grossbanken hält, zeigt sich auch daran, dass selbst dann Milliardenboni ausbezahlt werden, wenn die Banken Verluste schreiben. Die UBS hat auch nach der Rettung durch den Staat im Jahr 2008 ihren Bankern noch 2 Milliarden ausgezahlt. Die CS hat letzte Woche angekündigt, zusätzlich 300 Millionen auszugeben, um Talente bei Laune zu halten.
Warum die Schweiz auf die CS angewiesen ist
Die aktuelle Führung hat sich entschieden, die CS zu einer Vermögensverwaltungsbank umzubauen. Die Ausgangslage ist eine andere als bei der UBS vor über zehn Jahren. Als die UBS nach Staatsrettung und Adoboli-Skandal durchs Stahlbad ging, war ihr Privatkundengeschäft grösser und die Investmentbank viel kleiner als bei der CS heute. Der Umbau bei der CS wird also viel drastischer ausfallen als bei der UBS.
Deshalb könnte die neue Strategie auch scheitern. Aber in der aktuellen Verfassung hat die Bankführung keine andere Wahl. Die CS hat in den letzten Jahren zu viel Substanz verloren, fast den gesamten Immobilienbestand hat sie verscherbelt, um Verluste zu stopfen. Und es fehlt ihr das Führungspersonal, um im Investmentbanking weiterhin eine führende Rolle zu spielen. Sie droht zu einer «UBS miniature» zu schrumpfen.
Für Private spielt es keine Rolle, ob die CS gross oder klein ist, ob es sie gibt oder nicht. Doch in der Welt der Grosskonzerne, und davon hat die Schweiz überdurchschnittlich viele, sieht das anders aus. Für sie ist es wichtig, dass es mit UBS und CS zwei Grossbanken gibt, die im Wettbewerb stehen.
Auch für die Finanzbranche selber sind die zwei Grossen wichtig. Der Chef der Privatbank Julius Bär, Philipp Rickenbacher, sagte in einem Interview mit der NZZ: «Konkurrenz belebt das Geschäft. Zwei gesunde und starke Grossbanken sind wichtig für den Schweizer Finanzplatz.»
Geht es um Börsengänge, geht es um Platzierungen von grossen Firmenkrediten – Industrieunternehmen können wählen: mal mit dieser, mal mit der anderen. Dass es in der Schweiz zwei Grossbanken gibt, ist ein Wettbewerbsvorteil. In Deutschland gibt es nur eine, in Österreich gar keine.
Eine Meinung dazu hatte auch Thomas Gottstein, der Nicht-mehr-Chef der Credit Suisse. In einem Doppelinterview mit dem damaligen Präsidenten António Horta-Osório bei Bloomberg TV sagt er: «Ich würde noch hinzufügen, dass der Schweizer Finanzplatz stärker ist, wenn es zwei grosse Player gibt.» Das sei wie in der Forschung, wo es gut sei, die ETH Zürich zu haben und die EPFL in Lausanne. «Oder im Fussball, die spanische La Liga ist ein starker Wettbewerb, weil es zwei grosse Konkurrenten gibt: Real Madrid und Barcelona.»