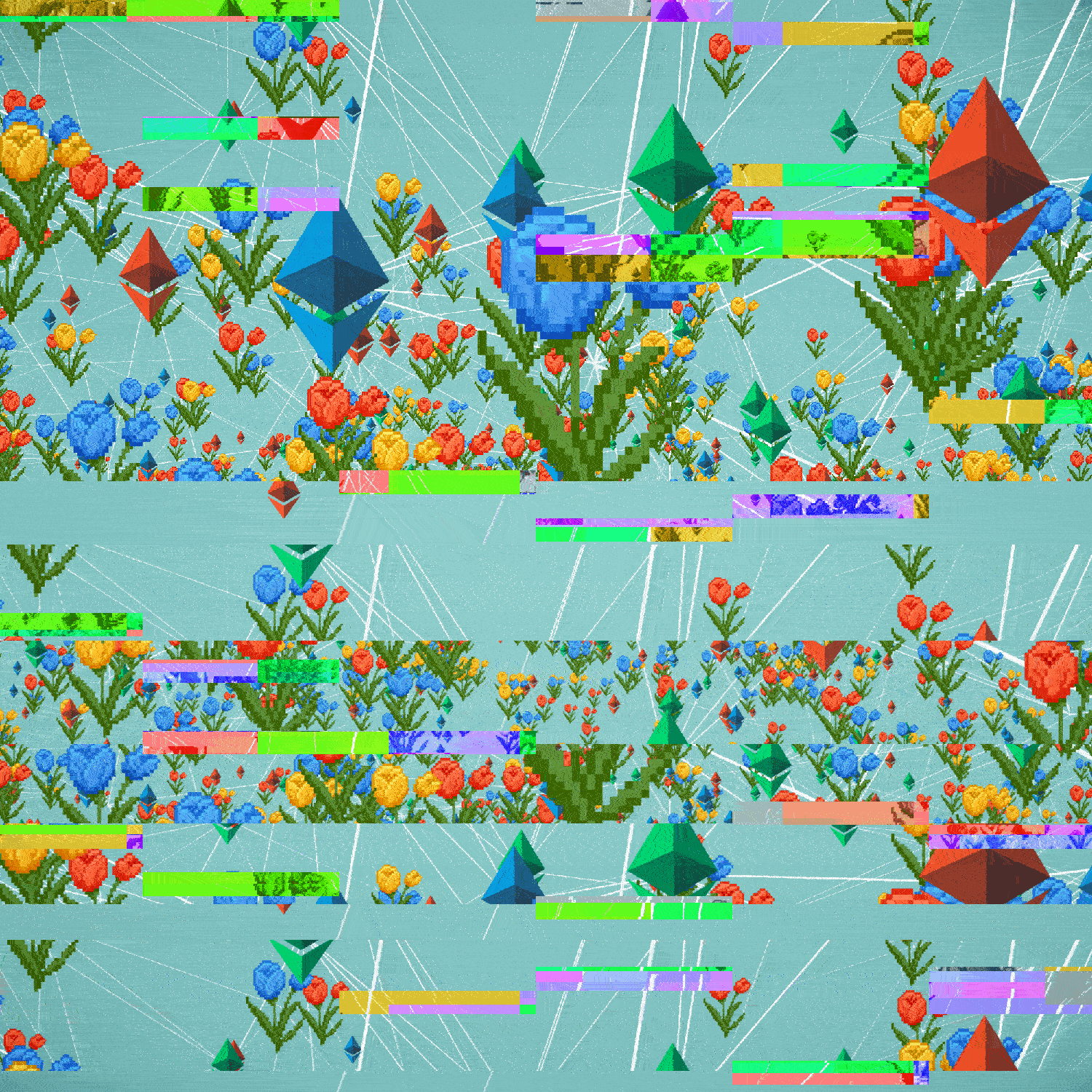
Von der Tulpenzwiebel zur Datei
Sind die NFT-Exzesse jetzt Kunst oder blosse Abzocke? Die Frage ist berechtigt. Aber sie gehört zum Wesen der modernen Kunst. Und wahnwitzig spekuliert wurde auch schon früher. «Kettenreaktion», Teil 2.
Von Jörg Heiser (Text) und Yoshi Sodeoka (Animation), 10.06.2022
Expertinnen sprechen davon, dass man mit einem NFT streng genommen gar nichts besitze; oder gleich davon, dass der Wert von Kryptowährungen auf lange Sicht «exakt null» sei (siehe dazu den ersten Teil dieses Artikels). Wundern muss man sich nur, wie viel Hype seit etwas über einem Jahr um den neuen Kunstfetisch NFT betrieben wird. Allerdings hat es immer wieder solche Spekulationsfieberschübe gegeben. Nicht umsonst wird in Sachen NFT häufig der Vergleich zur niederländischen Tulpenmanie der 1630er-Jahre gezogen. Damals wurden einzelne Tulpenzüchtungen bis hin zum Preis stattlicher Häuser gehandelt.
NFTs sollen im Internet Kunstwerke und Eigentümer zusammenbringen. Das führt zu zahlreichen Absurditäten – sowohl kommerziell als auch künstlerisch. Ein Augenschein in zwei Teilen. Zur Übersicht.
Sie lesen: Teil 2
Von der Tulpenzwiebel zur Datei
Meist erschöpft sich dieser Vergleich allerdings in einer simplen Parallele: dass eine von vielen betriebene Spekulation mit besonderen Objekten – ob nun Blumenzwiebeln oder digitale Wertmarken – zu einer masslosen Überbewertung führt, was schliesslich zum Kollaps des Marktes und zum Ruin vieler Teilnehmerinnen führt. Doch schaut man sich die einschlägige Literatur zur Tulpenmanie etwas genauer an (zwei Bücher aus den 2000ern stechen heraus, vom Briten Mike Dash und von der US-Amerikanerin Anne Goldgar), gibt es zahlreiche Entsprechungen, die viel tiefer gehen. Ja, es ist verblüffend, wie viele Strukturmerkmale sich ähneln. Mindestens elf bezeichnende Vergleichspunkte lassen sich benennen:
1. Voraussetzung ist ein gesellschaftlicher Wandel: vom Adel zum Bürgertum; vom alten Reichtum zum neuen Reichtum der Tech-Unternehmerinnen und Krypto-Investoren. Aber auch zum Aufstiegsstreben der zahllosen jungen Menschen auf den Philippinen, in Kasachstan, Venezuela oder Kalifornien, die in Krypto und Blockchain allgemein und vor allem in NFTs ihre Chance sehen, den Traum vom grossen Geld zu verwirklichen oder ihm zumindest ein kleines Stück näher zu kommen. Für eine Blase braucht es eine signifikante Zahl an Leuten, die unterbezahlt oder arbeitslos sind und ihre letzten Ersparnisse zusammenkratzen oder ihre Webstühle beleihen (so in den Niederlanden der 1630er-Jahre), sofern sie nicht vollends auf Pump spekulieren. Sie sind die grosse Masse derer, die nur kleine Beträge investieren und in den meisten Fällen leer ausgehen werden.
Den eigentlichen Motor des Hypes bildet derweil eine Schicht von Leuten, die bereits vermögend sind und über genug Spielgeld verfügen, um es riskieren zu können in einem «neuen» Markt. Und die dafür überhaupt Zeit haben. So war es im niederländischen 17. Jahrhundert, als die Regenten – reiche bürgerliche Kaufleute – erstmals allein von der Reinvestition ihres Vermögens leben konnten, von den Mühen einer anderen Form des Broterwerbs befreit. Und so war es zumindest zum Teil für die Online-Spekulantinnen, die während der Covid-Lockdowns seit 2020 mehr Zeit zu Hause vor dem Bildschirm verbringen konnten oder mussten, als ihnen lieb war. Selbst das Dystopische der Pandemie findet eine Parallele in der Zeit der Tulpenmanie: Damals war es die Beulenpest, die zwischen 1633 und 1637 – also zeitgleich zur Spekulationsblase – in mehreren niederländischen Städten wütete: Durch die vielen Toten stiegen die Arbeitslöhne für die Überlebenden; und eine geradezu fatalistische Bereitschaft machte sich breit, mit dem verdienten Geld auch hoch riskant zu spekulieren.
2. Die Spekulationsblase bringt neue Berufsfelder, neue Spezialisten hervor. Im Goldenen Zeitalter waren es die rhizotomi (griechisch: Wurzelschneider), eine neue Kaste von Zwischenhändlerinnen, die bei den Tulpenzüchtern auf dem Land nach neuen Kreationen suchten und sie in den Städten auf den Markt und zu den Sammlern brachten. Heute sind es natürlich besonders die Blockchain-Spezialistinnen, die sich hervortun, aber auch die Galeristen, Sammlerinnen und Künstler, die ins NFT-Business einsteigen und einen hoch spezialisierten Diskurs führen.
3. Das Handelsgut hat novelty-Charakter. Es erhebt deshalb Anspruch auf Kennerschaft und Exklusivität, sowohl über seine besondere Ästhetik und Exotik als auch über die neuartige Kultur des Handelns, die es entwickelt. So war es mit den Tulpenzwiebeln, so ist es nun mit den NFTs.
4. Grundlage des neuen Reichtums, der sich akkumuliert und die neue Blase nährt, ist allerdings eine ziemlich gnadenlose Ausbeutung beziehungsweise Extraktion von Ressourcen. Damals war es der niederländische Kolonialismus, der sich beispielsweise in den 1620ern durch einen mit grosser Brutalität geführten Krieg der Banda-Inseln (Indonesien) bemächtigte, dort rund 15’000 Ureinwohner ermordete, durch Sklaven ersetzte und sich das Monopol an der Muskatnuss sicherte (die Preise für Muskatnuss erreichten zeitweise ähnlich spekulative Höhen wie für Tulpenzwiebeln). Für Krypto werden – Gott bewahre – zwar heute keine Völkermorde verübt, aber unter allen Möglichkeiten moderner, globalisierter Gewinnmaximierung, die die Finanz- und Techmärkte bieten, stechen NFTs vor allem durch die erwähnte gnadenlos schlechte Klimabilanz der Krypto-Rechnerei hervor.
5. Nicht nur der Markt, auch die Marktplätze sind neu: Heute entstehen virtuelle Online-Handelsplätze wie Open Sea oder Nifty Gateway, damals waren es die Hinterzimmer der Tavernen in Haarlem oder Amsterdam. Dieser Markt bietet aufgrund seiner neuen Struktur und seiner quasi «magischen» Handelsware – magisch deshalb, weil ihr Nutzen nicht messbar ist, sondern letztlich auf ein Geschmacks- beziehungsweise Werturteil referiert – kaum Berechenbarkeit oder Stabilität. Es ist zudem ein weitgehend unregulierter Markt, der zahlreiche Tricks und Betrugsfallen bereithält für die Novizen.
6. Windhandel: Irgendwann – um genau zu sein: ab 1635 – wird gar nicht mehr die Zwiebel selbst gehandelt, die noch in der Erde steckt, sondern nur mehr ein Pfandschein (oder Zukunftsschein), der zukünftigen Besitz anzeigt, was aber nicht ausschliesst, dass bis dahin ebendiese Zwiebel kaputtgeht oder gestohlen wird. Oder auch, dass derjenige, der den Pfandschein verkauft, ein Betrüger ist und die betreffende Zwiebel gar nie besessen hat. Oder/und diese gar nicht existiert. In den Niederlanden nannte man das damals treffend «Windhandel».
Bei NFTs handelt es sich wie gesagt in der Regel ebenfalls um solche Pfandscheine (die Position im Verhältnis zu einem digitalen File) oder Zukunftsscheine (mit dem Erwerb des NFT verbundene zukünftige zusätzliche Gimmicks oder Leistungen). Der japanische Künstler Takashi Murakami hat nach diesem Prinzip (siehe erster Teil) seine «Flower Seeds» konzipiert, ob er dabei nun an den historischen Windhandel dachte oder nicht: Am Stichtag wächst eine digitale Blume, aber was für eine, weiss die Käuferin nicht. Die Entwicklung hin zu diesen zukünftig einzulösenden Scheinen soll den Markt beschleunigen. Es animiert dazu, die Ware möglichst vor dem Stichtag mit Gewinn weiterzuverkaufen und anderen die Überraschung zu überlassen, ob es ein freudiger Zahltag wird oder ein unschönes Erwachen.
7. Dazu gehören analog die im ersten Teil erwähnten Betrugstechniken rug pull und sockpuppeting beziehungsweise white washing. Selbstverständlich war es auch Teil des Windhandels, dass das Versprochene sich als Niete herausstellte oder über Strohmann-Käufer die Preise in die Höhe getrieben wurden.
8. «Billige» Kopien: Es war für Laien schwierig, wenn nicht unmöglich, eine teure Edelzwiebel von einer viel billigeren, ähnlich aussehenden Zwiebel zu unterscheiden – und nicht Letztere für Erstere untergejubelt zu bekommen. Im NFT-Markt geschieht es recht oft, dass zwar nicht das NFT als solches (da es ja nun mal mit grossem Rechenaufwand «nicht ersetzbar» gemacht wurde), sehr wohl aber die damit verbundene Bilder- und Brandingwelt kopiert beziehungsweise geklont wird, etwa wenn aus den «Crypto Punks» (verpixelte Punk-Köpfe) die «Crypto Phunks» werden. Am Preis sieht man dann, ob die Kundinnen wissend eine Billigkopie kaufen oder sich fälschlicherweise im Besitz eines «Originals» wähnen.
9. NFTs können wie Tulpenzwiebeln auch gestohlen, verloren oder bewusst zerstört werden, damit eine Verknappung der Ware erreicht wird. Gestohlen werden sie beispielsweise – wie auch andere digitale Dinge – durch Phishing-Scams (also die Täuschung zur Erlangung persönlicher Daten). Laut einer Umfrage unter tausend NFT-Besitzerinnen hatten rund die Hälfte von ihnen schon einmal den Zugang zu einem ihrer NFTs verloren. Das renommierte Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe verlor durch einen simplen Copy-Paste-Fehler versehentlich Zugang zu zweien seiner «Crypto Punks» im Wert von rund 400’000 Franken.
Man kann die Dinger aber auch absichtlich verlegen, besser gesagt, sie sind nun burned, verbrannt: Sie existieren dann zwar noch als Datensatz, zu dessen Adresse aber niemand Zugang hat. Und man ahnt es schon: All dies gab es natürlich auch bei den Zwiebeln, die häufig gestohlen, verlegt oder versehentlich, manchmal auch absichtlich zerstört wurden. Was der NFT-Legendenbildung der Copy-Paste-Fehler eines Museum-Mitarbeiters ist, war der Tulpenmanie die Geschichte von dem Matrosen, der bei einem Kaufmann eine sündhaft teure Semper-Augustus-Tulpenzwiebel von der Theke mitgehen liess im Glauben, es sei eine schnöde Gemüsezwiebel. Die Zwiebel schnitt er sich dann auf seinen Heringshappen und verspeiste sie – und damit, so die Legende, den Gegenwert von einer Million US-Dollar.
10. Das Versprechen von Exklusivität und Verfeinerung, das die Spekulationsware begleitet, führt zu verschiedenen Ausformungen. Superlativ-Behauptungen und endlose ästhetische Teilvariationen prägen nicht nur die NFT-Welt; so war es auch schon mit den Tulpen: Sie trugen neben der erwähnten, berühmten Semper Augustus ähnlich hochtrabende Namen mit Präfixen wie «Admiral» (meist ergänzt durch den Namen eines Züchters, etwa Admiral van der Eijck) oder «General», zuweilen noch gesteigert zu absurden Superlativen wie «Admiral der Admirale», «General der Generale» und so weiter. Mit anderen Worten: Wer sich hier einkaufte, war Mitglied des «Bored Ape Yacht Club» seiner Zeit.
Hinzu kommt die Ausdifferenzierung zwischen einem besonders exklusiven, teuren «Spitzenmarkt», an dem Fantastillionen-Preise für ein Beeple-Werk gezahlt werden oder eben der Gegenwert von 5 Hektaren Land für eine einzelne Zwiebel der «Semper Augustus» geboten wird (so geschehen 1636), und einem breiteren Einstiegsmarkt für diejenigen, die wenig zum Investieren haben – Pfundware bei den Zwiebeln, die immer noch erstaunlich teuer waren, und eben NFTs in Tausender-Auflagen, die zu immer noch stolzen Preisen von einigen hundert Dollar gehandelt werden. Eine im Oktober 2021 veröffentlichte Studie – erarbeitet von einer internationalen Gruppe von Mathematikerinnen und anderen Wissenschaftlern, unter anderem vom Londoner Alan Turing Institute – lieferte erstaunliche Ergebnisse: So gingen bis dahin beispielsweise rund 75 Prozent aller NFTs für unter 15 Dollar weg und nur 1 Prozent der NFTs für mehr als 1595 Dollar. Der Verdacht liegt nahe, dass – wie so oft – nur ein winziger Teil der Marktteilnehmerinnen tatsächlich absahnen kann, während die überwältigende Mehrheit zwar dadurch angelockt wird, aber wenn überhaupt nur Brotkrumen abbekommt.
11. Der traditionelle Kunstmarkt kann zwar volatil sein, folgt aber gewissen Gesetzen: Die Preise bilden sich im Zusammenspiel von Reputation, Rarität und Spekulation. Die Reputation wird meistens – nicht immer – dadurch verbürgt, dass Künstler beziehungsweise zu erstehende Werke Teile bedeutender Museumssammlungen waren oder sind. Rarität liegt in der Regel auf der Hand: Einzelstücke zum Beispiel sind fast immer deutlich teurer als Teile einer Edition oder einer Serie. Beides, Reputation und Rarität, kann schliesslich potenziert werden durch die Eigendynamik der Spekulation (und zuweilen Manipulation).
Der NFT-Markt funktioniert ähnlich, aber keineswegs identisch. So arbeitet dieser bislang weitgehend ohne den Goldstandard musealer Weihen. Auch hier gibt es aber eine Parallele zur Tulpenmanie: Sie fiel ja ins goldene Zeitalter der niederländischen Malerei. Schon damals gab es signifikante Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen avancierter Kunst und entfesseltem Kommerz, wenn auch nicht so deutliche wie heute zwischen klassischem Kunstmarkt und NFT-Markt.
Es waren schliesslich Künstlerinnen, die die reich illustrierten Tulpenbücher anfertigten, das heisst Auktionskataloge, die funktionierten wie virtuelle Marktplätze – ähnlich den heutigen NFT-Plattformen, nur eben handkoloriert. Manche Künstler mischten selber kräftig mit: Der angesehene Landschaftsmaler Jan van Goyen beispielsweise verspekulierte sich dramatisch mit Tulpenzwiebeln und hinterliess astronomische Schulden. Und es waren dann auch Künstlerinnen, die nach dem Kollaps die Aufarbeitung lieferten. So malte Jan Brueghel der Jüngere – sonst vor allem für seine Blumen-Stillleben bekannt – um 1640 mehrere Varianten einer Affenallegorie: Darstellungen vermenschlichter Affen galten in der Malerei der Renaissance als sinnbildlich für Gier und Dummheit, diesmal auf die Tulpenmanie gemünzt.
Kunst und Wahrheit
So weit also die frappierenden Parallelen zwischen Tulpenmanie und NFT-Hype. Sie führen uns letztlich zu einem ganz entscheidenden Phänomen: dem des grossen Spannungsverhältnisses zwischen spekulativer Dummheit und künstlerischer Intelligenz. Es waren nämlich ebenjene Jahre der Tulpenmanie, in denen zeitgleich nicht weniger als ein neues Paradigma der Kunst entstand. Oder, um mit dem österreichischen Kunsttheoretiker Helmut Draxler noch einen Schritt weiter zu gehen: Hier entstand überhaupt erst das moderne Verständnis von «Kunst». In seinem zuletzt erschienenen Grundsatzwerk «Die Wahrheit der Niederländischen Malerei» erläutert Draxler, wie sich im 16. Jahrhundert die Paradigmen ausprägten, die zeitgenössische Kunst und ihre Kritik überhaupt erst möglich gemacht haben.
Natürlich gab es schon vorher Kunst – grosse Kunst. Jede andere Behauptung wäre absurd angesichts der antiken, mittelalterlichen oder aussereuropäischen Kunst bis hin zur italienischen Renaissance. Doch wenn man davon ausgeht, dass mit Kunst ganz spezifische Wahrheitsansprüche verbunden sind – dass sie in einem sinnhaften und nicht bloss zufälligen Verhältnis zu ihrer jeweiligen Gegenwart steht und ihre ganz eigenen Botschaften transportiert –, ändert sich das Bild.
Dann muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Kunst bis in die Neuzeit hinein ihren Wahrheitsanspruch weitgehend auf die Sphären der Religion und der (meist religiös legitimierten) politischen Macht abstützte und deren «Wahrheit» repräsentierte. Sie blieb bis zum Beginn des Aufstiegs einer bürgerlichen, viel stärker säkularen Kultur «im Himmel verankert», denn, so Draxler: «(…) noch in der Sixtinischen Kapelle stellt sich die Wahrheitsfrage der Kunst gar nicht; Wahrheit ist innerhalb des religiösen Symbolisierungssystems immer schon vorgegeben (…) Es gibt hier keinen Raum für Zweifel, Abwägung oder Kritik, sondern in der Tat nur ein reines, überwältigtes Staunen angesichts einer ‹Kunst›, die vom göttlichen Geist selbst zu stammen scheint.»
Die Wahrheitsansprüche der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts sind demgegenüber aber nicht einfach nur die säkularisierte Form solcher religiöser oder spiritueller Transzendenz, sondern sie eröffnen einen erdgebunden-horizontalen Raum für Zweifel, Irrtum, Abwägung und Kritik: Ist das gute Kunst – oder überhaupt Kunst? Und was erfahren wir mit ihr und durch sie?
Die zentrale Eigenschaft der Kunst wird so die Ambivalenz, die Unbestimmtheit. Zugleich wird die Frage nach der Wahrheit zu einer künstlerischen Kategorie. Und zwar deshalb, weil es aufgrund der beginnenden Verabschiedung von zuallererst religiös fundierter Macht auch im politischen Raum (Herrschaft von Gottes Gnaden) plötzlich Bedarf gibt, symbolisch-ästhetische Fragen zu den Verhandlungsräumen zwischen Politik, Wissenschaft, Ökonomie und Religion zu stellen. Das heisst, es bleibt erst einmal offen, ob die Kunst die neuen Entwicklungen – die neuen gesellschaftlichen Klassen, die neuen Märkte – feiert oder kritisiert, anstatt sie bloss zu repräsentieren.
So wird die Kunst – insbesondere wenn sie für eine Öffentlichkeit zugänglich ausgestellt wird – zum symbolischen Möglichkeitsraum für das Unentschiedene, das Potenzielle, das Ambivalente. Erst so wird die Unterhaltung über die Kunst eine, die über Aspekte handwerklicher Virtuosität und Daumen-rauf-Daumen-runter-Fragen (Meister oder Scharlatan, Staunen oder Abscheu) hinausgeht.
Stattdessen steht nun im Zentrum: Was sehe ich da überhaupt, und was bedeutet es? Während die italienische Hochrenaissance noch die Vorstellung des gemalten Bildes als Fenster hinein in eine eingefangene Realität favorisierte, wird, so Draxler, in der niederländischen Malerei das Tafelbild zu einer «Schwelle». Ob Stillleben, Gruppenbild oder Genre-Szene: Immer wieder sind die Betrachtenden auf eine Art ins Bild hinein impliziert, als Betrachtende mitgedacht, die an einer Schwelle stehen. Statt einer klaren Differenz zwischen Schein und Wirklichkeit ist es nun eine Malerei, die, so Draxler, «unterschiedliche Wirklichkeitsaspekte» aufruft und «die Spielräume zwischen ihnen verhandeln kann».
Anatomie des Zweifels
Ein berühmtes Beispiel ist Rembrandts «Die Anatomie des Dr. Tulp» von 1632 – wir wohnen einer Sektion am Leichnam bei, der Arzt führt am geöffneten Unterarm die Funktion der Muskelstränge vor, umringt von neugierigen Mitgliedern seiner bürgerlichen Gilde der Chirurgen und Barbiere. Und wir als Betrachter komplettieren diese Umringung. Wir schauen auf ein Sinnbild der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung, das in säkularisierter Form an den Finger des zweifelnden Thomas in der Jesus-Wunde erinnert. Der Zweifel, das noch zu Ergründende, gehört fortan zum Ethos der Kunst. Sie bringt sich in Stellung nicht als Dienende der Religion und der Wissenschaft, sondern als deren Komplement, wenn nicht gar Konkurrentin im Ringen um Wahrheit und Erkenntnis.
Dass der Mann auch noch Nicolaes Tulp, mit Nachnamen also «Tulpe», hiess, war übrigens der Tatsache geschuldet, dass er nach seinem Studium in Leiden an der Amsterdamer Keizersgracht in ein Haus zog, an dem ein Schild mit einer Tulpe hing – und er sich fortan diesen Namen gab (eigentlich hiess er Claes Pieterszoon). Die Tulpe wurde sein Familienwappen und sein Markenzeichen.
Es mag Zufall gewesen sein, dass Rembrandts sinnbildlicher Wahrheitssucher ausgerechnet die Tulpe zu seinem Emblem machte. Aber es passt. Zur vermeintlich kalten Wissenschaftlichkeit der Wahrheitssuche (die bleiche Leiche) gesellen sich die Anmut, der Variationsreichtum der Tulpe. Zur Ernsthaftigkeit gesellt sich die haltlose Spekulationsblase um die schöne Zuchtblume. Doktor Tulp ist ein schillernder Mosaikstein in der historischen Genealogie der aktuellen Kunst, inklusive des NFT-Hypes.
Jedenfalls schuf die offene Wahrheitsfrage der niederländischen Kunst –wie Draxler aufzeigt – die Voraussetzungen für die moderne Kunst, für ihre Zuspitzungen auf Konzept und Abstraktion, für das radikale Oszillieren zwischen hehrer Ästhetik und Marktspekulation, für das gleichzeitige Abgrenzen von und Aufgehen in der rohen Wirklichkeit. Die Kunst wird im positiven Sinne paradox: Ihr «Spezifisches ist ihr Nicht-Spezifisches, ihr Sinn wurzelt im Sinnlosen».
Die Widersprüche der modernen Kunst
Vielleicht ist es also das, was in der aktuellen Kunst und in den NFTs kulminiert und verschmilzt: einerseits ein völlig entfesselter neuer Markt um Versprechen und Wetten auf ein ästhetisches Objekt der Begierde; andererseits eine Entwicklung der Kunst, die ihren Wahrheitsanspruch zunehmend paradox werden lässt. Für diesen Wahrheitsanspruch liegt, wie wir mit Draxler gesehen haben, die Wurzel im niederländischen 16. Jahrhundert; zu voller Ausprägung kommt er jedoch erst im 20. Jahrhundert durch Duchamp, Dada, Konzeptkunst, Minimal Art und Pop-Art.
Erst im 20. Jahrhundert wurden die Voraussetzungen geschaffen, nach denen auch ein Grossteil der zeitgenössischen Kunst – und mit ihr die NFTs – heute funktioniert. Eine erste Grundlage ist das, was sich mit Marcel Duchamps Readymades etabliert: Ein Kunstwerk kann ein vorgefundenes, industriell gefertigtes Objekt sein, etwa ein Flaschentrockner, eine Schneeschaufel oder ein Urinal (heute: eine Datei).
Zweitens kann wie bei einer Dada-Collage und im Surrealismus Sinn und Unsinn durch Kollision vorgefundener Bilder entstehen (wie erwähnt fussen viele algorithmisch zusammengewürfelte NFT-Bildchen auf dem Cadavre-Exquis-Prinzip).
Drittens kommt die Serialität, die maschinelle Reproduktion hinzu: Wie bei den in Reihe aufgestellten Kisten der Minimal Art eines Donald Judd oder den Siebdruck-Serien Andy Warhols wird die industrielle Produktwelt in der mechanischen Wiederholung des künstlerischen Artefakts gespiegelt.
Dieser lange Abschied vom virtuos handgefertigten Kunstobjekt (das natürlich zeitgleich an anderer Stelle weiterlebt, auch in der zeitgenössischen Kunst) gipfelte in den 1960ern in der «Dematerialisierung des Kunstwerks» wie es damals die Kunstkritikerin Lucy Lippard taufte. Die Konzeptkunst zeigte Ideen – ob noch als Objekt konkretisiert oder nur mehr mitgeteilt. Einige davon nahmen sogar den Charakter eines blossen Vertrags an. Der US-Amerikaner Douglas Huebler veröffentlichte 1969 – als Readymade – ein «Wanted»-Poster des FBI, auf dem nach einem flüchtigen Bankräuber gefahndet wurde, ergänzt um eine weitere Belohnungsklausel seitens des Künstlers: 1100 Dollar bot er ab dem 1. Januar 1970 bei sachdienlichen Hinweisen, die zur Ergreifung führen, er verringerte allerdings die Summe pro Monat um 100 Dollar, sodass sie zum 1. Januar 1971 bei null Dollar anlangte (der Bankräuber wurde erst 1981 verurteilt, Huebler konnte sein Geld also komplett behalten).
Huebler führte das System finanzieller Belohnung ad absurdum, auch in Bezug auf mögliche Käufer des Kunstwerks, die mit dessen zeitnahem Erwerb auch die Belohnung hätten berappen müssen. Das Ziel dabei war aber vor allem, die Sphäre der juristischen und ökonomischen Vertragsbestimmungen selbst zum Material und Medium von Kunst zu machen. Und es war dann ein gewisser Seth Siegelaub, der diesen Gedanken tatsächlich auch auf den Kunstmarkt selber anwandte.
Siegelaub war der massgebliche Impresario der New Yorker Konzeptkunst, er vertrat Huebler, Robert Barry oder Joseph Kosuth und machte sie erst richtig bekannt. Darüber hinaus war er 1971 der Initiator des The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement, eines Künstler-Verkaufsvertrags, der erstmals Künstlern Anteile beim Wiederverkauf zusprach – wie das durch NFTs nun auch möglich und üblich geworden ist (bei Siegelaub wurden 15 Prozent Royaltys für Wiederverkäufe vorgesehen, bei NFTs sind es in der Regel 5 bis 10 Prozent). Siegelaubs Vertrag wird bis heute in Kunstkreisen zitiert (wie auch hier), durchgesetzt hat er sich nicht – mutmasslich vor allem, weil Galeristinnen davor zurückschreckten, ihren möglichen Käufern die Wiederverkaufsklausel aufzudrücken. Dass es bei NFTs weithin akzeptiert ist, kann neben dem geringeren Prozentsatz auch einen schlicht technologischen Grund haben: Wir sind bei elektronischen Verträgen nun einmal viel eher bereit, das «Kleingedruckte» mit einem Klick zu akzeptieren (meist ohne es gelesen zu haben), als bei analogen Papierverträgen, die es händisch zu unterzeichnen gilt.
Die Technologie spielt also auch für die Akzeptanz und das Selbstverständnis von Künstlerinnen wie Sammlern im Vertragsvollzug eine nicht unerhebliche Rolle. Aber welche Rolle spielt sie künstlerisch? Wir haben schliesslich gesehen, dass künstlerische Auseinandersetzungen mit Readymade und identischer Kopie ebenso wenig voraussetzungs- und geschichtslos sind wie solche mit Kauf- und Vertragsvorgängen.
Der Kunstkritiker Kolja Reichert hat es in seinem Lang-Essay zur «Krypto-Kunst» so formuliert: «NFT-Kunst wirkt wie die realisierte Utopie einer Entmaterialisierung von Kunst, von der die Dadaisten, gefolgt von Fluxus und Konzeptkunst, träumten. Nur, dass zwar das Material verschwunden ist, aber der Warencharakter bestehen bleibt. Man könnte sagen: Die Kunst ist verschwunden und hat nur ihre kommerzielle Hülle übrig gelassen.»
Nur ihre kommerzielle Hülle übrig gelassen – diese Beobachtung muss man erst mal sacken lassen. Ob sie realisierte Utopie oder nicht eher Dystopie ist?
Die Net-Art der 1990er-Jahre setzte ähnlich wie NFT auf neue Technologie als Träger von Ideen und sass zumindest teilweise einem dadurch ähnlich begrenzten Sichtfeld auf, begrenzt auch durch die Eigenlogik und schnelle technische Obsoletheit der benutzten Tools. Einige wenige smarte internetbasierte Projekte haben den Eintrag in die Kunstgeschichte (und in Sammlungen) geschafft, aber allein schon die Tatsache, dass sie auf längst veralteten und oft nicht mehr unterstützten Protokollen beruhen, macht die Sache ausnehmend schwierig. Ob das bei Blockchain wirklich anders sein wird, muss sich noch zeigen.
Zwischenmenschliches statt Bytes
Vielleicht ist das die Hauptlektion der Entmaterialisierung der Kunst im 20. Jahrhundert: Wirklich konsequent wird es, wenn zu ihrer Produktion so wenig technischer Aufwand wie möglich betrieben werden muss. Wenn nichts als Gedanken, Gesten, Begegnungen ihre Wirkung entfalten, zum Beispiel in den Werken des deutsch-britischen Künstlers Tino Sehgal. Seine performanceartigen Werke, die mit Gesprächen und zuweilen tänzerischen Elementen arbeiten, sind in bedeutende Museumssammlungen wie die des Moma eingegangen. Aber die Museen haben dazu keine schriftliche Aufzeichnung, keine Fotos, nicht einmal einen schriftlichen Vertrag – sie mussten die Werke bar in Anwesenheit eines Notars kaufen. Nur über mündliche Instruktion darf die Arbeit weitergegeben werden.
Diese Umgehung von Aufzeichnungstechnologie und Verschriftlichung ist aber nicht in Technophobie oder Schriftfeindlichkeit begründet. Angestrebt wird von Sehgal vielmehr die – tatsächlich dadurch einsetzende – Intensivierung der zwischenmenschlichen Akte des Sprechens, des Interpretierens, der Abmachung.
Vielleicht liegt da der Schlüssel, auch die ökonomischen Kapriolen und künstlerischen Untiefen der NFT-Blase zu überstehen. Vitalik Buterins Projektierung von soulbound NFTs geht bereits in diese Richtung: Es geht darum, vom Casinofeeling wegzukommen und davon, dass NFTs die Tatsache aufhübschen, dass Blockchain letztlich eine, so Kolja Reichert, «Buchhaltungstechnologie» ist. Stattdessen muss auf die Hoffnung gesetzt werden, dass NFTs zu einer Art Zertifizierung und Symbolisierung gesellschaftlicher Initiative werden, die zwischen Individuum und Gemeinschaft im Sinne von Transparenz und Gerechtigkeit vermittelt – und zu einem Ort für künstlerische Ideen, die genau dieser Vision ästhetisch auf den Zahn fühlen.
Die konzeptuell bislang vielleicht konsequenteste Variante von NFT-Kunst stammt von dem Schweden Jonas Lund. Bereits 2018 lancierte er den «Jonas Lund Token», der genau das ist, was er sagt: Der Künstler tokenisiert sich selbst. Nicht nur sein Name wird etwas, an dem man Anteile halten kann, sondern das künstlerische Handeln selbst wird zum Gegenstand einer durch Wertgutscheine vermittelten Verständigung. Das zielt natürlich nicht nur auf die Blockchain-Welt, sondern auch auf den immer noch sehr präsenten Mythos vom Einzelkünstlergenie, das aus unerklärlichen kreativen Quellen schöpft.
Lund, Jahrgang 1984, treibt das Prinzip der Multi-Optionalität in der Lebens- und Karriereplanung auf die Spitze, was für die Generation der Millennials typisch ist. Der Künstler tritt zugleich als Unternehmer seiner selbst auf, der virtuelle Galeriebesuch seiner Investoren wird zu einer Art Vorstandssitzung. Alles repräsentiert gleichzeitig immer mindestens zwei Dinge in zwei bis dahin getrennten Wertesystemen.
Letzten Herbst stellte Lund im digitalen Nachbau der Berliner Galerie König auf der Meta-Plattform Decentraland aus: Sein Alter Ego stapfte durch die Architektur, es gab einen riesigen langen Tisch mit 50 Stühlen für die Anteilseigner und einen für ihn selbst als zentrales Exponat, darum herum waren grosse Puzzlestücke mit privaten Urlaubsschnappschüssen arrangiert, die ihm der Apple-Foto-Algorithmus als besonders teilenswert vorgeschlagen hat. Kunst als konsequentes Nullsummenspiel.
Doch Lund sitzt seiner so entfalteten Logik radikaler Opportunität natürlich nicht einfach auf. Er schliesst sie kurz mit jener Wahrheitsambivalenz von Kunst, die in den Niederlanden einst zur ersten Tulpenblüte führte. Bei der man sich also nie zu hundert Prozent sicher sein kann, ob sie etwas enthusiastisch feiert oder ironisch kritisiert, ob sie Pamphlet oder Parodie ist, Feier oder Denunziation. Und die uns damit hineinzieht in das Spiel der ästhetischen Wahrheitssuche.
Jörg Heiser ist Direktor des Instituts für Kunst im Kontext der Universität der Künste in Berlin. Er war knapp zwanzig Jahre lang Redaktor der britischen Kunstzeitschrift «Frieze».

