
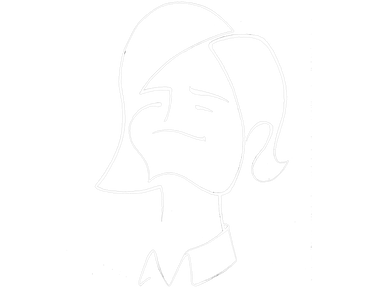
Zwei Türme, zwei Jahrzehnte
Heute vor zwanzig Jahren fanden die Terroranschläge von New York statt. Es war das Ende der Frivolität. Und wir haben die Folgen bis heute nicht hinter uns gelassen.
Von Daniel Binswanger, 11.09.2021
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Ein Epochenbruch prägt nicht nur den Lauf der Geschichte, sondern hinterlässt tiefe Spuren in den Biografien. Und zwar in allen Biografien, auch denjenigen von Menschen, die sich am 11. September 2001 nicht in New York aufhielten. Und die auch nicht von den Folgen der horrenden Kriege, dem nie mehr enden wollenden Kampf gegen den Terror oder von islamistischen Attentaten betroffen waren. Jede, die alt genug ist, kann ihre Anekdote beitragen, was sie gerade gemacht hat an dem Tag, als sie mit der Nachricht von den kollabierenden Türmen konfrontiert wurde.
Es gibt Ereignisse, die bleiben. Wie die Vorgänge beim überstürzten Nato-Rückzug aus Afghanistan jetzt so dramatisch gezeigt haben: Ereignisse, die auch nach zwanzig Jahren nicht vergangen und nicht bewältigt sind.
Ich selber sass damals am Schreibtisch und bekam einen Anruf von einem Freund. Er sagte, ich solle mal das Radio anmachen: Er stehe vor einer Bankfiliale mit einem Fernseher im Schaufenster, es würden diese Zwillingstürme in New York gezeigt, und er schaue gerade zu, wie sein Lebensmodell zusammenbreche. Jetzt müsse er alles ändern.
Er sollte recht behalten. Der Anruf kam zwar aus Zürich und nicht aus New York – und nein, an Leib und Leben bedroht war mein Bekannter von den Anschlägen genauso wenig wie ich, der in Paris war («Le Monde» titelte am übernächsten Tag: «Nous sommes tous Américains», eine Ungeheuerlichkeit für ein französisches Leitblatt). Der Grund für den Schock meines Bekannten war viel frivoler, angesichts der Tausenden von Opfern, welche die Anschläge forderten, und vor allem angesichts der Hunderttausenden von Toten und des immensen Leids, welche die nachfolgenden Kriege verursachten, beinahe albern: Er war damals zwar schon ein recht erfolgreicher Journalist, aber er lebte mehr oder weniger von Aktienspekulationen. Er sagte häufig und nur halb im Scherz, es sei einfach widersinnig, einen ganzen Tag an einem Artikel zu sitzen, wenn die Wertsteigerung von ein paar Yahoo-Futures über 24 Stunden dreimal höher sei als der Tagessatz.
Er begriff sofort, dass sein Erwerbsmodell nun ein schlagartiges Ende gefunden hatte und mit dem World Trade Center kollabierte. Der Wert seines Portfolios sank über Nacht auf null. Es war das Ende des Glaubens an die New Economy, an die neue Weltordnung, an den Demokratie-Triumph in der ewig fröhlichen «Post-histoire». Es war das Ende der Frivolität.
Es begann die Epoche des sogenannten Kampfes der Zivilisationen, des Krieges gegen den Terror, der Foltergefängnisse, der ausserordentlichen Auslieferungen. Es begann sofort der Krieg in Afghanistan. Und schon bald auch der Zweite Irakkrieg.
Die Rhetorik, die Atmosphäre, die Feindbilder änderten radikal, aber es lag doch auch eine Kontinuität vor, der das Gefühl eines Epochenbruchs nicht gerecht wird. Schon in den Neunzigerjahren herrschte der Glaube vor, es sei die Mission der westlichen Welt, rund um den Globus die Demokratie durchzusetzen – nur dass man noch überzeugt war, der Vorgang würde sich im Zuge der Globalisierung fast von selber erledigen. Und dass man, bestärkt durch den vermeintlich unaufhaltsamen Vormarsch der Demokratie in der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropa, dem globalen Triumph des liberalen Verfassungsstaates entspannt und siegesgewiss entgegenblickte.
Schon in den Neunzigern erfolgte allerdings auch die Wende zum Demokratie-Export durch Krieg oder wenigstens zum Schutz von Menschen und ihren Menschenrechten durch militärische Intervention: in Somalia, in Bosnien und natürlich im Ersten Irakkrieg. Der Philosoph Jürgen Habermas befürwortet den Ersten Irakkrieg explizit, im Namen völkerrechtlicher Grundsätze. Schon damals gab es hitzige Diskussionen über die «humanitären Interventionen», den pazifistischen Farbbeutelanschlag auf Joschka Fischer, die deutschen Tornados über Bosnien. Nach dem 11. September, um die Waffengänge in Afghanistan und im Irak zu rechtfertigen, berief sich die US-Administration ganz offensiv auf nation building und den militärischen Demokratie-Export. Aber das Konzept der humanitären Intervention dominierte schon das Weltbild der Neunziger.
Erst mit dem 11. September jedoch wurde dieses Weltbild vollkommen widersprüchlich und destruktiv. Im «Krieg gegen den Terror» ging es eingestandenermassen primär um etwas ganz anderes: die «Achse des Bösen» zerschmettern, den islamistischen Terror und seine vermeintlichen Unterstützer ausräuchern, Osama bin Laden zur Strecke bringen – ganz zu schweigen von der Jagd nach Massenvernichtungswaffen, die niemals existierten.
Wie passten die euphorischen Reportagen über afghanische Mädchenschulen, die im Herbst 2001 sofort nach der Eroberung Kabuls in den amerikanischen Medien zu lesen waren, zum deklarierten Ziel der Nato-Intervention: al-Qaida vernichten? Wie passte der Diskurs von Demokratie-Export und nation building, den die Neo-Cons um Paul Wolfowitz entwickelten, zu ihrer Blitzkrieg-Strategie, den Irak mit maximaler technologischer Überlegenheit und minimalem Truppeneinsatz zu überrennen – und dann zur Tatsache, dass sie ausserstande waren, das Land zu administrieren und irgendetwas umzusetzen, was einen entfernten Bezug zu nation building gehabt hätte?
Welchen Sinn die amerikanische Präsenz in Afghanistan noch haben sollte, fragte Joe Biden bei seiner ersten Rede zum überhasteten Abzug. Nach zwanzig Jahren Besatzung wirkte diese Frage extrem zynisch. Aber einen Punkt hatte Biden: Sie wurde nie kohärent beantwortet.
Der österreichisch-afghanische Journalist Emran Feroz schildert in seinem jetzt erschienenen Buch «Der längste Krieg», einer ungeheuer lehrreichen Geschichte Afghanistans und der zwanzigjährigen Besatzung, auf eindrückliche Weise, wie zerstörerisch der Gegensatz zwischen der nation-building-Rhetorik und dem schmutzigen Krieg gegen den Terrorismus gewesen ist. Nicht nur ruhte die vermeintliche Demokratisierung Afghanistans auf einem strategischen Pakt mit Warlords und politischen Kräften, die in keiner Weise weniger gewalttätig oder weniger fanatisch waren als die Taliban. Die Besatzungsmächte selber machten sich mit ihren Foltergefängnissen, dem sehr viele zivile Opfer fordernden Drohnenkrieg und zahlreichen nie aufgeklärten Kriegsverbrechen als Verteidigerinnen von Demokratie und Menschenrechten weitgehend unglaubwürdig.
Dieselbe Inkonsequenz, dieselben strategischen Halbheiten führen jetzt auch zur humanitären Tragödie des überstürzten Rückzugs: Natürlich hat die zwanzigjährige Präsenz der westlichen Mächte die afghanische Gesellschaft verändert, sie hat zu einer besseren Bildung der weiblichen Bevölkerung, zum Heranwachsen unabhängiger Medien und Kulturinstitutionen, zur Entwicklung einer urbanen Mittelschicht beigetragen. All dies wird nun nicht geschützt, sondern kaltschnäuzig wieder preisgegeben. Auf dem Rücken derer, die schon immer die Opfer dieses brutalen Krieges waren: der afghanischen Zivilbevölkerung.
Aus westlicher Perspektive ist der zwanzigste Jahrestag des 11. September jedoch noch aus einem ganz anderen Grund bedrückend. Im ersten Jahrzehnt nach dem New Yorker Anschlag führte die westliche Welt ihre zweifelhaften Kriege gegen den Terror – und wurde unvorbereitet davon überrascht, dass die Weltordnung nicht nur durch neue Formen des religiösen Fanatismus, sondern durch die Instabilität des globalen Finanzsystems bedroht ist. Die US-Regierung jagte nicht existierende Massenvernichtungswaffen im Irak – und sah den Zusammenbruch des eigenen Bankensystems nicht kommen.
Am Ende des zweiten Jahrzehnts nach 9/11 stellt sich die Frage nach einem potenziell noch bedrohlicheren Defizit: Welche Kapazitäten zum vermeintlichen Demokratie-Export kann ein Land überhaupt aufbringen, wenn seine eigene Demokratie in einer existenziellen Krise steckt? Nach dem Zurückdrängen von al-Qaida und nach den militärischen Erfolgen im Kampf gegen den Islamischen Staat hätte man hoffen können, dass der Westen heute besser aufgestellt ist für die Förderung der Demokratie in der Welt. Es ist das Gegenteil der Fall: Der Grund, weshalb die Biden-Administration Afghanistan nun vollständig aufgibt, liegt nicht nur darin, dass die Vereinigten Staaten seit einigen Jahren eine strategische Neuorientierung auf den Konflikt mit China vollziehen.
Es ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Afghanistan-Besetzung unpopulär war und dass Biden, um seine Handlungsfähigkeit aufrechterhalten zu können, die Heimatfront um jeden Preis priorisieren muss. Die USA selber sind inzwischen ein Risiko für die Entwicklung der Demokratie in der freien Welt – das Land, das dieses Jahr einen Quasi-Putschversuch erlebte, in dem eine der beiden Regierungsparteien von einer extremen Radikalisierungsdynamik erfasst worden ist und in dem bereits in gut einem Jahr – bei den midterm elections – der politische Trumpismus beide Parlamentskammern erobern und quasi an die Macht zurückkehren könnte. Ironischerweise ist es nun der chaotische Abzug aus Kabul, der Biden bei den midterms eine Niederlage zu bescheren droht.
Es ist ein trauriger Jahrestag, geprägt vom afghanischen Flüchtlingsdrama, das nichts ist als der Endpunkt einer seit 2001 verfehlten Politik. Wenigstens um die Flüchtlinge müssen wir uns jetzt unbedingt kümmern. Und um unsere eigenen Demokratien.
Illustration: Alex Solman